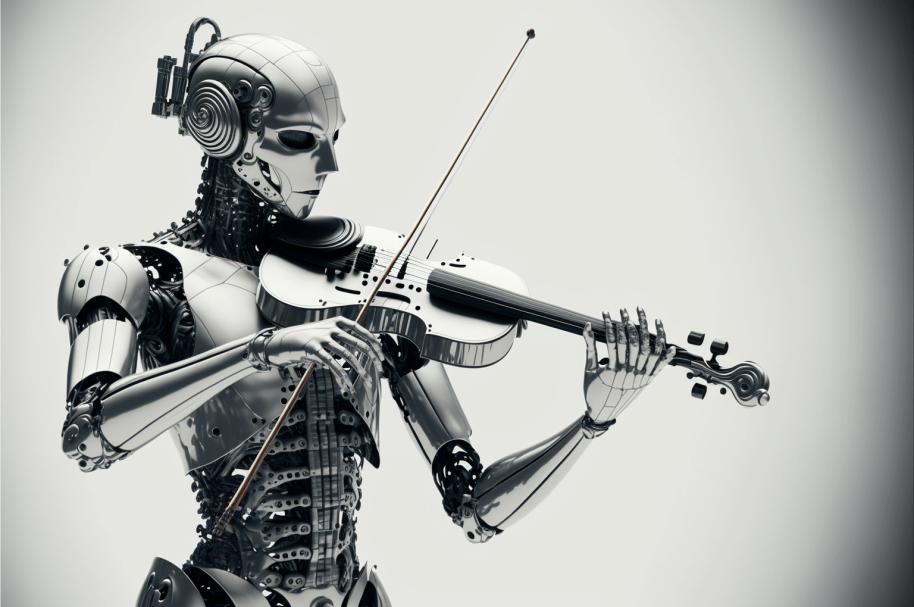Der Pflegenotstand. Nicht nur seit der Corona-Pandemie ein aktuelles Thema. Doch wie geht es den Pflegeheimen? Toni Höhne ist Einrichtungsleiter bei der Diakonie Simeon im Haus Elisabeth in Treptow-Köpenick. Wir sprechen über seinen Werdegang, den Pflegeberuf und die Anfänge und Herausforderungen der Pandemiezeit.
von Linda Luo
Ein Wunsch geht in Erfüllung
Herr Höhne, gibt es einen bestimmten Grund warum Sie sich genau für diesen Berufsweg, also den der Pflege, entschieden haben?
Ich wollte es schon immer werden. Meine ganze Biografie ist eigentlich medizinisch ausgerichtet. Damals die Schülerpraktika waren bei Unfallchirurgen, also niedergelassen in Praxen und nach meinem Abitur war ich Sanitäter bei der Bundeswehr. Ich habe freiwillig ein dreiviertel Jahr im Heim für chronisch Suchterkrankte gearbeitet und habe dann eigentlich als Krankenpfleger schon angefangen.
Was finden Sie so faszinierend an diesem Beruf? Ist es der Kontakt mit den Patienten?
Ja und das Medizinische hat mich schon immer interessiert. Deswegen habe ich mich auch für die Krankenpflege entschieden und nicht für die Altenpflege. Ich fand schon immer die Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers interessant: Was passiert wann, wo, wie und wie kann ich wo einschreiten, damit das nicht passiert? Genau das war eigentlich der Hintergrund, dass ich das machen wollte.

Einrichtungsleiter im Haus Elisabeth, Toni Höhne | Foto: Linda Luo
Was sind ihre Aufgaben als Einrichtungsleiter?
Alles. Ich bin der Mann für alles. Ich koordiniere den ganzen Kommunikationsverkehr nach außen. Die Darstellung des Hauses und des Unternehmens nach außen für die Politik, für aufsichtsführende Behörden, also Heimaufsicht, medizinische Dienste der Krankenkasse, Amt für Statistik, Gesundheitsamt, Bewohneransprachen und Interessentengespräche. Dann Bewerbungsgespräche, Einstellungen, Vertragsverlängerungen, Vertragsrahmenbedingungen, Vergütungsvereinbarungen und jetzt steht ein großes Thema an: Die Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes. Wir haben hier ein großes Projekt laufen, was hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres starten kann, da sind wir gerade in der Bauplanungsphase. Da ist viel Recherche was Brandschutz angeht, wie stellt man sich strategisch als Einrichtung auf, Kommunikation mit Krankenhäusern, Ärzten, neue Kooperationspartner finden, zum Beispiel Ärzte.
Übernehmen Sie als Einrichtungsleiter auch pflegerische Tätigkeiten?
Ja, wenn zum Beispiel krankheitsbedingt ein Ausfall ist. Pflege ist eine Face-to-Face Dienstleistung. Wenn dort Ausfälle sind müssen die kompensiert werden. Dadurch dass ich selbst aus der Pflege komme unterstütze ich die Kollegen auch manchmal.
„Das hat sich die Politik leider ein bisschen sehr einfach gemacht“
Mit welchen Herausforderungen und Problemen haben sie regelmäßig oder gar täglich zu kämpfen?
Physische und psychische Beschwerden sind gangbar. Man sagt ja immer, man soll eine professionelle Grenze in seinem Berufsfeld wahren. Das ist schwer in der Pflege, weil ich immer sage: Es ist ein grenzenloser Beruf.
Die größten Herausforderungen aus meiner Sicht als Einrichtungsleiter ist ganz klar der Personalmangel. Wir sind in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis von Leasingfirmen, aber Leasingfirmen verkaufen nur das was sie haben. Wenn bei denen einer krank ist, dann rufen die an und sagen „Er ist krank“. Das Problem ist, dass ich eine Dienstleistung eingekauft habe, die dann nicht ersetzt wird, aber ich mich darauf verlasse, weil die Pflege meiner Bewohner davon abhängt. Die Grundbedürfnisse die sie und ich haben, die aber von extern gesteuert werden müssen, weil ich es selber vielleicht nicht mehr hinkriege, sind da nicht gegeben. Das Prinzip „Stationäre Pflege“ beruht auf dem Prinzip der Leasingkräfte und nur so funktioniert das und so ist es in vielen Krankenhäusern auch.
Welche Herausforderungen sind durch die Pandemie neu hervorgekommen?

Der Empfangsbereich | Foto: Diakoniewerk Simeon Haus Elisabeth, ein Pflegeheim in Treptow-Köpenick
In der Pandemie ist gerade am Anfang deutlich aufgefallen, dass wir keine Hilfsmittel hatten. Da kann man auch noch so gut aufgestellt sein. Letztendlich haben wir von überall her versucht Hilfsmittel ran zubekommen. Wir haben hier bei uns in der Nähe einen DM, den haben wir alle Reise Kits abgekauft, weil wir keine Handflaschen hatten. Wir haben das Desinfektionsmittel selbst zusammengerührt und abgefüllt, weil wir es mussten, weil wir sonst gar nichts hatten und von außen gar nichts kam. Schwierig ist zudem diese Arbeitsverdichtung. Allein das Testen der Bewohner hier in meinem Pflegeheim kostet so viel Zeit. Das ist der Wahnsinn. Mal schnell so eine Station mit 15 Minuten Wartezeit pro Schnelltest zu testen, da fühlt man sich ganz schön allein gelassen, weil es einfach nur heißt „Ja hier, ihr müsst machen“. Genauso wie die Besuchsverbote, so war es ja am Anfang, den Angehörigen zu erklären, da würde ich selbst als Angehöriger sagen „Ihr könnt mir doch jetzt nicht vorenthalten, meine Eltern zu besuchen“. Das hat sich die Politik leider bisschen sehr einfach gemacht.
Letztes Jahr wurde vom Bundesgesundheitsministerium ein Pflegebonus bzw. der „Coronazuschuss“ vereinbart, bei der je nach Art und Umfang der Tätigkeit alle Beschäftigten in Berlin einen Zuschuss von bis zu 1000 € erhalten. In den Medien hat man oft gehört, dass dieser bei vielen nicht angekommen ist. Haben die Pfleger und Pflegerinnen den bekommen?
Ja. Ich habe es ja organisiert für meine Einrichtung, aber unser Unternehmen hat es auch mit organisiert.
Das heißt also 1000€ pro Person?
Naja, dass darf man nicht verallgemeinern. Also eigentlich 1500€: 1000€ vom Bund und 500€ vom Arbeitgeber. So war die Vereinbarung. Und da musste man sich einigen ob man die 500€ trägt und das hat die Geschäftsführung in unserem Unternehmen ganz klar gemacht. Die haben sich sofort dahinter gestellt und haben gesagt „Das Geld nehmen wir in die Hand und das geben wir aus. Das ist es uns wert“. Das ist aber prozentual nach der Rahmenarbeit bezeichnet.
Wie sieht denn das derzeitige Hygienekonzept bei ihnen aus. Was müssen Angehörige und Besucher beachten und welche Anforderungen werden an das Pflegepersonal gestellt?
Das steht in der Covid-Testverordnung. Für Besucher gilt aktuell 1G. Das heißt nur getestet darf rein – egal ob genesen, geimpft oder ungeimpft. Jeder wird getestet. Bewohner werden aktuell einmal in der Woche getestet. Außer Leute, die die Einrichtung verlassen, die werden dreimal die Woche getestet. Bei Mitarbeitern ist es so, dass wir Genesene und Geimpfte zweimal in der Woche testen und ungeimpfte Mitarbeiter jeden Dienst. So sind die Vorgaben und daran halten wir uns.
Der Pflegeberuf – Ein Knochenjob?
Aus Hochrechnungen für den Barmer-Pflegereport geht hervor, dass bis 2030 rund 182.000 Pflegerinnen und Pfleger fehlen dürften, so vermutet es diese Studie. Was sollte aus Ihrer Sicht unternommen werden, um den Beruf des Pflegers attraktiver zu machen?
Den Pflegeschlüssel erhöhen. Also man sagt ja immer „Die Pflege muss professioneller werden und da müssen mehr Anreize geschaffen werden“. Ich denke aber nicht, dass es daran liegt, dass sich die Leute nicht für die Pflege entscheiden, sondern jeder Beruf lebt ja so ein bisschen von Propaganda. Das Problem ist, dass man über die Leute, welche mit dem Gedanken spielen, eine Ausbildung in der Pflege zu machen hört, dass die Elternteile oder Bekannte die auch im Pflegebereich sind sagen „Oh Gott mach das bloß nicht, weil du arbeitest dich da zu Tode“. Da haben sie Recht. Ich glaube, um den Grundberuf attraktiver zu machen, ist zum einen die Stellung in der Gesellschaft wichtig. Für viele gilt immer noch „Pflege ist Assistenz des Arztes“. Nee, das ist ein Beruf, so wie Physiotherapie ja auch nicht „Assistenz des Arztes“ ist. Das ist ein eigenständiger Beruf, der mit an der Genesung des Patienten arbeitet. So ist Pflege ebenfalls zu deuten.
Und die Zeitnot ist das größte Problem in der Pflege. Viele sagen ja auch „Ich kann nicht mit einem guten Gewissen nach Hause fahren, weil ich nicht weiß, ob ich vielleicht durch einen Schusselfehler oder durch Zeitnot jemanden gefährdet habe“. Und das müsste angepasst werden, also noch mehr als Geld. Geld ist auch eine Sache, aber es kann nicht sein, dass ein Pflegehelfer immer noch darauf angewiesen ist Hartz 4 zu beantragen, damit er überhaupt sein Leben bestreiten kann. Da fragt man sich auch: „Warum sollte er denn noch im Dreischichtdienst arbeiten, wenn er auch zuhause sitzen könnte und letztendlich dasselbe Geld bekommen würde“. Aber Pflegeschlüssel anpassen sehe ich noch mehr. Das ist sozusagen immer Schwerpunkt bei mir.
Haben sie einen Tipp den sie an angehende Pfleger weitergeben können, der für den Einstieg in den Beruf hilfreich sein könnte?
Ich sage immer, dass man nie den Kopf hängen lassen und immer sozusagen auch an kleinen Momenten zehren sollte. Es gibt diverse Schichten, die jeder Pflegekraft immer im Kopf bleiben werden. Immer. Und das ist immer nochmal so ein Lichtschein, gerade wenn man so einen Dienst hat und man weiß gar nicht mehr, wo man zuerst anfangen soll. Ich glaube solche Momente helfen einem weiter.
Was unternehmen Sie in ihrer Freizeit als Ausgleich um ihre Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten?
Ja, ich habe meine Familie. Wir machen viel – mit meiner Frau, mit meinem Sohn. Kraftsport machen wir viel, also wir machen wirklich sehr, sehr viel Sport. Ich gehe mit meinen Jungs öfter „Bushcraften“, das finde ich sehr gut. Auch Geocaching, also alles was so recht viel draußen ist.
Gibt es einen Moment in ihrer Pflegelaufbahn der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Da gibt es ein Paar. Also was ich mal hatte war ein Mann im Koma und der ist in meinem Dienst wachgeworden. Damit hat auch gar keiner gerechnet. Und da war der auf einmal so quietschfidel, dass wir gucken mussten, wie wir das hier sicherstellen können, damit er sich nicht wehtut, weil er noch zusätzlich blind war. Ansonsten habe ich mal im Krankenhaus in einem Tumorzentrum gearbeitet und da hatte ich einen 14-Jährigen mit einem kompliziertem Rippenfellkarzinom über Weihnachten drin liegen und zur Diagnostik. Mit dem habe ich abgesprochen, dass seine Freundin ihn besuchen kann. In meinen ganzen Spätdiensten, die ich über Weihnachten hatte, war dann jeden Tag die Freundin mit da. So ein junger Mensch mit so einer Diagnose ist echt schlimm und da tue ich mein Bestes, um es denen so angenehm wie möglich zu machen.
 Linda Luo studiert im 3. Semester Filmwissenschaft sowie Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie findet das dem Stellenwert der Pflege in Pflegeeinrichtungen und auch in privaten Haushalten noch mehr Aufmerksamkeit als bisher gewidmet werden sollte.
Linda Luo studiert im 3. Semester Filmwissenschaft sowie Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie findet das dem Stellenwert der Pflege in Pflegeeinrichtungen und auch in privaten Haushalten noch mehr Aufmerksamkeit als bisher gewidmet werden sollte.