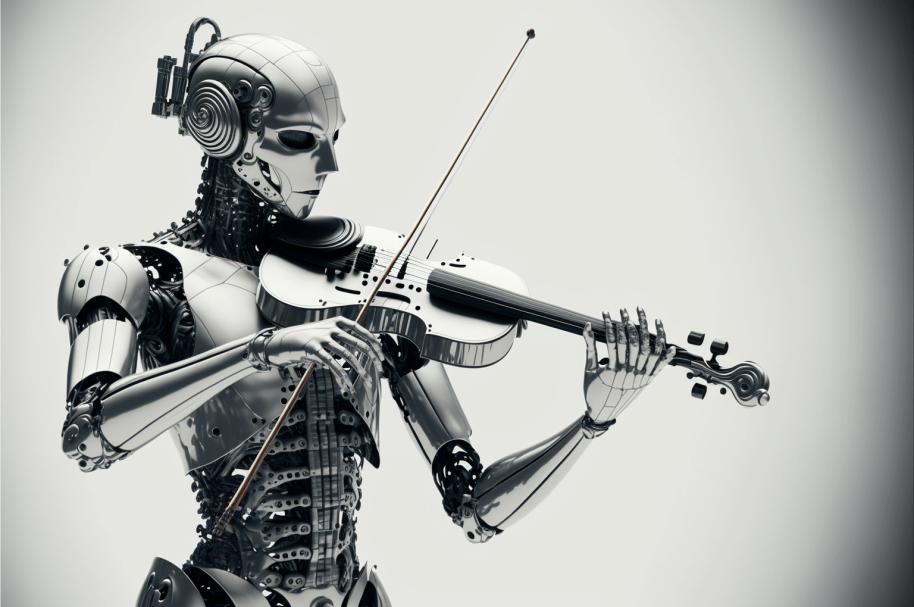Der 22-Jährige Christopher Hladitsch arbeitet als Gesundheits- und Krankenpfleger im akut psychiatrischen Bereich des Berliner Theodor-Wenzel-Werks. Im Interview spricht er über seine Arbeit, Herausforderungen und was sich in der Pflege verändern sollte.
von Pia Schulz
Sie arbeiten seit 2019 als Krankenpfleger in der geschlossenen Psychiatrie. Wenn Sie Ihre Arbeit mit drei Worten beschreiben müssten, welche wären das?
Immer wieder herausfordernd.
Können Sie mir von Ihrem Arbeitsalltag erzählen?
Mein Alltag auf der Station hängt immer von der Schicht ab, in der ich arbeiten muss. Die Früh- und Spätschichten unterscheiden sich dabei deutlich von der Nachtschicht. Die Spätschicht beginnt in der Regel um 13 Uhr und startet mit der Übergabe des Frühdienstes. Anschließend besprechen wir uns im Team bei einer Tasse Kaffee und klären, wer in welchem Aufgabenbereich arbeiten will. Auch wenn wir alle zusammenarbeiten, hat dennoch jeder seinen eigenen Bereich.
Was kann man sich unter diesen Bereichen vorstellen?
Im besten Fall sind wir drei examinierte Pflegekräfte. Einer kümmert sich dann um die Küche und damit auch um alle Aufgaben in diesem Bereich, wie beispielsweise das Zubereiten der Mahlzeiten für Patienten, die Hilfe brauchen. Ein anderer ist in erster Linie für die Patienten verantwortlich, bei Fragen und Aufgaben die Pflege betreffend tritt die Person dann in den Vordergrund. Die dritte Person kümmert sich um die Medikamente, also die Kontrolle und Vergabe des richtigen Medikamentes für die richtige Person zur richtigen Zeit.
Und wie läuft die Schicht nach der Besprechung weiter?
Nach der Übergabe und der Besprechung beginnt jeder erstmal in seinem Bereich. Die Patienten werden begrüßt und in der Frühschicht geweckt. Anschließend wird ihnen bei der Morgenhygiene geholfen, Medikamente werden kontrolliert und ausgeteilt und das Essen wird vorbereitet. Nach dem Frühstück kommen die Ärzte und es werden Besprechungen, Übergaben, Therapien und Sitzungen abgehalten. Für uns heißt das vor allem die Anordnungen ausarbeiten, alles Wichtige zu dokumentieren und bei Teamsitzungen oder Therapien dabei sein. Nach dem Mittag folgt dann die Ablösung durch die Spätschicht. Bei dem Wechsel ist es zum einen wichtig, dass die Station ordentlich übergeben wird, zum anderen darf man zu dieser Zeit aber nicht vergessen, dass auch die Patienten auf dem Flur und in der Nähe sind und oft nach Aufmerksamkeit suchen. Die können wir ihnen aufgrund der Unterbesetzung und der Masse an Arbeit leider nicht immer gewähren.
Also ist auch Ihre Station vom Pflegenotstand betroffen?
Ja, auch bei uns herrscht, wie fast überall, Pflegenotstand. Deswegen können wir leider nicht jedem Patienten die Aufmerksamkeit geben, die er verdient. Manchen Patienten, die fixiert oder isoliert sind, müssen unter ständigem Hör- und Sichtkontakt stehen. Falls dafür kein extra Personal organisiert wurde, muss das auch von dem Pflegeteam kompensiert werden. Die Unterbesetzung in Krankenhäusern ist also auch bei uns deutlich zu spüren.
Was sind Ihre Hauptaufgaben?
Die erste und wichtigste Aufgabe ist natürlich für das Wohl des Patienten zu sorgen. Aufgrund der hohen Dichte von Patienten mit verschiedenen Krankheitsbildern steht der Schutz der Patienten vor anderen oder sich selbst aber auch ganz oben. So haben wir beispielsweise eine bipolare Patientin auf der Station, die sich zurzeit in einer manischen Phase befindet und durch ihre maßlose Aktivität und dem übersteigerten Selbstwertgefühl sich oder anderen schaden könnte. Es gibt auch Patienten mit suizidalen Absichten, die unter engmaschiger Sichtkontrolle stehen.
Zudem sind die Pflege und die Beobachtung der Patienten selbstverständlich von großer Wichtigkeit, sodass körperliche oder psychische Beschwerden erkannt werden. Dazu zählen alle Grundpflegemaßnahmen, wie Blutzucker messen, die Vitalzeichenkontrolle, Ausgabe der Medikamente, Inkontinenzversorgung sowie Motivation zur selbstständigen Körperhygiene, damit die Menschen möglichst schnell wieder in ihr Leben eingebunden werden.

Dokumentieren der Patientenwerte | Foto: Karolina Grabowska
Zuletzt ist noch die Kommunikation zwischen Ärzte- und Pflegeteam zur Weiterleitung wichtiger Informationen vom Patienten und seiner Lebensführung auf der Station zu nennen.
Wussten Sie schon immer, dass Sie diesen Berufsweg einschlagen wollen, oder wollten Sie früher etwas anderes machen?
Ich wusste nicht, dass ich einmal Pfleger werden würde, auf meiner To-Do-Liste stand es definitiv nicht. Wie jeder Heranwachsender musste ich aber eine Entscheidung treffen, denn die Zeit bleibt nicht stehen und früher oder später muss man auch Geld verdienen.
In Kontakt mit Menschen, die im Alltag Unterstützung brauchen, kam ich schon recht früh durch Schulpraktika. Bei einem arbeitete ich in einem betreuten Wohnen für Jugendliche mit geistigen Einschränkungen und bei einem anderen in einem Seniorenheim bei mir um die Ecke und dort habe ich fast nur gute Erfahrungen gemacht. Außerdem arbeiten sowohl meine Mutter als auch meine Schwester im Gesundheitssektor, was meinen Entschluss gefestigt hat.
Und wie kam es dann dazu, dass Sie die Ausbildung zum Krankenpfleger angefangen haben?
Nach meinem Schulabschluss war ich im Ausland. Eine sehr gute Freundin von mir hatte zu der Zeit ihre Ausbildung abgeschlossen und begann ihre Laufbahn im Theodor-Wenzel-Werk. Da erzählte sie mir, wie gut ihr die Arbeit dort gefällt. Sie sprach von einer ausgeglichenen und offenen Teamatmosphäre, einer 32 Stundenwoche, bei der sie dennoch ein gutes Gehalt bekam und in einem aufregenden Themenbereich mit Menschen in akuten Lebenssituationen arbeiten konnte.
Mussten Sie danach eine besondere Spezialisierung oder Weiterbildung machen, oder kann man nach der Ausbildung direkt in der Psychiatrie anfangen?
Nein, für die Arbeit in der Psychiatrie, auch im akuten Bereich, braucht man keine Weiterbildung. In der Regel wird man von einem erfahrenen Kollegen eingearbeitet und bekommt Klinikinterne oder -externe Fort- und Weiterbildungsangebote, wie beispielsweise Kurse zum Deeskalationstraining.

Die Flure einer psychiatrischen Station | Foto: Erkan Utu
Gibt es ein Arbeitserlebnis, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Leider ist es bei uns keine Seltenheit, dass es zu körperlichen Übergriffen seitens Patienten kommt, sowohl gegenüber dem Pflegepersonal als auch gegenüber anderen Patienten.
Wenn man bei solchen Situationen dazwischen geht, ist das immer aufregend und bleibt als Erfahrung im Kopf zurück. Mir ist mal eine ältere Frau mit dem Fuß voran in die Rippen gesprungen: Es war schon spät, ich hatte gerade die Tür zum Pflegebad verschlossen. Sie war die einzige auf dem Flur und eigentlich hatte ich eine gute Beziehung zu ihr, aber in diesem Moment verkannte sie mich und ging auf mich los. Da sie eher schmächtig war, ließ sich die Situation schnell entschärfen, aber das war definitiv ein einschneidendes Erlebnis.
Was mögen Sie an Ihrer Arbeit und was eher weniger?
An meiner Arbeit mag ich vor alle den Kontakt zu den Menschen. Ich beschäftige mich mit vielen Personen unterschiedlichster Herkunft, Religion, Kultur und Hautfarbe und kann so viele Werte sammeln. Außerdem fühlt man sich auf eine Art gebraucht, man erfüllt einen Zweck, man hilft. Die Dankbarkeit, die man leider nicht oft genug erfährt, ist dann unverwechselbar. Was mir eher weniger gefällt ist, dass der Beruf kaum wertgeschätzt wird. Ich denke das kommt daher, dass wir auch die Aufgaben erledigen müssen, die etwas schmutziger sind und der Job deswegen oft abgestempelt wird. Zu oft wird vergessen, wie sehr die Pfleger und Pflegerinnen sich aufopfern, damit es anderen besser geht.
Wenn Sie etwas in Ihrem Arbeitsumfeld, an dem Beruf oder der Pflege ändern könnten, was wäre das?
Der Beruf ist sehr schön, aber ich würde mir mehr Geld wünschen. Nicht, weil ich mehr Geld will, sondern um neue Kollegen zu locken, damit die Arbeit leichter und entspannter wird. Außerdem sollte es mehr Angebote zur persönlichen Erhaltung der Gesundheit für Pflegekräfte geben, also Dinge wie Physiotherapie oder Rückenschulen, die in den Krankenhäusern meistens sowieso vorhanden sind. Auch Kostenübernahmen für Fitnessstudios oder psychologische Begleitung wäre wünschenswert. In manchen Krankenhäusern gibt es solche Angebote schon, aber es gibt auch viele Häuser, denen so etwas nicht vergönnt ist. Da sieht es oft so aus, als würden Kranke Kranke pflegen.
Was würden Sie Menschen raten, die ebenfalls diesen Berufsweg einschlagen wollen?
Überlege es dir gut, die Ausbildung ist hart und verlangt alles von dir ab: Schweiß, Energie, Zeit, Nerven und vieles mehr. Du begegnest dem Tod und Menschen in den schlimmsten Situationen, du könntest mit Patienten arbeiten, die ansteckende Krankheiten haben, oder sich selbst oder anderen schaden wollen – sei dir also dessen bewusst. Außerdem sind der Drill und der Druck fast wie beim Bund. Durch die Hierarchien im Krankenhaus fühlt man sich manchmal wie ein Fußabtreter, sei dir auch dessen bewusst. Aber es ist ein schöner Beruf und du tust etwas Ehrbares, auch wenn das nicht jeder so sieht.
Die Ausbildung wird dich verändern, du wirst Dinge und Menschen anders betrachten und körperliche und psychische Beschwerden viel schneller wahrnehmen. Das ist eine Eigenschaft, die mir persönlich sehr gefällt. Zu guter Letzt: Du tust etwas Gutes und das Gute zu tun ist selten leicht.
Haben Sie Wünsche für die Zukunft?
Ich wünsche mir mehr Menschlichkeit und das ein guter Personalschlüssel die Arbeit erleichtert und wir mehr Zeit für die Patienten haben. Ein Krankenhaus ist ein Unternehmen und will somit möglichst viel Profit machen. Was das mit sich bringt, brauche ich nicht zu erklären. Deswegen wünsche ich mir für die Zukunft noch bessere Moralvorstellungen.
 Pia Schulz studiert im 5. Semester Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und BWL. Sie möchte mit dem Interview einem Randberuf wie der Psychiatrischen Pflege mehr Aufmerksamkeit geben.
Pia Schulz studiert im 5. Semester Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und BWL. Sie möchte mit dem Interview einem Randberuf wie der Psychiatrischen Pflege mehr Aufmerksamkeit geben.