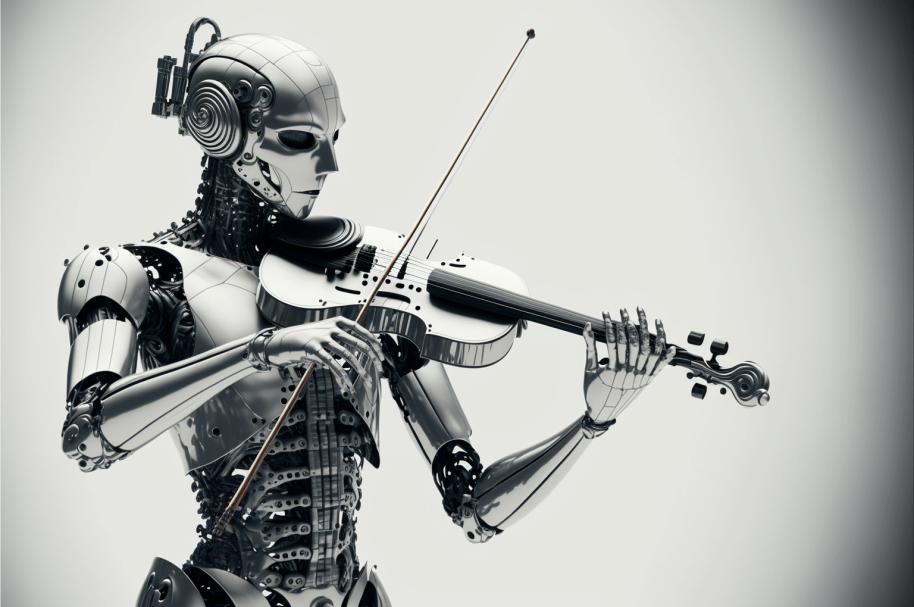Die ehemalige Notärztin, Frau Dr. Fahim-Jebrini, arbeitet seit ein paar Jahren im Zentrum von Berlin als Internistin in einer Gemeinschaftspraxis. Wie alle medizinischen Berufsgruppen, hat sie als Hausärztin die Corona-Pandemie aus einem anderen Winkel wahrgenommen. Mit viel Stress, Hemmungen und Angst haben auch HausärztInnen in den letzten Jahren zu kämpfen gehabt. Auch wenn sich die mediale Berichterstattung oftmals auf andere medizinische Bereiche konzentriert hat, hat sich die Arbeit in einer Hausarztpraxis an das Virusgeschehen angepasst. Im Interview spricht Dr. Fahim-Jebrini darüber, wie die Pandemie die Arbeit als Hausärztin beeinflusst hat.
von Ann-Sophie Podevin

Stethoscope and Laptop Computer | Foto: National Cancer Institute
Inwiefern hat Corona die Arbeit als Hausärztin in Berlin verändert?
Man merkt den PatientInnen an, dass sie mehr Hemmungen haben zum Arzt zu gehen, da sie Angst davor haben, sich anzustecken. Daher versuchen die PatientInnen oftmals, ihre Anliegen erst einmal im Privaten zu lösen und kommen dann erst bei gravierenderen Symptomen in die Praxis. Menschlich hat sich die Arbeit auch verändert. Früher hat man sich die Hand gegeben, war persönlicher miteinander und es war allgemein mehr Nähe da. Mittlerweile nähert man sich als Arzt oder Ärztin dem Patienten nur, wenn es wirklich sein muss und man versucht allgemein einen gewissen Abstand zueinander zu wahren. Auch die psychische Komponente spielt eine größere Rolle, als man annimmt. Die PatientInnen sind angeschlagen, daher ist es umso wichtiger, noch mehr auf ihre Sorgen und ihre Verfassung einzugehen und die Menschen in gewisser Weise aufzufangen.
Welche Umstellungen gab es coronabedingt bei euch in der Praxis?
PatientInnen mit Infektionssymptomen oder anderen noch so kleinen Hinweisen auf das Virus wurden zu einem bestimmten Zeitfenster, der Infektionssprechstunde, einbestellt. Somit konnten wir auch die Anliegen der PatientInnen in gewisser Weise voneinander trennen. Die regulären Sprechstunden wurden insbesondere während des Lockdowns eingeschränkt, da man auf einmal selber zusätzlich private Verpflichtungen, wie zum Beispiel die Kinderbetreuung, unter einen Hut bringen musste. Deswegen wurden Sprechstunden, die zum Beispiel am späten Nachmittag stattfanden, komplett gestrichen. Es wurde außerdem stark darauf geachtet, dass PatientInnen sich nicht zu lange gemeinsam im Wartezimmer aufhielten, was jedoch nicht immer zu vermeiden war. In unserer Praxis wurden außerdem Samstagssprechstunden für das Impfen eingerichtet, damit wir damit hinterherkommen.
Wie fühlt man sich in so einer Zeit als Hausärztin?
Man steht stark unter Druck und ist dauerhaft angespannt. Während meiner Arbeit bin ich ständig in Kontakt mit vielen Menschen und auch wenn man gut geschützt ist, ist man als Ärztin einer hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Da sind die Gedanken automatisch bei der eigenen Familie und man macht sich Sorgen, da man ungerne das Virus mit nach Hause bringen möchte. Vor allem, weil man auf Ärzte und Ärztinnen nicht verzichten kann. Die Arbeit ging genauso weiter, Corona kam dann einfach noch dazu. Andere Anliegen gibt es ja immer noch.
Politik in Zeiten der Corona-Pandemie für medizinische Arbeit
In der Corona-Pandemie gab es politische Maßnahmen, die der medizinischen Arbeit Unterstützung bieten sollte. Die Medien haben viel über verschiedenste medizinische Bereiche berichtet. Der Fokus lag jedoch oftmals auf den extremen Seiten der Pandemie – Krankenhäuser, Kliniken, Altenheime. Die HausärztInnen sind hierbei sehr untergegangen und tauchen nur selten in der medialen Berichterstattung auf. Auch wenig aus der Politik hört man wenig über die Hausartzpraxen, die in dieser Zeit, wie andere medizinische Nischen, unter Extrembedingungen arbeiten mussten.

Impfstoff Covid-19 | Foto: Towfiqu barbhuiya
Gab es durch politische Maßnahmen Schwierigkeiten in der Praxis? Wie fühlt man sich als Hausärztin in der Politik aufgehoben?
Es gab einige Probleme, vor allem wegen der Impfstofflieferungen. Bei uns in der Praxis kam es leider öfter dazu, dass Termine vergeben wurden, die dann doch nicht stattfinden konnten, weil der Impfstoff gefehlt hat. Im Hintergrund gibt es da natürlich viel Unzufriedenheit, zum Beispiel hinsichtlich der Eindämmung der Biontech-Impfstoffs. Dadurch entstanden Konflikte, die die Hausärzte mit den PatientInnen ausbaden mussten.
Es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Kliniken und Hausarztpraxen, wenn es um die Unterstützungen geht. Von der Politik gab es in den Praxen eine Hygieneziffer, die bei PrivatpatientInnen mit abgebucht werden durfte, um den finanziellen Aufwand, den man in der Praxis wegen der Coronabedingungen betreibt, auszugleichen, was jedoch nicht genug ist.
Gab es oft Konflikte zwischen PatientInnen und den Ärzten?
Es gab mächtig Stress. Viele PatientInnen haben sich bei den Ärzten beschwert, weil sie zum Beispiel Biontech anstelle von Moderna geimpft bekommen wollten. Biontech ist einfach der beliebtere Impfstoff und auf einmal wird dieser nicht mehr geliefert, weil noch so viel von einem anderen Impfstoff übrig war. Da gab es dann leider zu viele Termine, die man aus Mangel nicht mehr bedienen konnte, was für die PatientInnen dann natürlich frustrierend war.
Würdest du dir mehr von der Politik wünschen?
Wenn man so eine Impfkampagne durchzieht, kann man nicht einfach den Impfstoff eindämmen. Man muss den PatientInnen möglichst viele Anreize bieten und den gewünschten Impfstoff ermöglichen, ansonsten ist das ein Widerspruch. Ich würde mir auch mehr Transparenz und mehr Aufklärung wünschen. Es fehlt zum Beispiel vor dem Impfen die Informationsübertragung. Vor der Impfpflicht brauchen die Menschen mehr Informationen zu den Impfungen, über die Verläufe von Krankheiten oder aber auch Nebenwirkungen und über den Sinn davon. Ihre Ängste und Zweifel müssen ernst genommen werden. Mehr überzeugen, anstatt zu verpflichten. Vor allem muss man mehr auf die zurückhaltenden Leute eingehen. Die Bedenken anhören und nicht direkt runterspielen. Deswegen fand ich die Versammlung von unserem Bundespräsidenten mit den Impfskeptikern sehr gut, weil man da sehen konnte, wie die Politik einen Schritt auf die Menschen zugegangen ist.
Wie findest du die Vorhersagen zum Ende der Pandemie?
Ich denke, dass die PatientInnen sehr müde sind und einen Lichtblick brauchen. Das brauchen wir alle. Menschen, die wirklich eine Ahnung von der Thematik haben, können meiner Meinung nach solche Vorhersagen aussprechen. Vor allem, wenn diese auf Forschungen und theoretischen Grundlagen basieren und diese auch belegen. Jedoch sollte man solche Aussagen nicht nutzen, um sie als Druckmittel zu nutzen oder Angst zu verbreiten. Man merkt in der Praxis, dass die PatientInnen natürlich auch mit der Angst zu kämpfen haben.
Machst du deine Arbeit denn immer noch gerne?
Ich bin jedes Mal aufs neue dankbar für meine Tätigkeit. Gegen das Coronavirus kann ich an sich gar nicht wirklich viel machen, aber wenn man wenigstens auf die Psyche der PatientInnen eingehen kann, oder die Angst nehmen kann, dann hat man wenigstens das Gefühl etwas Positives beizutragen. Ich bin zum Glück auch nicht von der Existenz bedroht und als Ärztin kann man einfach etwas Gutes beitragen. Dafür bin ich jeden Tag dankbar.
Ann-Sophie Podevin studiert im 5. Semester Englische Philologie und Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin. In der Medienberichterstattung zu der Corona-Pandemie wurde ihrer Ansicht nach zu wenig auf die HausärztInnen eingegangen, weswegen ihr Interesse geweckt wurde, sich hiermit näher zu beschäftigen.