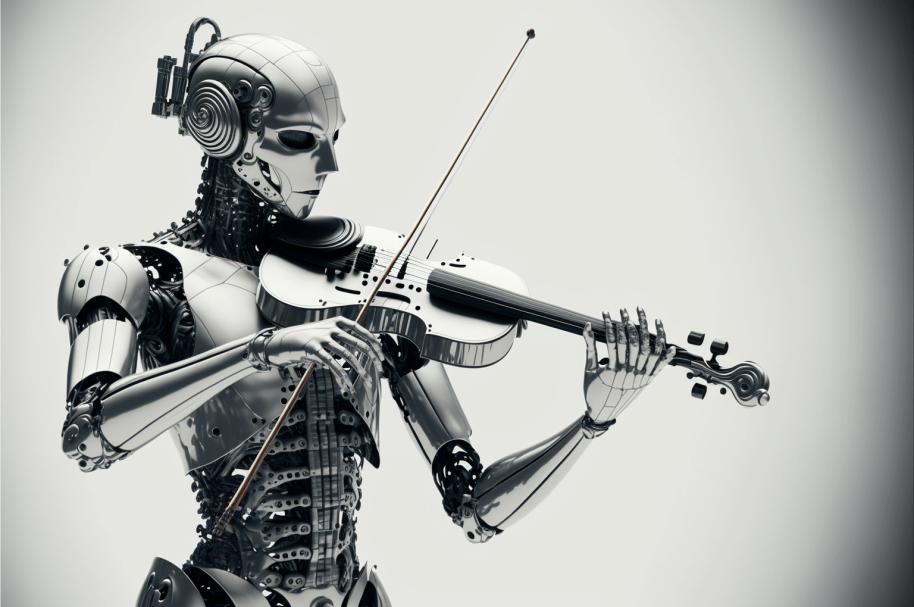Die Initiatorin des studentischen Projekts für Flüchtlinge „Me+me = we“, Agnes Disselkamp, spricht ehrlich und offen über die Arbeit mit Jugendlichen, die Stadt Berlin und die Situation der Flüchtlinge. Die Initiative hilft jungen Flüchtlingen mit Berliner Jugendlichen in Kontakt zu kommen.
Von Natallia Rudakouskaya
Worum geht es in diesem Projekt?
Unser Projekt heißt „Me+me is we“ und wir haben das während unseres Masterstudiums t, aber unabhängig von der Uni. Wir sind zu viert in dem Projektteam. Die Idee kam eigentlich von zwei anderen Kommilitonen und ich bin erst ein bisschen später ins Projekt gekommen. Wir haben alle im Team Bezug zur Jugendarbeit und haben im Austausch und der Begegnung das Projekt entwickelt.
Es geht in diesem Projekt darum, Jugendliche aus Berlin und geflüchtete Jugendliche in Teams zusammen zu bringen. Also quasi eine Brücke zu schlagen, ihnen ein Ort oder eine Möglichkeit zu geben, wie sie sich kennenlernen können. Wir haben bis jetzt sieben Teams zusammengebracht – 14 Teilnehmer. Wir sind aber immer noch auf der Suche nach neuen Teilnehmern. Es gibt im Flüchtlingsheim sehr viele Angebote für Kinder oder auch für Erwachsene, aber es gibt wenig für Jugendliche. Da bilden wir Tandems, die sich nach Möglichkeit einmal in der Woche treffen und zusammen in Berlin etwas unternehmen, sich, die Stadt und die Sprache miteinander kennenlernen.

Agnes Disselkamp, © Natallia Rudakouskaya
Wer kann an diesem Projekt teilnehmen?
Unsere Teilnehmer sind aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Iran, aus Benin. Wir versuchen immer Jugendliche im gleichen Alter zusammen zu bringen. Wir wollen überhaupt nicht, dass die Berliner den „armen Flüchtlingen“ die Welt erklären. Wir wollen, das war die Herausforderung, beiden Seiten Chancen bieten. Sie können sich beide etwas beibringen, kennen beide die Stadt Berlin. Es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte, gerade bei Jugendlichen. Sie können selbst entscheiden, was sie machen wollen. Wir haben, bevor die Tandems zusammen kamen, einen Workshop für alle organisiert. Wir haben Themen und Vorschläge gesammelt und überlegt, was man in Berlin machen kann, was sind Lieblingsorte, wo kann man toll Sport treiben. Das haben wir gesammelt und auf einer Berlinkarte lokalisiert, um Ideen zu geben.
Die meisten Teilnehmer sind schon lange in Berlin. Zu Beginn des Projekts haben wir überlegt mit Flüchtlingen zu arbeiten, die maximal drei Monate da sind. Dann haben wir aber gemerkt – nein, das geht aus zwei Gründen nicht. Erstens haben sie ganz viele andere Probleme, als sich auf das Projekt zu konzentrieren. Und zweitens ist in diesen drei Monaten so vieles unklar, dass man nicht weiß, dürfen sie bleiben oder werden sie vielleicht direkt abgeschoben. Deswegen haben wir mit den Unterkünften zusammengearbeitet, wo die Flüchtlinge schon länger sind – teilweise sind sie schon ein paar Monate da und teilweise zwei bis drei Jahre.
In welchen Sprachen arbeitet die Initiative und wie läuft die Kommunikation zwischen den Jugendlichen?
Wir haben eigentlich in Berlin nach Jugendlichen gesucht, die mehrsprachig sind, weil wir gehofft haben, dass wir die Tandems so bilden können, dass die Berliner Jugendlichen sowohl Deutsch sprechen, als auch die Sprache ihres geflüchteten Tandempartners, z.B. Arabisch. Aber das hat nicht immer so geklappt. Wir arbeiten hauptsächlich mit mehrsprachigen Jugendlichen aus Berlin, aber häufig können sie dann nicht die Sprache der Geflüchteten, mit denen wir sie zusammen gebracht haben. Entweder die Flüchtlinge können Deutsch oder sie verstehen Englisch.
Ist diese Initiative mit der Universität verbunden oder privat?
Wir sind jetzt kein eingeschriebener Verein oder so, in dem Sinne ist das eine Privatinitiative. Aber wir hätten es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn wir das nicht zum Masterprojekt hätten machen können. Aber es ist von der Uni unabhängig.
Wie laufen die Treffen ab?
Die Treffen finden in einem Zeitraum von zwei Monaten insgesamt acht Mal statt. Es ist schon eine Verantwortung zu sagen “Ok, ich treffe mich einmal in der Woche mit jemandem, den ich eigentlich nicht kenne und mit dem ich vielleicht schwer kommunizieren kann“. Deswegen sind diese ersten zwei Monate verpflichtend, weil wir nicht sicher sind, dass die Leute einander verstehen. Nach zwei Monaten können sie entscheiden, ob es weiter geht.
Sie arbeiten mit Flüchtlingen und erleben ihre Lebensumstände hautnah. Wie bewerten Sie die Situation der Flüchtlinge in Berlin aktuell?
Ich habe immer noch das Gefühl, man muss viel mehr machen, die Gesellschaft ist nicht offen genug. Ich glaube, genau durch diese Projekte können wir die Angst vor dem Fremden überwinden, vor den Dingen, die man nicht kennt. Ich glaube, man muss diese Projekte schaffen, wo die Leute sich kennenlernen können, um einfach zu sehen, ok, das sind ganz normale Menschen wie du und ich.
Ich glaube ganz viel hängt davon ab, was von oben kommt, von der Politik. Ich habe zum Beispiel letztens Plakate in der U-Bahn gesehen, wo stand, „Wir suchen Wohnungen für Flüchtlinge“ und stellen sie doch ein Zimmer in ihrer Wohnung zur Verfügung, wenn sie was frei haben. Und das war von der Stadt Berlin, das kam offiziell von oben. Und ich glaube, damit kann den Leuten Angst genommen werden, wenn die Regierung sagt, „Hey, die Leute, nimm die in deine Wohnung. Es ist kein Problem.“, dann denken die Leute vielleicht „Ok, genau, das ist kein Problem“.
Welche Schwierigkeiten gibt es bei dieser Arbeit? Und welche positiven Seiten?
Das war tatsachlich gar nicht so einfach. Einerseits gibt es sehr viele Flüchtlingsheime und viele Flüchtlinge in Berlin, anderseits gibt es auch sehr viele Projekte. Wir haben Glück gehabt, dass ich von Bekannten von zwei Flüchtlingsunterkünften in Kreuzberg gehört habe, in denen schon Projekte veranstaltet wurden und dann sind wir einfach direkt hingegangen. Wir haben mit dem Leiter gesprochen, das Projekt vorgestellt und dann ging das. Schwierig war es, das Vertrauen der Flüchtlinge zu gewinnen.
Die Flüchtlinge haben ganz oft zwei Aspekte angesprochen. Zum einen die Verbesserung der Sprache. Und zum anderen, die Möglichkeit, eine Brücke zur deutschen Gesellschaft und zur Stadt Berlin zu bauen. Sie sind dankbar über diese Möglichkeit, den Kontakt zu jemandem zu haben.
Titelbild: ‚THING #1 & THING #2‘ von Prayitno / CC BY 2.0
 Natallia Rudakouskaya stammt aus Minsk, der Hauptstadt von Belarus. Sie studiert Journalistik an der Belorussischen Staatlichen Universität und ist jetzt im letzten Studienjahr. Sie interessiert sich für Jugendinitiativen, die sich um Flüchtlinge kümmern, weil sie mehr darüber erfahren möchte, wie sich die junge Generation gegenseitig helfen kann.
Natallia Rudakouskaya stammt aus Minsk, der Hauptstadt von Belarus. Sie studiert Journalistik an der Belorussischen Staatlichen Universität und ist jetzt im letzten Studienjahr. Sie interessiert sich für Jugendinitiativen, die sich um Flüchtlinge kümmern, weil sie mehr darüber erfahren möchte, wie sich die junge Generation gegenseitig helfen kann.