
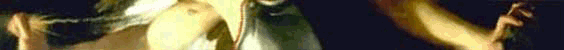

 |
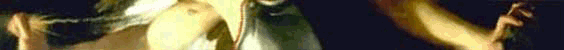 |
 |
| Schlußfolgerung | ||||
|
Michelangelo Merisi, gen. Caravaggio; Rosenkranzmadonna Leinwand H: 364 cm, B: 249 cm GG Inv.-Nr.147
|
Fasst man die Beobachtungen
zur malerischen Technik, die Ergebnisse der Röntgenuntersuchung und
die stilistischen Vergleiche zusammen, so ergibt sich der vorläufige
Schluss, dass alles auf eine Entstehung des Bildes in Caravaggios römischer
Periode verweist, also ins erste Jahrfünft des 17. Jahrhunderts, zwischen
die Seitenbilder der Cerasi-Kapelle in S. Maria del Popolo von 1601 und
die Madonna dei Pellegrini von 1605. Eine Entstehung in der ersten neapolitanischen
Zeit (1606/07), die durch die Provenienz des Bildes aus Neapel (wohl gar
zu sehr) nahegelegt war, ist stilistisch und technisch unwahrscheinlich.
Überraschend ist der technische Befund eines ursprünglich offenbar
durchgehend hellen (Landschafts-?) Hintergrundes, kaum denkbar in Caravaggios
Spätwerk. Unklar bleibt weiter die Auftragssituation: Ein Auftrag der Colonna-Carafa – wie immer wieder betont wird - , den der Meister während seiner Flucht aus Rom 1606 auf den Gütern der Colonna erhalten hätte und der für eine Kapelle in S. Domenico in Neapel gedacht gewesen wäre, erklärte kaum den unmittelbar darauf erfolgten Verkauf. Ebenso ist nach den Röntgenaufnahmen die Identifizierung des Wiener Bildes mit dem sogenannten Radulovic-Auftrag vom Oktober 1606 aus ikonographischen Gründen nicht mehr haltbar. Weiters ist die in der Literatur öfters geäusserte Vermutung ad acta zu legen, es handle sich bei der Wiener Rosenkranzmadonna um den Auftrag Cesare d'Estes Herzog von Modena, von dem wir durch Briefe wissen: das 1605/06 mehrmals erwähnte Bild für die der Geburt Mariae geweihte Schlosskapelle in Modena war neuesten Archivforschungen zufolge ein kleinfiguriges, narratives Bild, auf dem u.a. Joachim und Anna dargestellt waren. Caravaggio erhielt für das Gemälde, dessen Kosten er selbst mit 50 –60 Ducaten schätzte, im ganzen Vorschüsse in Höhe von 32 Ducaten. Über das Schicksal dieses von Caravaggio selbst nur widerwillig übernommenen Auftrags wissen wir weiter nichts. Die Tatsache, dass bis jetzt in den gut durchforsteten römischen und neapolitanischen Archivbeständen keine Nachrichten zu diesem grossen Altarbild aufgetaucht sind, spräche für einen (dann gescheiterten) Auftrag für eine Dominikanerkirche im italienischen Norden (Genua ?, Siena ?, Florenz ?, Lombardei ?), in Städten, mit denen Caravaggio oder seine römischen Förderer Beziehungen hatten. Spräche für einen Auftrag ausserhalb von Rom, für ein Bild, das Caravaggio vielleicht auch ausserhalb Roms gemalt hätte, die Tatsache, dass der Kunstschriftsteller und Maler Baglione die Rosenkranzmadonna in seinen Viten von 1642 nicht erwähnt ? Unter den publizierten Nachrichten oder Quellen ist ein Auftrag vom 5. April 1600 für ein grosses Bild (H.12 palmi, B. 7/8 palmi 268 x 79 cm, was allerdings etwas kleiner wäre als die Rosenkranzmadonna) für den Sienesen Fabio de Sartis zu erwähnen, für das Caravaggio sofort 60 Scudi als a conto von 200 erhält und das am 20.November 1600 saldiert wird. Weiters gibt es eine Nachricht von 1604 (2. Januar), nach der der „patrizio tolentinate” Lancilotti Mauruzi aus Rom den in den Marken weilenden Caravaggio empfíehlt, für S. Maria di Costantinopoli in Tolentino eine Pala per l’altar Maggiore zu malen. Abgesehen vom „passenden“ Datum, spricht allerdings nichts für eine Ausführung dieses Bildes, von dem auch sonst nichts bekannt ist. Es bleiben also noch weitere Rätsel zu lösen. |
|||
|
|
||||