
An der Freien Universität waren im Sommersemester 1995 rund 49.000 Studierende eingeschrieben, davon etwa 5.000 mit nichtdeutschem Paß. Trotz Reduzierung der Studentenzahlen blieb die Zahl der ausländischen Studierenden relativ konstant. Denn mit Beginn der neunziger Jahre begann auch allmählich der Ansturm der Migrantenkinder ö der sogenannten 2. Generation ö auf die Universitäten. Stark vertreten waren unter ihnen vor allem die Studierenden türkischer Herkunft. Studierende mit türkischer oder auch mit deutsch-türkischer Staatsbürgerschaft stellen an der FU unter den Studierenden nichtdeutscher Herkunft die größte Gruppe: 609 waren es im SS 95, knapp 12 Prozent der ausländischen Studentenschaft. Ihre Dunkelziffer liegt jedoch weit höher. Denn die sogenannten Bildungsinländer ö diejenigen, die ihr Abitur in Deutschland gemacht haben ö sowie die, die bereits in Deutschland eingebürgert sind, tauchen in der Ausländerstatistik nicht mehr auf.
Was bin ich? Ein Inländer, ein Bildungsinländer oder ein Ausländer? Ganz einfach ist es nicht, in Deutschland mit nichtdeutscher Herkunft Student zu sein. Es kann passieren, daß man schon bei der Immatrikulation nicht mehr weiß, wer man ist und wohin man gehört. Wie man letztendlich in schönstem Amtsdeutsch bezeichnet wird, entscheidet nicht der Notendurchschnitt oder ein Losverfahren, sondern die Paragraphen des Ausländergesetzes.

Mehmet Canbulut: "Ich würde auch nicht hierbleiben"
Drei Gesichter, drei Personen, drei Schicksale: Mehmet Canbulut, Germanistikstudent, Fatma K., Politologiestudentin, und Gülnaz Gönül, Medizinstudentin; so verschieden sie in ihrer Individualität und Biographie sind, so haben sie doch auch viele Gemeinsamkeiten, die für ihre Generation ö die sogenannte 2. Generation ö der in Deutschland lebenden Türkinnen und Türken stehen.
Mehmet Canbulut (30) kam durch das Gesetz zur Familienzusammenführung mit neun Jahren nach Deutschland. "Am Anfang hatte ich Anpassungsschwierigkeiten, weil ich nicht genug Sprachkenntnisse hatte", beschreibt Mehmet seine erste Begegnung mit Deutschland.
Eingewiesen in eine Grundschule in Hannover, lernte er zunächst in einer Klasse mit anderen türkischen Schülern Deutsch. Erst in der 4. Klasse konnte er in eine deutsche Regelklasse wechseln. Danach besuchte er die Hauptschule und schaffte später den Sprung auf die Realschule. "Aber ich mußte ab den 80er Jahren auch viel mit den Vorurteilen gegen Türken kämpfen", berichtet Mehmet. Das bewog ihn, zu sagen, "du fährst in deine Heimat, wo du nicht so benachteiligt wirst wie in Deutschland".
Leicht war es nicht, diese Entscheidung zu fällen, Familie, Freunde und alles, was er aufgebaut hatte, aufzugeben und in der Türkei von neuem anzufangen. Doch gesagt ö getan.
Am Schwarzen Meer in Samsun besuchte er ein Gymnasium. Die Probleme in der Schule und bei der Anpassung an die Lebensverhältnisse dort waren absehbar gewesen, doch Mehmet gewöhnte sich schneller an den Alltag als er dachte.
Seine Deutschkenntnisse garantierten ihm einen Studienplatz an der Universität. Da seine Leistungen nicht ausreichten, um Politologie zu studieren, entschied er sich für ein Germanistik-Studium. Nach dessen Abschluß arbeitete er eine Zeitlang als Deutschlehrer, kehrte dann wieder an die Universität Samsun als Wissenschaftlicher Assistent zurück. Ein Stipendium eröffnete ihm schließlich die Möglichkeit, nach Deutschland zurückzukehren, um an der FU seine Magister- und Doktorarbeit zu schreiben.
Seine Eltern leben zwar immer noch in Deutschland, aber Mehmet muß das Land unmittelbar nach Abschluß seiner Doktorarbeit verlassen, denn seine Aufenthaltsgenehmigung gilt nur für Studienzwecke. "Ich würde auch nicht hier bleiben", sagt Mehmet unmißverständlich und fügt hinzu: "Elf Jahre in der Türkei waren sehr schön. Man hat mich aufgenommen. Ich fühle mich dort zu Hause. Das Gefühl habe ich hier nicht." Sich wieder an die neue Umgebung und die Verhältnisse in Berlin und an der FU anzupassen, fiel ihm zunächst schwer. Er fühlte sich im Stich gelassen, nicht akzeptiert, nicht toleriert ö allein. " Ich werde diese schlimmen Tage nicht vergessen." Inzwischen sitzt Mehmet an seiner Magisterarbeit zum Thema Zweisprachigkeit bei türkischen Kindern und Jugendlichen. Sobald er seine Doktorarbeit geschrieben hat, möchte er wieder in der Türkei als Deutschlehrer arbeiten. Er will vor allem mit Rückkehrerkindern arbeiten.
Fatma K. wollte nach ihrem Abitur in Berlin eigentlich Architektur studieren. Der Numerus Clausus und die Ausländerquote (acht Prozent aller Studienplätze eines Faches waren für Ausländer oder die sog. Bildungsinländer reserviert; seit SS 1991 fallen diejenigen, die in Deutschland Abitur gemacht haben, nicht mehr unter diese Quote, d.Red.) standen ihr dabei aber im Wege. Bereits sehr früh begann sie sich politisch zu engagieren und sich mit ihrer kurdisch-alevitischen Identität auseinanderzusetzen. Daraus entwickelte sich der Wunsch, Politologie zu studieren. 1990 schrieb sie sich für dieses Fach ein, ohne genau zu wissen, was auf sie zukommen würde. Ihr Studienbeginn an der FU verlief relativ problemlos, da sie sich gleich zu Beginn des Studiums auch an der Uni im AusländerInnenreferat des AStA engagierte.
Interne Streitigkeiten innerhalb des AStA über die Golfkrise 1991 führten allerdings dazu, daß die Arbeit des AusländerInnenreferats mehr oder weniger zusammenbrach. Fatma verließ, wie viele andere auch, den AStA. Und die bis dahin bestehenden Beziehungen flauten allmählich ab. Aus ihren bisher bestehenden sozialen Zusammenhängen herausgerissen, empfand sie eine gewisse Leere, aus der heraus sie sich aber entschloß, das Studium so schnell wie möglich abzuschließen. Ohne lange zu zögern, konzentrierte sie sich ganz auf ihr Vordiplom. Demnächst wird sie sich zur Diplomprüfung melden.

Fatma K. - als Frau selbständig und unabhängig durch ein Studium
Studieren tut sie gerne. Für sie als Frau ist es auch deshalb wichtig, "weil es Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Identität schafft". Nur mit den Studienbedingungen und der Atmosphäre an ihrem Fachbereich ist sie nicht ganz zufrieden. "Zuallererst sollten die Seminare kleiner werden, sonst bringt das Studieren einem gar nichts mehr. Es ist demotivierend und macht keinen Spaß, wenn man als Student von den Tutoren nicht ernst genommen wird. Sie sollten mehr Flexibilität zeigen als bisher und sich um die Studenten kümmern", fordert die Politikstudentin.
Fatma war sieben Jahre alt, als sie ihr Dorf Varto in "türkisch Kurdistan" verließ und mit der Familie dem Vater nach Berlin folgte. Damals sprach sie nur Zaza, ihre Muttersprache. Erst in Berlin lernte sie Türkisch. Der lange Weg von der Vorschule bis zur Uni lief nicht immer glatt für Fatma, aber aufhalten ließ sie sich von niemanden. Am Ende der Mittelstufe war sie Klassenbeste im Fach Deutsch. Doch ihre Klassenkameradinnen begegneten ihr mit Unverständnis und Neid, Eltern von Mitschülern beschwerten sich gar beim Lehrer: Es war unvorstellbar für sie, daß das Kind eines "Ausländers" bessere Noten im Deutschunterricht bekommen konnte als ihr eigenes.
Inzwischen hat Fatma ihr Interesse vom Thema "Kurden" auf "Migration und Flucht" verlagert. Wahrscheinlich wird sie darüber auch ihre Diplomarbeit schreiben. Was sie nach dem Studium machen will, weiß sie noch nicht genau. An Architektur ist sie nach wie vor interessiert; vielleicht klappt es ja doch noch mit einem Studienplatz.
Gülnaz Gönül ist 25 Jahre alt. Geboren in Heidelberg, aufgewachsen und vor zwei Jahren eingebürgert in Berlin, studiert sie heute Humanmedizin. Auch sie mußte mit vielen Schwierigkeiten fertig werden, um überhaupt so weit zu kommen. Ein großes Problem für Gülnaz war, sich über ihre kulturelle Identität klar zu werden: "Vorher hatte ich immer die Überlegung gehabt, daß ein Teil von mir türkisch und der andere Teil deutsch wäre. Also, irgendwo dazwischen. Jetzt sehe ich das als etwas Ganzes oder Gemischtes. Als Berlinerin weiß ich jetzt, was ich bin, was ich von welchen Kulturen übernommen habe. Und das gefällt mir so."
Ursprünglich kamen ihre Eltern mit der Absicht nach Deutschland, hier zu arbeiten, Geld zu verdienen und zu sparen, um dann wieder in die Türkei zurückzukehren. Wie die meisten Arbeitsmigranten blieben auch sie. "Zu Hause wurde immer Türkisch gesprochen, in der Schule Deutsch", erinnert sich Gülnaz. Das waren zwei getrennte Welten für sie. Zu Hause kümmerten sich die Eltern ö besonders die Mutter ö sehr um sie, aber gleichzeitig wurde sie auch nach außen hin abgeschirmt. Die Schule war der einzige Ort, an dem sie sich außerhalb ihrer Familie und der übrigen Verwandtschaft aufhalten durfte.
Für sie gab es nur eine Lösung: "Aufs Gymnasium gehen und dann die Hochschule besuchen, um aus den Familienverhältnissen rauszukommen und selbständiger zu werden." Als dieser Schritt getan war, fiel es auch den Eltern leichter zu sagen, daß dies der beste Weg für die Tochter sei. "Mein Vater hat eingesehen, daß wir in einer für ihn fremden Gesellschaft für uns selber was tun müssen und nicht wie er für niedrigen Lohn den ganzen Tag arbeiten."
Als sie sich 1990 um einen Studienplatz der Humanmedizin bewarb, scheiterte Gülnaz ebenso wie Fatma an der Ausländerquote. "Alle anderen Freunde mit viel schlechteren Abiturnoten waren durch das Losverfahren oder durch die größere Kapazität für deutsche Bewerber reingekommen, wir türkischen aber nicht. Das hat uns am Anfang sehr verletzt." Gülnaz mußte fast zwei Semester extern studieren, bis sie einen regulären Studienplatz bekam. Extern studieren hieß für sie, sich um die Teilnahme an jedem Kurs einzeln zu bewerben und immer hinten anzustehen. Das Fach an sich mag sie sehr, aber nicht die Art, wie es gelehrt wird. Es ist ihr zu theoretisch und wenig praxisnah.
Gülnaz hat sich noch nicht entschieden, auf welchem Gebiet der Medizin sie sich spezialisieren will, aber sie möchte auf ihre Weise anderen Menschen helfen, sich selbst zu helfen ö eine Stütze sein.
Halil Can
Der Autor (28) ist Absolvent des Otto-Suhr-Instituts und lebt seit 1968 in Berlin. Neben der türkischen besitzt er seit 1990 auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

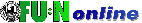 -Startseite
-Startseite