 Sport - Rassismus - Körperkult
Sport - Rassismus - Körperkult Sport - Rassismus - Körperkult
Sport - Rassismus - Körperkult"White men can't jump!" - diese Floskel von Talentsuchern im Basketball ist zur Metapher für das sportliche Unvermögen weißer Athleten schlechthin geworden. Sie hat es gar schon zu einem Filmtitel gebracht. Tatsächlich erklimmen schwarze Sportler und S portlerinnen zunehmend Siegerpodeste und besetzen Plätze in Nationalmannschaften. Ihr Bild in der (Medien-) Welt des Sports und der Werbung hat sich gewandelt. Sie gelten nicht mehr als hinter der Zivilisation Zurückgebliebene, sondern werden als Sieger d argestellt. Heldentum prägt ihr Image. Stars der internationalen Basketball- und Leichtathletikszene wie "Magic" Johnson, "Air" Jordan oder Merlene Ottey sind zu Idolen für Jugendliche in Europa geworden. Poster, "caps", Trikots und ihre mythisch aufgelad enen Namen sind Objekte kollektiver Begierden, Projektionsflächen vielfältiger Phantasien und Träume. Jugendliche versuchen die Bewegungsstile, Gesten oder "coolen" Posen schwarzer Sportler zu kopieren, um damit an ihrem künstlichen Charisma teilzuhaben.
Diese Idolisierung, so wird gelegentlich behauptet, wirke rassistischen Diskriminierungen geradezu entgegen. Sie erhöhe das gesellschaftliche Ansehen Schwarzer und bringe ihnen auch außerhalb des Sports Prestige und Sympathie ein. Der Sport ist aus die ser Sicht ein ideales Mittel gegen den Rassismus - eine Auffassung, die von vielen Sportlern und Sportlerinnen selbst vertreten wird.
Zweifellos mag sich schwarzes Selbstbewußtsein auch aus den beeindruckenden Erfolgen schwarzer Athleten speisen. Aber dies hat seinen Preis, ist doch die Welt des Sports eine Welt der Körper. Zwar gibt es heute nur noch wenige Menschen, die behaupten w ürden, "der" Schwarze sei ein halbes Tier, aber im Medium des Bildes vom schwarzen Sporthelden können alte Mythen untergründig fortleben.
"Der weiße Mann will das Gehirn sein, und er will, daß wir der Muskel, der Körper sind", schrieb Eldridge Cleaver zu Black-Power-Zeiten. Sporterfolge von Schwarzen können solche Zuschreibungen bestätigen. Denn vom Sport geht eine heimliche Tendenz zur Naturalisierung des Sozialen aus: Die Leistungsunterschiede in be- stimmten Sportarten von Weißen und Schwarzen werden allzuoft als Ausdruck natürlicher, nicht aber sozialer Tatbestände wahrgenommen und gedeutet. Der Glaube, Schwarze seien aufgrund ihres natürlichen, biologischen "Wesens" - einer spezifischen Muskelzusammensetzung, Anatomie oder Reaktionsfähigkeit - für bestimmte Sportarten besonders geeignet, hat sich tief ins Alltagsbewußtsein eingeschrieben.
Vollkommen übersehen, ja geradezu verdrängt, wird dabei der große soziale Druck, dem schwarze Sportlerinnen und Sportler ausgesetzt sind. Sport erscheint für viele Angehörige von Minderheiten als eine der wenigen Möglichkeiten, obere Sprossen auf der s ozialen Stufenleiter zu erklimmen.
Die von Lehrern, Eltern und Medien ermutigten Verheißungen einer Sportkarriere treiben sie zu ungeheurem Trainingsfleiß an. Die frühzeitige Festlegung auf eine Sportkarriere kann bedeuten, daß die schulische und akademische Ausbildung verkümmert. Zwar ist die Chance, ein hochbezahlter Sportstar zu werden, minimal, die wenigen jedoch, die es tatsächlich schaffen, beglaubigen das Stereotyp, Schwarze könnten es nur im Sport oder in anderen "Körperkünsten" zu etwas bringen.
Dieses Klischee bestimmt oft auch das Sportengagement der Akteure selbst. So engagieren sich schwarze Sportler und Sportlerinnen in genau jenen Disziplinen, für die sie prädestiniert zu sein scheinen, andere ziehen sich hingegen aus ihnen zurück ("ein Weißer hat ohnehin keinen Erfolg im Sprint"). Das Ganze funktioniert wie eine self-fulfilling-prophecy - der Augenschein sorgt für Evidenz. Beides zusammen, die Erfolge Schwarzer im Sport und ihre Chancenlosigkeit in anderen Gebieten, verleiht der mythisc hen Zuordnung der Schwarzen zu einer rein körperlichen und daher tierähnlichen Existenz die Authentizität des Sichtbaren. So erfüllt das Bild schwarzer Sporthelden wichtige symbolische Funktionen. Es fängt die zivilisationskritische Sehnsucht nach dem "gu ten Wilden" auf.
Doch hat das Begehren und die Bewunderung schwarzer Körperlichkeit eine Kehrseite: die Sprache des Hasses. Viele Zuschauer beruhigen ihre Irritationen, ihren Ärger und vielleicht auch ihre Furcht angesichts der körperlichen Leistungsfähigkeit von Schwa rzen und der Niederlagen Weißer mit rassistischen Entgleisungen.
Daß gerade schwarze Sportler rasch von der Rolle des Helden in diejenige des Sündenbocks gedrängt werden können, belegt die deutsche Fußball-Bundesliga. Die Vereinsführungen haben die Gesetze des Show-Marktes erkannt und setzen auf die Exotik afrikanis cher und südamerikanischer Spieler. Gerade noch gefeiert wegen ihres angeblich intuitiven "Torriechers", ihrer "Ballzauberei", ihrer Schnelligkeit und Gewandtheit oder auch ihrer Show-Einlagen (der kleine Lambada-Tanz an der Eckfahne), werden Spieler wie Yeboah, Valencia oder Okocha nur wenig später für Krisen und Niederlagen verantwortlich gemacht. Sie gelten dann bei Trainern, Kollegen, Zuschauern und Medien als undiszipliniert, unprofessionell und müssen die bittere Erfahrung machen, im Stadion mit Ban anenschalen, Imitationen von Affenlauten ("Uh, Uh, Uh") und verbalen Attacken ("Husch, husch, husch, Neger in den Busch") empfangen zu werden.
Die Geschichte des modernen Sports mit seinen weltumspannenden Festen zeigt, daß sich Sportler und Sportlerinnen aus allen Ländern und Kulturen durchaus miteinander messen können. Mit der Illusion allerdings, der Sport sei von seinem "Wesen" her ein un iversales Mittel kulturübergreifender Verständigung und gegenüber Rassismen immun, ist aufzuräumen. Vielmehr lassen sich im Sport offen diskriminierende, aber auch subtilere Formen eines "positiven" Rassismus erkennen, der durch die geradezu kultische Ver ehrung der Körperkünste von Schwarzen gekennzeichnet ist. Die Begeisterung für schwarze Athleten ist zwiespältig: Geht sie nicht allzuoft mit einer unausgesprochenen Abwertung von deren intellektuellen Fähigkeiten einher?
Ob der Sport trennende oder vereinigende Wirkungen hervorbringt, ob er rassistische Zuschreibungen beglaubigt, verstärkt oder ihnen entgegenwirkt, ob sich schließlich Körperkult und rassistische Diskurse miteinander verbinden, hängt nicht vom Sport all ein ab. Entscheidend sind auch die Muster, mit deren Hilfe er von Aktiven, Trainern, Medien und Zuschauern wahrgenommen und gedeutet wird, und das heißt letztlich: das politische Klima und die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen er stattfindet.
 Thomas Alkemeyer
Thomas Alkemeyer  Bernd Bröskamp
Bernd Bröskamp
Dr. Thomas Alkemeyer ist Akademischer Mitarbeiter am Institut für Sportwissenschaft in der Abteilung Sportsoziologie und Philosophie des Sports
Dr. Bernd Bröskamp ist Lehrbeauftragter am Institut für Sportwissenschaft

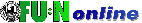 -Startseite
-Startseite