
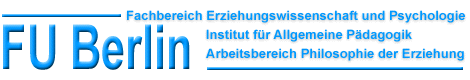 |
|
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2005/06 (WS 2002/03) (SoSe 2003) (WS 2003/04) (SoSe 2004) (SoSe 2005)
|
|
12 101- S - Bildung und Erziehung Mo
10.00-12.00 Bei diesem Seminar
handelt es sich um eine grundlegende Veranstaltung zur Einführung
in die wichtigsten
12 325 - HS - Wissensmanagement und Evaluation in Organisationen der Professionals Di
14-tägl. 18.00-21.00 Vor dem Hintergrund
neuerer organisationssoziologischer und professionssoziologischer
Theorien wird die 12 145 - PS - Kulturkritik und Bildungsmission Di 12.00-14.00 Habelschwerdter
Allee 45, JK 26/201 Ausgangspunkt des Seminars
ist die Rekonstruktion der kulturkritischen Haltung, mit der große
Teile des deutschen Bildungsbürgertums um 1900 in der Auseinandersetzung
mit den Modernisierungsfolgen ihr Selbstverständnis definierten.
Bildung war der positive Bezugspunkt, der vor dem Hintergrund der
kulturkritischen Klagen eine missionarische Leuchtkraft gewann.
Die großen pädagogischen Debatten um eine psychologische
Fundierung der pädagogischen Intervention um die Modernisierung
des Kanons und um die Professionalisierung der Lehrer müssen
auch vor dem Hintergrund sozialgeschichtlicher Verwerfungen interpretiert
werden. Diese Debatten werden der zentrale Gegenstand |
|
__________________________________________________________________ |
| 12104 V - Konzepte von Bildung und Erziehung I
Felicitas Thiel und Yvonne Ehrenspeck |
Mo 12.00-14.00
JK 25/130 (11.04.)
12336 OS - Definition und Begründung von Qualitätskriterien in der Evaluation von Bildungs- und Erziehungsprozessen
Felicitas Thiel
Di
18.00-20.00
KL 23/140 (12.4.)
Im Seminar soll die - teilweise sehr kontroverse
- Debatte um die bildungs- bzw. lerntheoretische Begründung von Qualitätskriterien
und entsprechender Verfahren ihrer Definition und Operationalisierung
aufgearbeitet werden.
Im Rahmen aktueller Evaluationsprojekte (Schulevaluation, Medienevaluation)
bzw. eigenen Forschungsvorhaben erhalten die Studierenden die Möglichkeit,
Begründung, Definition und Operationalisierung im Spannungsfeld von Aufraggebern
(z.B. Politik, Verwaltung, Wirtschaft ...), Evaluierten (z.B. Lehrer,
Schüler, Schulleiter ...) und Wissenschaft selbst zu erproben.
12125
PS - Reformpädagogische Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtskonzepte
Felicitas
Thiel
Di
12.00-14.00
JK 25/130 (12.4.)
Die bis heute populären Grundbegriffe der an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstandenen reformpädagogischen Konzepte (Erziehung vom Kinde aus, Pädagogik des Wachsenlassens, Erziehung durch Gemeinschaft, Arbeitsschule, Lebensschule ...) werden in ihrem historischen Entstehungskontext analysiert und auf gesellschaftliche Modernisierungsprozesse und Ausdifferenzierungsbewegungen des Bildungssystems bezogen.
__________________________________________________________________
Sommersemester 2004
| 12142 PS - Voraussetzungen und Bedingungen pädagogischer
Professionalität Felicitas Thiel |
Fr 14.00-17.00
K 23/27 (16.4.)
(begleitend zur Vorlesung: Philosophie der Erziehung "Erziehungswissenschaftliche
Reflexion und pädagogische Praxis")
Im Anschluss an die Vorlesung sollen Bedingungen und Voraussetzungen pädagogischer
Professionalität aus soziologischer und psychologischer Perspektive
erarbeitet werden: etwa Probleme des Technologiedefizits, der pädagogischen
Kasuistik, die besondere Form des klinischen und dogmatischen Wissens
oder Fragen des professionellen Ethos.
Besonderes Gewicht wird der Frage eingeräumt, wie die pädagogische
Kernkompetenz für unterschiedliche pädagogische Berufe definiert
werden kann.
Das Seminar findet im Format des Problem-based-Learning statt. Dieses
didaktische Arrangement ist durch die Verwendung von "Problemen"
als Lernanker gekennzeichnet. Ausgehend von diesen Problemen erschließen
sich die Lernenden in kooperativen Arbeitsformen die entsprechenden Inhalte.
Für dieses Seminar ist eine telef. Anmeldung unbedingt erforderlich,
im Sekratariat - Frau Bösche - unter Tel.-Nr. 838-55295.
12201 HS - Bildungssemantik und Bildungssystem
Felicitas Thiel
Di
12.00-14.00
KL 26/130 (13.4.)
Vor dem Hintergrund der Ausdifferenzierung des Bildungssystems werden zentrale bildungs- und erziehungstheoretische Texte diskutiert. Im Zentrum steht die deutsche Modernisierungsgeschichte im Zeitraum von 1780 bis 1933. Methodische Grundlagen sind Ansätze der Begriffsgeschichte und systemtheoretische Ansätze zu Semantik und Gesellschaftsstruktur.
12303
HS - Forschungsseminar: Modelle und Methoden erziehungswissenschaftlicher
Evaluationsforschung
Felicitas
Thiel
Di
18.00-21.00
K 23/27 (13.4.)
Dieses Forschungsseminar richtet sich an Studierende in höheren Semestern und setzt das im Wintersemester begonnene Forschungsseminar fort. Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind willkommen.
Im Zusammenhang mit Qualitätssicherungsmaßnahmen im Bildungssystem spielt Evaluation eine entscheidende Rolle. In verschiedenen Schulgesetzen etwa ist die Verpflichtung zu interner und externer Evaluation bereits verankert.
Am Beispiel von Evaluationsprojekten aus den Bereichen Schule und Medien sollen Voraussetzungen und Modelle der Evaluationsforschung diskutiert und sowohl quantitative als auch qualitative Methoden vorgestellt und erprobt werden.
| 12234
HS - Pädagogische Professionalität (Seminar im "Problem-based
Learning"-Format) Felicitas Thiel |
Fr
wö. 14.15-17.15
JK 25/132 (24.10.)
Ausgehend von einer sozialwissenschaftlichen Perspektive soll die spezifische
Handlungsgrammatik der durch ein Technologiedefizit gekennzeichneten professionellen
Arbeit herausgearbeitet werden. In einem weiteren Schritt steht die Frage
im Mittelpunkt, wie sich für verschiedene pädagogische Handlungsfelder
die pädagogische Kernkompetenz definieren lässt und welche Paradoxien
im Lehrerhandeln, in der Erwachsenenbildung und in der sozialpädagogischen
Arbeit jeweils eingelagert sind. Auf der Basis einer Einführungsphase
mit Vorträgen und Übungen wird das Seminar im didaktischen Setting
des "Problem-based Learning" stattfinden. Diese durch die neuere
Lehr-Lernforschung inspirierte Methode der Gestaltung einer Lernumgebung
verwendet Probleme als Anker für den Wissenserwerb und hat sich im
internationalen Hochschulbereich zunehmend etabliert. In kooperativen,
selbstgesteuerten Arbeitsformen und nach dem Modell des "7-Jump"
werden die Inhalte des Themengebietes "Pädagogische Professionalität"
bearbeitet.
HS: Bildungs- und Kulturreformbewegungen in Deutschland um 1900 (2.2.1.2)
Felicitas Thiel
Di. 12-14 Uhr KL 24/122d
Vor dem Hintergrund einer breiten Kulturkritik formierten sich in Deutschland um 1900 verschiedene soziale Bewegungen, in deren Krisendiagnosen sich Kultur-, Lebensreform und Bildungsmotive überlagerten. Einig waren sich die modernisierungskritischen Bewegungen hinsichtlich einer grundsätzlichen Reformbedürftigkeit der Gesellschaft des Kaiserreichs, die – so die Hoffnung – die Erziehung des neuen Menschen zwingend erforderlich mache.
Im Seminar sollen diese pädagogischen Erneuerungshoffnungen am Beispiel verschiedener Bewegungen herausgearbeitet werden.
Literatur zur Einführung: Kerbs, Diethart u.a. (Hg.): Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-1933. Wuppertal 1998
Forschungsseminar:
Modelle und Methoden erziehungswissenschaftlicher Evaluationsforschung
am Beispiel der Schulevaluation und der Evaluation von Medien (2.2.1.3.)
Felicitas
Thiel
Di: 18-21 Uhr (21.10.2003)
Dieses Forschungsseminar richtet sich an Studierende in höheren Semestern.
Im Zusammenhang mit Qualitätssicherungsmaßnahmen im Bildungssystem spielt Evaluation eine entscheidende Rolle. In verschiedenen Schulgesetzen etwa ist die Verpflichtung zu interner und externer Evaluation bereits verankert.
Am Beispiel von Evaluationsprojekten aus den Bereichen Schule und Medien sollen Voraussetzungen und Modelle der Evaluationsforschung diskutiert und sowohl quantitative als auch qualitative Methoden vorgestellt und erprobt werden.
| 12012PS
- Selbstgesteuertes Lernen Felicitas Thiel |
Fr
wö. 14.00-18.00 25.04.-27.06.2003
K 23/11 (25.04)
Mit dem Begriff des selbstgesteuerten Lernens verbindet sich ein viel
diskutierter Perspektivenwechsel in der Lehr-Lernforschung, nach dem Lernen
vor allem als Prozess der aktiven Wissenskonstruktion der Lernenden verstanden
wird. Auf der Basis des vorhandenen fachspezifischen Vorwissens erfolgt
der Aufbau von Wissen und Können im komplexen Zusammenspiel von motivationalen
und kognitiven Komponenten.
In der Didaktik wurden vor der Hintergrund der Theorien selbstgesteuerten
Lernens inzwischen unterschiedliche Modelle zur Gestaltung von Lernumgebungen
entwickelt. Problem-based learning ist ein Ansatz, der vor allem an Universitäten
in den letzten Jahren Verbreitung findet.
In diesem Seminar wird beides zusammengebunden: Inhalt sind die motivationalen
und kognitiven Voraussetzungen selbstgesteuerten Lernens. Das methodische
Design des Seminars orientiert sich am Problem-based-learning (PBL). Die
Studierenden werden hier mit "Problemen" konfrontiert, die als
Lernanker für die Aneignung von Wissen zum selbstgesteuerten Lernen
fungieren.
Die Veranstaltung wird vierstündig durchgeführt, die Zahl der
Sitzungen verkürzt sich entsprechend auf acht.
Die regelmäßige Anwesenheit und die aktive Mitarbeit sind unabdingbare
Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar!!
Interessenten sollten sich bitte im Sekretariat des Arbeitsbereichs Philosophie
der Erziehung (Frau Bösche, Tel. 83855295) anmelden.
12214 HS - Bewegungsprotest, Risikokommunikation und pädagogische Interventionen
Felicitas Thiel
Di wö. 12.00-14.00
JK 25/138 (15.04)
Die neuere systemtheoretisch inspirierte Bewegungsforschung sieht eine
spezifische Funktion neuer sozialer Bewegungen in der Kommunikation von
Risiken, die ausdifferenzierte Funktionssysteme zwar (mit-)produzieren,
aufgrund ihrer operationalen Schließung selbst aber gar nicht wahrzunehmen
imstande sind.
Diese Bewegungen sind oft begleitet von pädagogischen Initiativen
oder Reformprojekten. Vor dem Hintergrund theoretischer, historischer
und empirischer Studien zu neuen sozialen Bewegungen sollen Motive und
Auslöser für die Pädagogisierung von Bewegungsprotest rekonstruiert
werden.
WS 2002/03
12007 PS
- Selbstgesteuertes Lernen als
Gegenstand
der Lehr-Lern-Forschung (Seminar im "Problem-based learning-Format)
Fr, wö. 14.00-17.45
K 23/27 (25.10)
Seminarleitung:
Dr. Felicitas Thiel:
Tel. Di/Fr: 83875423,
Tel. priv.: 78913875
fthiel@zedat.fu-berlin.de
Diemut Ophardt:
Tel. Di/Fr.: 83875418,
Tel. priv.: 3136870
ophardt@zedat.fu-berlin.de
Mit
dem Begriff des selbstgesteuerten Lernens verbindet sich ein viel diskutierter
Perspektivwechsel in der Lehr-Lern-Forschung. Lernen ist demnach vor allem
als Prozess der aktiven, von außen nur bedingt steuerbaren Wissenskonstruktion
der Lernenden zu verstehen, bei dem auf der Basis des vorhandenen fachspezifischen
Vorwissens ein komplexes Zusammenspiel von motivationalen und kognitiven
Komponenten dem Aufbau von Wissen zugrunde liegt.
Ausgehend von diesen Annahmen wurden in der pädagogischen Praxis
inzwischen verschiedene didaktische Modelle zur Gestaltung von Lernumgebungen
entwickelt und erprobt. Problem-based learning (PBL) ist ein Ansatz, der
vor allem im Hochschulbereich seit einigen Jahren zunehmend Verbreitung
findet: Die Lernenden arbeiten gemeinsam und im Selbststudium an speziell
für den Gegenstandsbereich und das Seminar zugeschnittenen "Problemen"
nach einem bestimmten didaktischen Modell ("7-Jump"). Das vorliegende
Seminar fokussiert diese beiden Schwerpunkte: Zum einen wird in die aktuelle
Debatte um den Begriff des selbstgesteuerten Lernens eingeführt,
und es werden zwei Komponenten (Lernmotivation und Lernstrategien) vorgestellt.
Zum anderen werden die SeminarteilnehmerInnen mit praktischen Übungen
auf die Methode des problem-based learning vorbereitet, so dass insgesamt
vier Themen im klassischen PBL-Format erarbeitet werden. Insbesondere
für diesen Seminarteil sind aktive Mitarbeit, verbindliche Vorbereitung
und Teilnahme der TeilnehmerInnen eine wichtige Voraussetzung!
[Werdegang]
[Schwerpunkte] [Lehre]
[Publikationen] [Arbeitsbereich]
[Webteam]
© Arbeitsbereich Philosophie der Erziehung,
FU Berlin, Stand:
24.03.2006