...1605...1607...
Der Himmel über "Die vier Jahreszeiten" von Joos de Momper
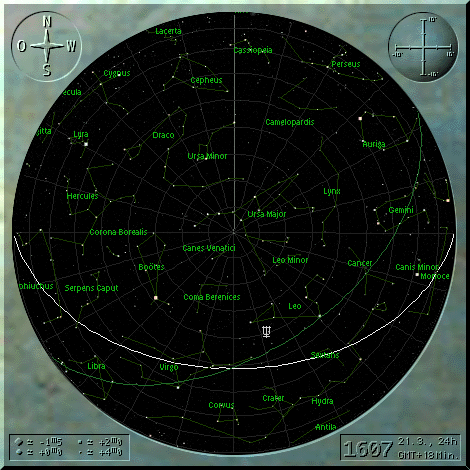
Frühling -
Sommer -
Herbst -
Winter
Illustrationen: StarryNight 2.1 & -- jd --
- 12.10.1605
- Totale Sonnenfinsternis, sichtbar in Mitteleuropa (siehe unten)
- 1606
- Konstruktion des Galileischen Thermometers
- Erscheinungsjahr der Abhandlung "De Stella Nova in Pede Serpentarii"
Johannes Keplers über die dreifache Konjunktion und die Supernova von 1604
- 28.9.1607
- Perigaeum des großen Kometen von 1607 (siehe unten)
- 26.10.1607
- Perihel des großen Kometen von 1607 (siehe unten)
- 1608
- Erfindung des Teleskops durch H. Lippershey (siehe auch ...1610...1613...)
Antwerpen, 12. Oktober 1605, 13 Uhr 12 Ortszeit
|
Sonnen- und Mondfinsternisse waren zu Beginn des 17. Jahrhunderts
nicht mehr so geheimnisvoll wie noch im Altertum und zum Teil auch
im Mittelalter.
Sie waren berechenbar und damit erklärbar geworden. Es war bekannt,
daß sich bei einer Sonnenfinsternis die Mondscheibe vor die Sonne
schiebt und daß bei einer Mondfinsternis der Schatten der Erde
über die Mondscheibe wandert. Sonnenfinsternisse finden
immer bei Neumond und Mondfinsternisse nahe Vollmond statt.
Damit aus einer Neumondstellung eine Sonnenfinsternis wird, muß
der Mond an einer Position sein, wo die um rund fünf Grad
zur Ekliptik geneigte Mondbahn
die Ekliptik kreuzt bzw. schneidet. Ein solcher Schnittpunkt wird
auch Drachenpunkt genannt, wahrscheinlich weil in der
Chinesischen Mythologie bei einer Sonnenfinsternis ein Drache die Sonne
fressen würde. Dies war am 12. Oktober 1605 der Fall.
|
Die Finsternis begann
ca. 11 Uhr 55 und endete ca. 14 Uhr 28 lokaler Zeit.
Im obigen Bild ist die Mondbahn hellgrün und
die Ekliptik dunkelgrün eingezeichnet.
Es zeigt etwa die größte Bedeckung um 13 Uhr 12 gesehen von
Antwerpen aus. Die Sonne wurde maximal bis zu 80-90% bedeckt.
Nördlich von Barcelona
einige Minuten später war die Bedeckung dagegen total, so daß
für wenige Sekunden der Tag zur Nacht wurde.
Mittels Klick auf das obige Bild kann eine Sequenz aufgerufen werden, in
der der gesamte Verlauf der Sonnenfinsternis vom 12. Oktober 1605 gezeigt
wird (gesehen von Antwerpen aus unter der Annahme, daß an diesem Tag
keine Bewölkung herrschte).
Das untere Bild zeigt vom Mond aus einen Schnappschuß von der Erde
um 13 Uhr 15 Antwerpener Zeit mit der Totalitätszone der Sonnenfinsternis
(kleiner grüner Kreis) über den Pyrenäen.
|
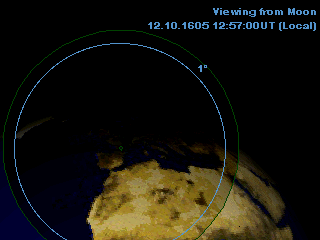 |
Mare Frigoris, 12. Oktober 1605, 12 Uhr 57 (GMT)
|
Nach Aristoteles waren Kometen wie Meteoritenschauer Erscheinung
in der sublunaren Sphäre, also in der Erdatmosphäre oder
nahe darüber. Dies war bis ins 17. Jahrhundert hinein anerkannte
Theorie. Tycho Brahe hatte zwar die Meinung vertreten, daß
sich die Schweifsterne außerhalb der Mondbahn bewegten.
Er konnte jedoch nicht erklären, was Kometen sind, wie sie zu
den Planeten stehen und wie ihre Bahnen verlaufen.
|
1607 erschien ein Komet, der mit großer Wahrscheinlichkeit auch der
Komet war, der später den Namen Halleyscher Komet tragen sollte, benannt
nach dem britischen Astronom Sir Edmund Halley (1656-1742), der ihn 1682
sah und anhand von Bahnberechnungen
voraussagte, daß er 1758 wiederkehren würde. Halley selbst
erlebte diese Wiederkehr nicht mehr.
|
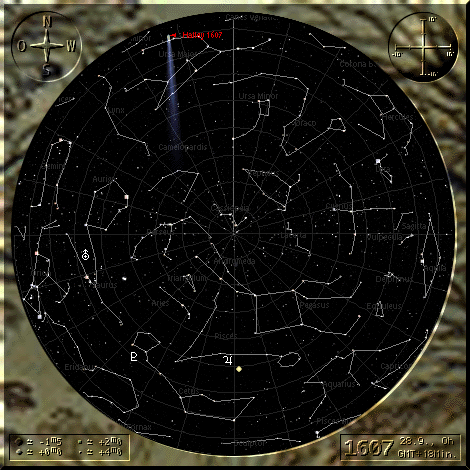
Der große Komet von 1607 am 28. September über Antwerpen
|
Der Aphel bzw. der sonnenfernste Punkt der Bahn des Kometen liegt hinter der
Neptunbahn (5,281 Mrd. Kilometer Abstand zur Sonne), während der Perihel bzw.
sonnennächste Punkt zwischen Venus- und Merkurbahn (87,8 Mio. Kilometer
Abstand zur Sonne) liegt. Die Bahn ist um 162 Grad
gegenüber der Ekliptik geneigt. Die Umlaufzeit des
Halleyschen Kometen beträgt etwa 76 Jahre.
|
An seinem entferntesten Punkt zur Sonne besitzt der Komet eine Geschwindigkeit
von 1 km/s, am sonnennächsten Punkt sind es etwa 60 km/s. Die
Gesetzmäßigkeit dieses Unterschieds
beschrieb Kepler zwei Jahre später im Rahmen der Analysen von
Brahes Marsbahndaten (vergl. ...1609... und
...1619...1620...).
|
Orbit des Halleyschen Kometen 1986
|
Mindestens dreißigmal wurden schon die
unterschiedlichen Auftritte des Kometen beobachtet, die älteste
Beobachtung datiert wahrscheinlich von 270 v.Chr.
Aufgrund seiner Bahn kommt der Komet immer wieder nahe an die Erde heran.
Eine der größten Annäherungen fand 837 n.Chr.
statt, bei der der Kometenkern bis auf 6 Mio. Kilometer bzw. bis auf das
15,5fache der Entfernung Erde-Mond herankam. Der Kometenschweif erstreckte
sich bei diesem Rendezvous über die Hälfte des Himmels.
Der Komet von 1066 auf dem Bayeux-Teppich
Kometen waren von je her Unglücksboten. 1066 erschien der Halleysche Komet
vor der Schlacht des englischen Königs Harolds II. gegen den normannischen
Invasor William der Eroberer.
|
Der gerade erst eingesetzte König verlor die Schlacht
mit der Folge einer fast hundertjährigen
normannischen Herrschaft über England. Das Erscheinen
des Kometen wurde auf dem Bayeux-Teppich festgehalten.
1607 näherte sich der Komet auf 37,5 Mio. Kilometer
bzw. 97 mal der Abstand Erde-Mond am
28. September. Um diesen Tag herum war der Komet zirkumpolar unterhalb des
Großen Bären (siehe oben).
Die Länge des Kometenschweifs betrug etwa 40 bis 50 Bogengrad.
Den minimalen Abstand zur Sonne erreichte Halley am 26. Oktober mit
87,3 Mio. Kilometer. Für fast zwei Monate bildete
der Schweifstern eine deutliche Erscheinung am Himmel. Mit einem Klick auf
die obige Himmelskarte vom 28.9.1607 wird eine Bildsequenz (in Schritten
von 1434 Minuten bzw. 23 Stunden und 54 Minuten)
dieser Erscheinung von Anfang September bis Anfang November aufgerufen.
(Die Bahndaten des Kometen von 1607 sind Voyager II 2.0 entnommen.)
Ähnlich beeindruckend wie 837 war das Auftreten des Halleyschen Kometen
1910, wo zuerst angenommen wurde, daß er auf die Erde stürzen
würde, und als dies ausgeschlossen war, daß die Erde durch den
Kometenschweif mit Cyangasen fliegen würde. Keines dieser Ereignisse
trat ein.
Die letzte Erscheinung des Halleyschen Kometen im 20. Jahrhundert 1986
war durch ungünstige Bahnverhältnisse auf der nördlichen
Hemisphäre nicht besonders eindrucksvoll. Dafür erreichte die
europäische Raumsonde Giotto am 14.3.1986 eine Annäherung von
rund 600 Kilometer an den Kern und konnte die ersten Bilder vom
"Innenleben" eines Kometen zur Erde funken.
|
 |
Zeichnung der Kernregion vom Halleyschen Kometen 1986
|
In der 2. Hälfte des Jahres 2061 wird der große Komet
von 1607 wieder auf der Erde zu sehen sein, sofern nicht durch
Klimakollaps die Oberfläche
|
durch eine undurchdringliche Wolkenschicht wie auf der Venus
eingehüllt ist oder eine andere menschengemachte Katastrophe
alle möglichen Zeugen auslöscht.
|
 Zum "Himmels-Index",
Zum "Himmels-Index",
 zum Jahr ...1603... (Zum Sternenhimmel und Bayers "Uranometria" 1603),
zum Jahr ...1603... (Zum Sternenhimmel und Bayers "Uranometria" 1603),
 zum Jahr ...1609... (Die Mondfinsternis von 1609 und Keplers "Astronomia nova"),
zum Jahr ...1609... (Die Mondfinsternis von 1609 und Keplers "Astronomia nova"),
 zum Jahr ...1610...1613... (Galileis Sidereus Nuncius und die Jupiter-Neptun-Konjunktion von 1613),
zum Jahr ...1610...1613... (Galileis Sidereus Nuncius und die Jupiter-Neptun-Konjunktion von 1613),
 zum Jahr ...1614...1618... (Die Sonnen- und Mondfinsternis von 1614 und 1616 und die Kometen von 1618),
zum Jahr ...1614...1618... (Die Sonnen- und Mondfinsternis von 1614 und 1616 und die Kometen von 1618),
 zum Jahr ...1619...1620... (Keplers "Harmonices Mundi" und die Mondfinsternisse von 1620).
zum Jahr ...1619...1620... (Keplers "Harmonices Mundi" und die Mondfinsternisse von 1620).
-- jd --
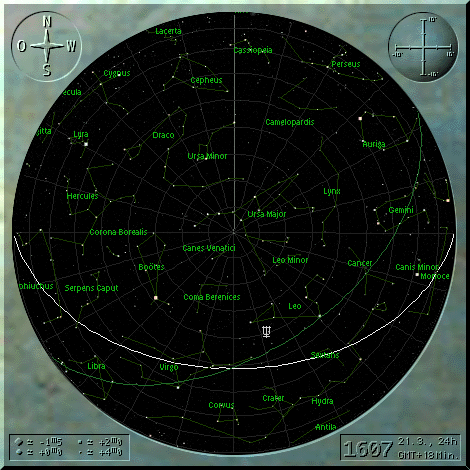
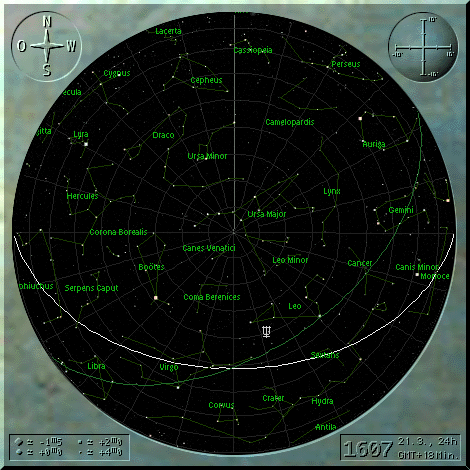
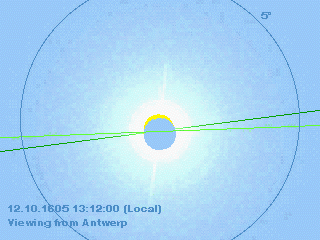
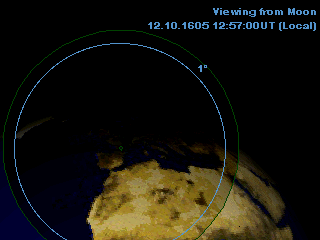
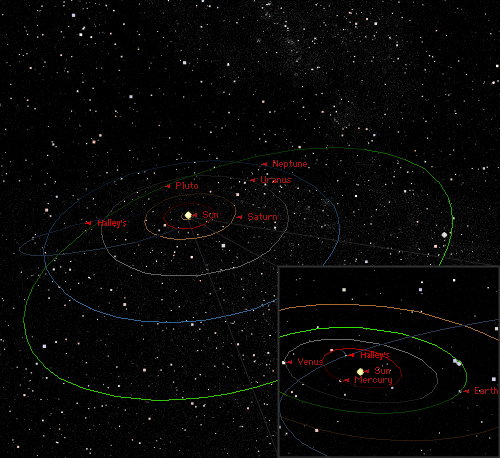

 Zum "Himmels-Index",
Zum "Himmels-Index", zum Jahr ...1603... (Zum Sternenhimmel und Bayers "Uranometria" 1603),
zum Jahr ...1603... (Zum Sternenhimmel und Bayers "Uranometria" 1603), zum Jahr ...1609... (Die Mondfinsternis von 1609 und Keplers "Astronomia nova"),
zum Jahr ...1609... (Die Mondfinsternis von 1609 und Keplers "Astronomia nova"), zum Jahr ...1610...1613... (Galileis Sidereus Nuncius und die Jupiter-Neptun-Konjunktion von 1613),
zum Jahr ...1610...1613... (Galileis Sidereus Nuncius und die Jupiter-Neptun-Konjunktion von 1613), zum Jahr ...1614...1618... (Die Sonnen- und Mondfinsternis von 1614 und 1616 und die Kometen von 1618),
zum Jahr ...1614...1618... (Die Sonnen- und Mondfinsternis von 1614 und 1616 und die Kometen von 1618), zum Jahr ...1619...1620... (Keplers "Harmonices Mundi" und die Mondfinsternisse von 1620).
zum Jahr ...1619...1620... (Keplers "Harmonices Mundi" und die Mondfinsternisse von 1620).