
Security check in der Forschungsgruppe Radiochemie des Instituts für Anorganische Chemie und Analytische Chemie der FU: Die Besucherin stellt sich auf eine Plattform und legt die Hände auf eine Metallfläche. Plötzlich ein schrilles Piepen. Es signalisiert: Rechter Fuß kontaminiert. Der Schrecken fährt in die übrigen Glieder. Tschernobyl mitten in Dahlem? Nichts ist unmöglich, doch der Mann im strahlend weißen Kittel gibt Entwarnung: "Dieses Gerät ist so empfindlich, daß es sogar die Strahlung mißt, die Sie von draußen hereinbringen." Der Rundgang mit Prof. Günter Marx kann beginnen. Er und seine Mitarbeiter erforschen hier im Labormaßstab, was bei der direkten Endlagerung radioaktiver Abfälle später einmal zum Problem werden könnte. Und ungeklärte Risiken gibt es noch genug. Was passiert zum Beispiel, wenn ein Behälter mit radioaktivem Müll im Salzbergwerk undicht wird und korrosive Salzlauge die Brennelemente angreift?
Vor manchen Laborräumen stehen kleine Hürden, gelb-schwarz gestreift, hier muß man Überschuhe und einen Kittel tragen, auch wenn die Versuche selbst in den großen Handschuhboxen unter Unterdruck stattfinden, damit die Wissenschaftler auf keinen Fall mit giftigen Substanzen wie Transuranen in Berührung kommen. Wenn die Stoffe nicht nur giftig, sondern noch dazu radioaktiv sind, sind die Versuchsaufbauten zusätzlich mit Bleiklötzen ummauert. Nach der Besichtigung unterziehen sich alle zwei Strahlenkontrollen. Das Dosimeter ist konstant geblieben. Die Strahlung, die die Besucherin aus dem Straßendreck mitgebracht hat, ist inzwischen nicht mehr meßbar. Das Gefährlichste sei hier sowieso die chemische Giftigkeit, erklärt Professor Marx. "Uran ist wie Quecksilber ein Nierengift, aber zum Glück ist in meiner Gruppe noch nie etwas passiert." Geniales Chaos darf sich hier keiner erlauben, die Bestimmungen sind streng.
Der in Kernkraftwerken anfallende Abfall besteht zu mehr als 90 Prozent aus Uranoxid und aus einer ganzen Reihe verschiedener Elemente, die unterschiedlich schnell zerfallen und dabei radioaktive Gammastrahlung und Teilchenstrahlung abgeben.
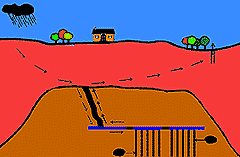
Endlager-GAU im Salzstock: Der Pollux-Behälter ist undicht geworden und das radioaktive Material kommt in Kontakt mit Salzlauge. Außerdem gelangt Oberflächenwasser durch Risse in die Einlagerungsorte und transportiert lösliche Reaktionsprodukte in die Biosphäre. Die Arbeitsgruppe von Prof. Günter Marx ist auf der Suche nach Fängersubstanzen, die diesen Transport von radioaktiven Stoffen verhindern.
Die abgebrannten Brennstäbe sind noch etwa 200¡ heiß und kühlen zunächst einige Jahre in speziell dafür eingerichteten Wasserbecken der Kernkraftwerke ab. Dabei zerfallen bereits einige der kurzlebigen radioaktiven Bestandteile zu stabilen Elementen. Nach dem ersten Abkühlen kommt der Abfall in Spezialbehälter, wird oberirdisch viele Jahre zwischengelagert, um schließlich in den Tiefen der Erde seine letzte Ruhestätte zu finden. Jahrmillionen müssen die Geister, die der Mensch rief, in ihrem Grab eingeschlossen bleiben, denn das todbringende Teufelszeug enthält auch kleine Mengen sehr langlebiger Elemente. Mindestens zehn Halbwertszeiten lang dürfen die Abfälle nicht mit der Biosphäre in Berührung kommen. Das berüchtigte Plutonium braucht etwa 20.000 Jahre, um zur Hälfte zu zerfallen; noch problematischer ist Neptunium mit einer Halbwertszeit von 2 Millionen Jahren.
Zwischen dem radioaktiven Abfall und der Biosphäre baut man mehrere Barrieren auf: Der Pollux-Behälter besteht aus einer dicken Betonschicht, die mit Bor angereichert ist und bereits einen Großteil der Strahlung abfängt. Die Außenwand des Pollux ist aus Edelstahl und etwa 35 cm dick. Dieser Behälter schirmt die Strahlung des Abfalls fast vollständig ab. Ferngesteuerte Fahrzeuge versenken die Pollux-Behälter in den 500-1.200 Meter tiefen Bohrlöchern in Salzstöcken, Granit, Tonschichten oder Tuffgestein. Die Bohrlöcher werden mit Salzgrus, Gestein oder Versatzstoffen aufgefüllt und fest versiegelt.
Für die Endlagerung der deutschen Abfälle kommen in erster Linie Salzstöcke in Frage. Sie eignen sich besonders gut: Weil Salz plastisch ist, schließen sich eventuell auftretende Risse und Spalten höchstwahrscheinlich wieder von selbst. Außerdem sind Salzstöcke extrem trocken. Daher ist das Risiko geringer, daß die radioaktiven Abfälle mit Wasser in Kontakt kommen, gelöst werden und ins Grundwasser gelangen. In den Salzstöcken gibt es jedoch innere Hohlräume, die mit einer extrem konzentrierten Salzlauge gefüllt sind ö ein Relikt aus erdgeschichtlicher Zeit, als Salzmeere austrockneten. Es ist nicht auszuschließen, daß Lauge aus einer dieser Blasen durch einen kleinen, spontan gebildeten Riß in das Endlager gelangt und dort Korrosionsprozesse auslöst. Was passiert, wenn der Edelstahlmantel des Behälters durchrostet und das radioaktive Material mit der konzentrierten Salzlauge in Berührung kommt? Karlsruher Physiker vermuten, daß die Lauge 500 bis 2000 Jahre braucht, um ein Loch in die Wand zu fressen. Welche Produkte entstehen aus der Mischung von Urandioxid, Schwermetallen und den korrosiven Bestandteilen der Salzlauge? Können sie gelöst und damit ins Grundwasser transportiert werden oder bleiben sie als fester Niederschlag im Salzstock?

Reise ins Innere der Erde: In einem "Kübel" fahren Bergleute und Wissenschaftler den Gorlebener Salzstock hinunter. Ob er sich als Endlager für hochradioaktive Abfälle eignet, ist noch nicht geklärt.
Um das herauszufinden, beobachten die Chemiker der Gruppe Marx die Reaktion von kleinen Mengen Urandioxid mit Salzlauge im Reagenzglas und trennen danach die wasserunlöslichen Niederschläge ab. Die wasserlöslichen Produkte analysieren sie mit der Radioisotopenmethode: Jedes Element, das in den wasserlöslichen Endprodukten enthalten ist, gibt eine bestimmte Wellenlänge von radioaktiver Gammastrahlung ab, an der Chemiker es identifizieren können; das Produkt hinterläßt sozusagen einen unsichtbaren Fingerabdruck.
Eine indirekte Methode ist die sogenannte Impedanzspektroskopie. Man taucht kleine Stäbe (Elektroden) aus Urandioxid in Salzlauge und legt eine Wechselspannung an. Die elektrische Leitfähigkeit und die Polarisation des Materials hängen davon ab, ob die Oberfläche des Urandioxidstabs mit der Lauge reagiert oder ob sich eine Deckschicht bildet, die das Urandioxid vor weiterer Korrosion schützt. So kann man während der Korrosionsreaktion "in situ" beobachten, was geschieht. Der Vorteil der indirekten Methode liegt auf der Hand. Es ist ungefährlicher, Widerstandsmessungen an nicht radioaktiven Urandioxidstäben zu machen, als die Reaktionen mit radioaktiven Elementen zu untersuchen. Dennoch braucht man zur Interpretation der Ergebnisse natürlich das Wissen aus direkten Beobachtungen.
Doch auch damit geben sich Prof. Marx und seine Gruppe nicht zufrieden. Sie malen das Katastrophenszenario weiter aus: Durch eine unglückliche Verkettung von weiteren Ereignissen kommt es zum Endlager-GAU. Der Behälter ist undicht, und Salzlauge strömt ins Bohrloch. Nun dringt durch einen weiteren Zufall Wasser in die Lagerstätte ein, die Reaktionsprodukte lösen sich und werden mit dem Wasser allmählich in obere Gesteinsschichten getragen, bis sie mit dem Grundwasser in Kontakt kommen. Ein Eingriff von außen ist unmöglich.
Marx und seine Gruppe überlegen daher, wie man diesem Fall vorbauen kann. Sie experimentieren zur Zeit mit Hydroxylapatit, einer anorganischen Verbindung aus Calcium und Phosphat, die auch im menschlichen Körper in Knochen und Zähnen vorkommt. Weil der Stoff mit Schwermetallen zu festen Niederschlägen reagiert, wird er zum Beispiel zur Abwasserreinigung eingesetzt. Noch liegen keine abschließenden Ergebnisse vor, doch die Spur scheint vielversprechend zu sein. Dr. Rüdiger Gauglitz, einem Mitarbeiter von Professor Marx, gelang jetzt der Nachweis, daß Hydroxylapatit auch Uranverbindungen in schwerlösliche Phosphatverbindungen verwandeln kann. Hydroxylapatit könnte als sogenannte Fängersubstanz dem Schüttmaterial beigegeben werden, mit dem das Bohrloch verschlossen wird. Der entweichende radioaktive Cocktail würde mit der Fängersubstanz reagieren, bevor er ins Grundwasser gelangen kann. Damit könnte Hydroxylapatit als Puffersubstanz im Bohrloch wie eine weitere Barriere zwischen dem radioaktiven Abfall und der Biosphäre wirken.

Prof. Marx, der Herr der Transurane, in seinem radiochemischen Labor vor einer Handschuhbox.
Seit mehr als dreißig Jahren nutzt Deutschland die Kernkraft zur Stromerzeugung. Inzwischen sind 19 Kernkraftwerke in Betrieb und decken etwa ein Drittel des gesamten Strombedarfs. Bis heute sind in deutschen Kernkraftwerken mehr als 6.000 Tonnen radioaktiven Abfalls entstanden, und selbst bei einem allmählichen Ausstieg aus der Atomenergie würde dieser Berg zunächst noch weiter wachsen. Die erste Endlagerung ist zwar erst für das Jahr 2008 anvisiert und kann auch noch weiter hinausgeschoben werden, aber zur Zeit untersuchen in Deutschland nur sechs Arbeitsgruppen, wie man die Endlagerung sicherer machen kann. "Die Meinungen über Atomkraft sind durchaus gemischt in meiner Gruppe", verrät Marx zum Abschied, "aber niemand verschließt die Augen vor dem Müllproblem. Das ist schließlich da, und wir müssen weiter an der Sicherheit der Endlagerung arbeiten."
Antonia Rötger
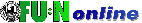 -Startseite
-Startseite