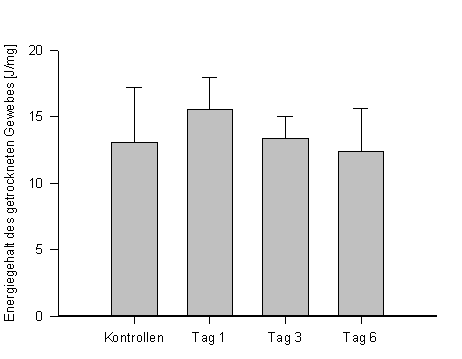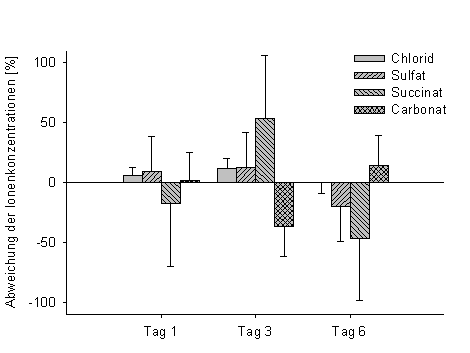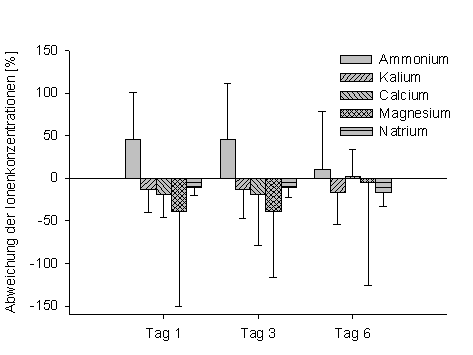Ergebnisse der 2. Woche:
Vorbemerkung: Zunächst werden wir die Vorgehensweise bei unserer Auswertung erläutern um spätere Verständnisschwierigkeiten zu vermeiden.
Als wir uns über unsere Ergebnisse und mögliche Auswertungen nachdachten fiel uns ein schwerwiegender Fehler im Versuchsplan auf. Eigentlich war es gedacht gewesen jeweils an dem Tag, an dem eine der Hungergruppen präpariert werden sollten auch eine Gruppe Kontrolltiere zu präparieren, da diese dann gleichen Präparations- und Messbedingungen unterliegen würden. Dieser Gedanke war auch in erster Linie nicht falsch. Es wurde aber völlig außen vorgelassen, dass evtl. in der gleichen Menge Futter an den verschiedenen Tagen unterschiedliche Mengen an den untersuchten Ionen und Nährstoffen enthalten waren. Denn bspw. die Tiere, die bereits 6 Tage im Hungerbecken zugebracht haben hatten am Tag ihrer Abnahme aus dem Futterbecken ein anderes Näherstofflevel als die zugehörigen Kontrolltiere am Tag ihrer Präparation. Diese hatten ab dem Tag, an dem sie noch mit den Hungertieren auf einem Nährstofflevel lagen (Tag 0, siehe Zeitskala am Beginn), 6 Tage lang Futter bekommen, welches keineswegs die gleiche Nährstoffmenge enthielt wie das zuvor verabreichte Futter wie eigentlich angenommen. Somit wurde das Nährstofflevel unkalkulierbar verändert und war damit nicht mehr mit den Hungertieren vergleichbar, da es nicht mehr dem gleichen Level entsprach, von dem die Hungertiere "herunter gehungert" hatten. Weiterhin könnten sich andere Faktoren (Wassertemperatur, NH3-Konzentration, etc.) auf das Fressverhalten der Schnecken oder direkt auf die Ionenkonzentrationen ausgewirkt haben.
Ein richtiger Ansatz wäre gewesen, die Kontrolltiere am gleichen Tag zu präparieren, an dem die Hungertiere aus dem Futterbecken ins Hungerbecken überführt worden sind. Nur dann kann man die Werte der Kontrolltiere mit den Werten der Hungertiere vergleichen und sie als vollen Fütterungszustand der Hungertiere am Tag 0 annehmen. Ersichtlich wurde diese Problematik schon bereits beim Vergleich der Kontrolltiere untereinander, von deren Werten man erwartet hätte, dass sie sich bei gleich starker Futtermenge nicht signifikant voneinander unterscheiden. Dies traf aber für viele Ionen nicht zu, d.h. die Konzentration bestimmter Ionen veränderte sich von einem Tag der Fütterung zum anderen (Kontrollgruppen wurden mit einem Tag Unterschied präpariert) so derartig, dass selbst die Kontrollgruppen sich signifikant von einander unterschieden. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden sämtliche Kontrolltiere für jede Ionenmessung und für die Messung der Energiegehalte zu einer Kontrollgruppe zusammenzufassen, um wenigstens einen ungefähren Durchschnittswert für eine vollständige Fütterungssituation mit den jeweiligen Hungergruppen vergleichen zu können. Dies führte natürlich bei Ionen, deren Kontrollen statistisch nicht zusammenfassbar sind zu sehr hohen Standardabweichungen. Da dies aber in unseren Augen die beste Möglichkeit ist, die Daten überhaupt auszuwerten, haben wir uns für diese Auswertungsmethode entschieden.
Eine Datentabelle mit den Merkmalen (Gewicht, Schalenmaße, Wassergehalt, etc.) der Versuchstiere befindet sich im Anhang.
Ergebnisse der Verbrennungskalorimetrie:
Die Verbrennung von einer spezifischen Menge Benzoesäure (Verbrennungswärme bekannt), ergab für Bombe 2 97,7 J/mV, für Bombe 5 84,7 J/mV und für Bombe 6 93,85 J/mV (die Nummerierung der Bomben ist eine institutsinterne Bezeichnung). Der mittlere Brennwert einer Gelatinekapsel wurde mit 24,1 J/mg bestimmt. Mit diesen Parametern wurde dann der Energiegehalt der Schneckengewebe ermittelt:
|
|
|
Abb. 10: Energiegehalt des Schneckengewebes in Abhängigkeit von der Hungerzeit. Die Kontrollgruppen (K1und K3,6) wurden zusammengefasst. nKontrolle = 12, nTag 1,3,6 = 6 (Datentabelle 7) |
Wie man in Abb. 10 sehen kann nimmt auf den ersten Blick der Energiegehalt des getrockneten Gewebes mit der Dauer des Hungers ab, was den Erwartungen entspricht. Der Mittelwert für den Energiegehalt der Kontrolltiere liegt minimal unter dem der Tiere, die 1 Tag gehungert haben, was nicht mit den Erwartungen übereinstimmt. Alle Werte schwanken aber innerhalb ihrer Fehlergrenzen gegenüber den Vergleichsgruppen. Im Vergleich untereinander und der Kontrollgruppe gegenüber unterscheiden sich die Messergebnisse aller Hungergruppen nicht signifikant. Alle Testwerte liegen bei einem p > 0,05.
Ergebnisse der Kapillarelektrophorese
Die kapillarelektrophoretische Bestimmung der Ionenkonzentrationen lieferte Ergebnisse mit z.T. extremen Abweichungen innerhalb der Versuchsgruppen.
|
|
|
Abb. 11: Veränderungen der Anionenkonzentrationen in der Hämolymphe von Limnaea stagnalis in Abhängigkeit von der Hungerdauer. Dargestellt ist die prozentuale Veränderung nach 1, 3 und 6 Tagen Hunger (n = 6) gegenüber den nichthungernden Kontrolltieren (n = 12). (Datentabelle 8) |
Gegenüber der Kontrolle steigt die Chloridkonzentration bis zum 3. Hungertag an, was der Erwartung entspricht. Die Werte sind jedoch mit 46,19 mmol/l erst ab dem dritten Hungertag gegenüber der Kontrolle 41,29 mmol/l signifikant. Am 6. Hungertag liegt die Chloridkonzentration jedoch wieder im Bereich der Kontrolle, was einer Abnahme von über 10% vom 3. zum 6. Hungertag entspricht. Die Standardabweichung ist hier am höchsten mit ca. 8%.
Bei der Sulfatkonzentration zeigt der erste Anschein eine Abnahme der Konzentration durch den Hunger von 1,19 mmol/l auf 1,13 mmol/l. Statistisch unterscheiden sich die Werte nicht voneinander. Die hohe Standardabweichung der Kontrollwerte lässt weitere Diskussionen zu.
Bezüglich der Laktatkonzentration (nicht abgebildet) ist auffällig, dass am 1. und 3. Hungertag gar kein Laktat in der Hämolymphe enthalten ist. Die Werte von der Kontrolle und dem 6. Hungertag sind jedoch auch sehr gering zwischen 0,1 und 0,6 mmol/l. Alles in allem kann man die Kontrollen, die null Tagen Hunger entsprechen sowie den 1. und 3. Hungertag statistisch nicht voneinander unterscheiden, sie sind nicht signifikant verschieden. Erst ab dem 6. Hungertag kann man eine signifikant erhöhte Laktatkonzentration messen.
Beim Carbonat sind bis auf den Wert des 3. Hungertages alle Werte statistisch nicht signifikant unterschiedlich und bewegen sich im Bereich von 24,12 und 27,47 mmol/l. Einzige Ausnahme ist der Konzentrationswert der Hämolymphe nach 3 Tagen Hunger, der sich mit 15,19 mmol/l signifikant von den anderen Werten unterscheidet, was einer Abnahme und wieder Zunahme von ca. 40% entspricht.
Die Succinatkonzentrationen sind im Allgemeinen recht gering, unter 1 mmol/l. Mit Ausnahme des Wertes für den 3. Hungertag kann man anhand der Abbildung eine fallende Tendenz der Succinatkonzentration verzeichnen. Dieser Abfall ist jedoch nicht statistisch signifikant. Der Konzentrationswert von Succinat nach 3 Tagen Hunger ist signifikant höher als alle anderen Werte.
|
|
|
Abb. 12: Veränderungen der Kationenkonzentrationen in der Hämolymphe von Limnaea stagnalis in Abhängigkeit von der Hungerdauer. Dargestellt ist die prozentuale Veränderung nach 1, 3 und 6 Tagen Hunger (n = 6) gegenüber den nichthungernden Kontrolltieren (n = 12). (Datentabelle 9) |
Anhand von Abb. 12 erkennt man, dass Ammonium generell in relativ geringen Konzentrationen in der Hämolymphe vorkommt, nämlich unter 1 mmol/l. Die Hungertage ergeben keine eindeutig signifikanten Unterschiede in der Konzentration. Lediglich der Wert nach 1 Tag Hunger zeigt einen bedingt siginifikanten Unterschied zur Kontrolle mit einem Testwert von 0,001 < p < 0,05. Somit kommt es durch den Hungereinfluß zu keiner messbaren Konzentrationsänderung der Ammoniumkonzentration der Schneckenhämolymphe. Weiterhin auffällig sind die hohen Standardabweichungen von 20 %-50 %
Die Magnesiumkonzentration schwankt abhängig von der Dauer des Hungers. Nach einem Hungertag ist die Magnesiumkonzentration bereits um 40 % von 2,30 auf 1,39 mmol/l gesunken. Nach drei Tagen Hunger ist die Konzentration stark gestiegen um 152 % des Wertes vom 1. Hungertag auf 3,5 mmol/l. Nach 6 Hungertagen ist wieder nahezu der Kontrollwert erreicht, was zu diskutieren wäre. Statistisch lässt sich sagen, dass sich nur die Werte von 1 Tag Hunger und 3 Tage Hunger bedingt signifikant voneinander unterscheiden. Ansonsten schwanken die Werte nicht über ihre Fehlergrenzen hinaus, zeigen also keine signifikanten Unterschiede. Somit führt der Hunger zu keinen messbaren Veränderungen in der Magnesiumkonzentration der Hämolymphe.
Die Natiumionen machen mit ihrem Gegenion dem Chlorid den weitaus größten Ionenanteil an der Schneckenhämolymphe mit über 63 mmol/l im normalen Fütterungszustand aus. Der erste Anschein deutet darauf hin , dass sich die Ionenkonzentration durch den Hunger kaum ändert. Durch die hohen Konzentrationen machen sich in der graphischen Darstellung geringe Schwankungen kaum bemerkbar.
Beim Kalium fällt zunächst die extrem hohe Standardabweichung des Kontrollwertes auf, der aus der Zusammenlegung der 2 Kontrollgruppen, die sehr verschieden waren, herrührt. Ansonsten sind die in der Graphik sichtbaren Schwankungen der Konzentration nicht signifikant. Das heißt die Hungerbedingungen bewirken keine messbare Änderung der Kaliumkonzentration in der Schneckenhämolymphe. Die Werte liegen zwischen 2 und 4 mmol/l.
Die Werte für Calcium liegen im Bereich von 3 bis 5 mmol/l. Die Konzentration sinkt stetig bis zum 3. Hungertag, was der Erwartung entspricht. Diese Konzentration erreicht auch mit dem 3. Hungertag ein signifikant niedrigeres Niveau gegenüber der Kontrolle. Nach 6 Tagen Hunger ist die Calciumionenkonzentration wieder erheblich gestiegen über den Wert der Kontrolle hinaus, was zu diskutieren wäre, da es nicht der Erwartung entspricht. Diese Zunahme der Calciumkonzentration vom 3. auf den 6. Hungertag ist sogar signifikant.