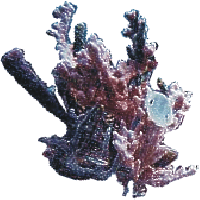
Über die Projektarbeit aus der Sicht einer Schülerin
Frau Maaßen berichte uns über das Projekt nach den Sommerferien. Sie suchte Schüler, die Computerkenntnisse und einen Internet- Zugang hatten. Steffi Meister und ich aus ihren Biologie Lk- Kurs nahmen daran teil, da wir mit dem Projekt direkt in Verbindung stehen, da wir erstens in unserem Kurs das Thema des Projekt durchnahmen und zweitens hatte Steffi einen Internet- Anschluss und so konnten wir die Unterrichtsergebnisse gleich verarbeiten. Die anderen beiden Jungen verfügen über große Kenntnisse über Computer, so konnten sie uns bei der Erstellung der notwendigen Homepage helfen.
In unseren Biologie- LK- Kurs fand das Projekt erst auf wenig Zustimmung. Wir hatten in dem Raum, der uns zur Verfügung stand, nicht so viele Computer, dass jeder Schüler an einem arbeiten kann, deshalb arbeiteten immer mindestens drei Leute an einem und das war sehr zeitaufwendig. Allerdings konnten wir die Computer in der Schule nicht immer benutzen und so mussten wir in ein nahegelegenes Internetcafe gehen. Aufgrund das sich nicht jeder Mitschüler mit dem Computer auskennt, dauerte es ziemlich lange bis sich jeder in die Materie eingefunden hatte. Die Texte, die zum Teil auf Englisch waren, waren für uns sehr schwer zu verstehen, da wir nicht die nötigen Voraussetzungen hatten. Außerdem schreiben wir bald eine Klausur und durch dieses Projekt ging uns sehr viel Zeit verloren. Steffi und ich hatten am Anfang auch Probleme, da wir noch nie an so einem Projekt teilgenommen hatten und zumindest ich noch nie eine Internetseite erstellt hatte. Wir verbrachten also sehr viel Zeit vor dem Computer, wo wir natürlich auch viel gelernt hatten. Das war das positive daran. Mit dem Projekt eröffnete sich eine ganz neue Perspektive im Unterricht. Wir hatten auch viel mehr Motivation, da wir nicht nur für eine Klausur lernten, sondern wir hatten ein Ziel, den Preis. Durch die eigene Erarbeitung der Texte haben wir nach meiner Meinung viel mehr über Ökologie gelernt. Es war sehr interessant und wir haben sehr viel über die Arbeit am Computer gelernt.
Ich fand dieses Projekt sehr zusprechend. Nicht nur das wir viel über die Arbeit am Computer gelernt haben, auch die Arbeit an sich, nicht in jedem Fach haben wir so eine Möglichkeit. Wir haben zum ersten Mal auf ein greifbares Ziel hingearbeitet und nicht immer nur für eine Klausur oder für das Abitur. Vielleicht war der Zeitpunkt etwas ungünstig, da wir jetzt auch ziemlich viel Stress mit den Abiturvorbereitungen haben.
Sarah Richter
Über dieses Projekt aus der Sicht der Lehrerin
Die erste Stunde (Jason-Projekt) war nicht besonders erfolgreich. Einige Schülerinnen und Schüler hatten keine Erfahrung mit dem Computer, einige hatten keine Erfahrung mit dem Internet, niemand hatte Erfahrung mit dem Lesen von englischen Texten ausserhalb des Englisch-Unterrichts. So kam es in dieser ersten Doppelstunde zu keinem fassbaren kognitiven Ergebnis und sie wurde mit ausgedrucktem Material wiederholt.
Aus der Sachinformation ergaben sich spontane Fragen: Ist die Quadrat-Methode zuverlässig? Warum haben wir unterschiedliche Zählergebnisse? Warum ist die Individuenzahl mancher Korallenarten im Lauf des Beobachtungszeitraums zurückgegangen, warum sind andere stärker vertreten? Damit war die Überleitung zu den abiotischen und biotischen Faktoren, die ein Ökosystem bestimmen, gegeben.
Wir begannen mit der Untersuchung der Rolle des Phosphats und benutzten eine Quelle aus dem Internet, die damals noch bestand, einige Zeit später aber aus dem Internet verschwunden war. Dies sehe ich als ein wesentliches Problem des internetgestützten Unterrichts an (s. auch Anmerkungen)
Fortgesetzt wurde die Sequenz mit der Bedeutung der anderen abiotischen Faktoren (ausser Phosphat), wieder einen WWW-Quelle in Englisch, die wir in einem nahen Internetcafé bearbeiteten, da unser Computerraum besetzt war - ein Problem, dem wir uns mehrfach gegenübersahen. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiteten in Kleingruppen jeweils einen Teilaspekt des Themas.
Am Ende dieser Doppelstunde wurde von einigen internetunerfahrenen Schülerinnen massiver Widerstand gegen dieses Projekt deutlich, der zu einer Beschwerde bei der Schulleitung führte. Die Schulleiterin unterstützt jedoch solche Projekte wie das vorliegende.
Der Protest beruhte im Wesentlichen darauf, dass diesen Schülerinnen der Fortschritt an quantitativ abfragbarem Wissen zu langsam vorkam: Die Texte mussten gelesen, die Arbeitsaufgaben selbständig gelöst werden; zusammen mit manchmal langen Ladezeiten und dem langsamen Lesetempo bei für Ungeübte schwierigen fremdsprachigen Texten war das Faktenlernen im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht tatsächlich verlangsamt. Mein Argument, dass der Umgang mit dem Internet zunehmend für Beruf und Studium Bedeutung erlange und dass acht Jahre Englischunterricht dazu da seien, um die Sprachkenntnisse auch anzuwenden, wurde mit dem Einwand abgewehrt, man sei kurz vor dem Abitur und wolle die dafür erforderlichen Kenntnisse so schnell wie möglich ansammeln. Es zeigte sich aber gegen Ende der Projektlaufzeit, dass der Mehraufwand an Zeit sich gelohnt hat: Die Wissbegier des Kurses wurde insgesamt grösser, die Fragehaltung verbesserte sich ebenso, wie die Fähigkeit zum problemlösenden Denken. Das Bedürfnis, Kenntnisse und Erkenntnisse zu konsumieren statt sie zu erwerben, hat sich merkbar abgeschwächt.
Die Wogen glätteten sich, als im nächsten Unterrichtsabschnitt mit Material aus einem B u c h (GREB et. al.) gearbeitet wurde und zusätzlich von der Lehrerin ausgewählte Einzelbilder aus dem WWW verwendet wurden. Dieses Vorgehen empfahl sich deshalb, weil das Zusammenwirken der biotischen und abiotischen Faktoren in diesem Buch am besten dargestellt ist und weil die zu den Einzelbilden gehörenden Texte nur zu einem geringen Teil in das Thema dieser Unterrichtssequenz passten.
Die allfällige Klausur hatte die Auswirkung abiotischer, biotischer und anthropogener Faktoren auf das Ökosystem zum Thema. Sie fiel gut aus - das glättete die Wogen noch mehr.
Die nächsten Sequenzen im Internet - Tarnung und Warnung, Räuber-Beute-Systeme - wurden mit Ruhe absolviert; auch zumindest eine der Zweiflerinnen begann, Interesse für das Internet zu entwickeln.
Schwierig war wieder die letzte Unterrichtseinheit, bei der es nicht nur um die geforderte Sachinformation ging, sondern sehr wesentlich auch um die selbständige Suche nach Information im Internet. Bisher waren die anzusteuernden Adressen von mir vorgegeben worden, nun sollten die Schülerinnen und Schüler exemplarisch den Umgang mit der Suchmaschine AltaVista üben. Es kam, was zu erwarten war: Der Kurs hatte Mühe, in der Vielfalt der von AltaVista nachgewiesenen Adressen die richtigen Informationen herauszufiltern; allein das Finden und Sichten von URL's dauerte eine Doppelstunde, zu einer echten Auswertung von Material konnte es in dieser Zeit nicht kommen. Es konnten aber die wesentlichsten Materialien gefunden werden; diese wurden von mir ausgedruckt und in der nächsten Doppelstunde vom Kurs im arbeitsteiligen Gruppenunterricht bearbeitet.
Vergleicht man die ursprünglich geplante Reihe mit der tatsächlich gehaltenen, fällt auf, dass die evolutionären Aspekte, deren Behandlung ursprünglich geplant war, fehlen und lediglich im Rahmen der intra- und interspezifischen Konkurrenzphänomene angerissen werden konnten. Da im Anschluss an diese Reihe gesondert evolutionsbiologische Sachverhalte besprochen werden, schien es im Rahmen der Themenauswahl logischer, in Bezug auf die Zeitökonomie des Unterrichts vertretbarer und im Sinne einer immanenten Wiederholung auch vom Lernerfolg her besser, diesen Temenkreis auf die Behandlung der Evolutionsbiologie zu verschieben.
Die Zeit dafür, dass Schülerinnen und Schüler eigene Webseiten erstellen, hat ebenfalls nicht gereicht. Rückblickend erscheint es auch eher angebracht, die eigene Webarbeit in den Rahmen einer Projektwoche zu stellen, ohne die Zwänge des laufenden Fachunterrichts.
Die Geschichte zum Einstieg in die Reihe (der Autor, S. Biedron, war Schüler des EBG, Abitur 1999) wurde nicht als der Altersstufe nicht angemessen empfunden.
Der Kontakt zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern geschah durch persönliches Gespräch, soweit sie am Elsa-Brändström-Gymnasium waren oder durch E-mail, so insbesondere auch die Zusammenarbeit mit Professor Leinfelder in München. Wir hätten uns diesen Kontakt etwas "persönlicher" - z. B. über einen Chat - gewünscht, aber leider lagen unsere Unterrichtszeiten so, dass Professor Leinfelder zu diesen Terminen entweder in einer Vorlesung oder in einer Sitzung sein musste.
Resumé:
|
|
|
|
|
| Christa Maaßen | weiter zu Start | Sitemap | Anmerkungen | Lernziele |