

Nein, das ist nicht das "richtige" Amerika, das alles wirkt eher unwirklich, virtuell: Schon die Auffahrtsallee, der Palm Drive - eine Hollywood-Kulisse. Dann der Campus selbst, in gleißend-südliche Sonne getaucht; spanisch geprägte Architektur: die sandsteinfarbenen Gebäude strahlen akademische Gediegenheit und Strenge aus, sind aber spielerisch durch schwungvolle Torbögen miteinander verbunden. So enstehen lauschige, ineinander verschachtelte Innenhöfe, aber auch großraümige Freiflächen - und eben jener spezifische Flair, der Sonntag für Sonntag Hochzeitspaare aus nah und fern dazu verleitet, sich in Stanford zum Fototermin einzufinden.
Schöner läßt sich Universität wahrlich nicht inszenieren - aber wohl auch nicht leben, denn ein Forschungs-Eldorado ist Stanford fraglos, und zugleich ein Paradies für Studenten, die an dieser Campus-Universität in Kleingruppen und in engem Kontakt mit Wissenschaftlern lernen und ihre eigenen Forschertalente entwickeln dürfen; ein Platz zudem, an dem sich Multikulturalismus leben läßt, das friedliche Nebeneinander von Ethnien und der Austausch zwischen den Kulturen. Und das alles eingebettet in eine Traumlandschaft im klimatisch begünstigten Kalifornien, umgeben von den High Tech-Parks des Silicon Valley. Die Zukunft ist so nah wie nirgendwo sonst auf der Welt.
Die jüngste Erfolgsbilanz der Universität kann sich sehen lassen. Zwei Beispiele: Jahr für Jahr reißen sich die amerikanischen Eliteuniversitäten um jene kleine Gruppe herausragender Köpfe unter den Studienanfängern, die vielversprechenden Forschernachwuchs verheißen. Mit einer großangelegten Kampagne hat man diesmal noch mehr von diesen hochtalentierten Studienbewerbern nach Stanford gelockt: Der Präsident - übrigens ein Deutscher, der Hamburger Verfassungsrechtler Gerhard Casper - hat jeden der 200 Top-Bewerber mit einem handsignierten Brief umworben und eingeladen, sich in Stanford umzusehen, und die Professoren waren angehalten, per Telefon und durch persönliche Beratung wankelmütige Bewerber anzulocken. Und all dieser Aufwand an einer Universität, deren Studienplätze ohnehin so begehrt sind, daß man ohne erstklassige Zeugnisse, Referenzen und Testergebnisse kaum eine Chance hat, eine Zulassung zu ergattern.
Von zwei der prominentesten Stanford-Absolventen, den ortsansässigen Computerunternehmern William Hewlett und David Packard, konnte Casper kürzlich einen Spendenscheck in Höhe von 77,4 Millionen Dollar für ein neues natur- und ingenieurwissenschaftliches Zentrum entgegennehmen. Ansonsten wirbt Stanford in der Forschung ohnehin längst mehr Drittmittel ein als die Harvard University, die traditionsreiche Rivalin an der Ostküste.
Zu den Erfolgsgeheimnissen von Universitäten wie Stanford zählt aber auch, daß Erfolge nach allen Regeln der PR-Kunst vermarktet werden. Ein wenig trügt also auch dieser schöne Schein. Zumindest plagen Stanford - wie alle amerikanischen Forschungsuniversitäten - Zukunftssorgen. Das Hauptproblem seien die Haushaltskürzungen, wie sie die republikanische Kongreßmehrheit in Washington, aber auch Präsident Clinton derzeit durchzusetzen suchten, sagt Casper. Sie schlügen voll auf diejenigen amerikanischen Hochschulen durch, an denen intensiv Grundlagenforschung betrieben werde. In der Tat haben sich auch die privaten Universitäten im Lauf der Jahrzehnte an einen üppigen Mittelzufluß aus Washington gewöhnt. 85 Prozent der Forschungsgelder - und damit mehr als ein Drittel des Gesamthaushalts von Stanford - kamen bisher von dort.
Roger Noll, ein Wirtschaftswissenschaftler in Stanford, sieht die Entwicklung im größeren Kontext. Die Universitäten hätten in den letzten Jahren auf schmerzliche Weise erfahren müßen, wie sehr sie Jahrzehnte lang Nutznießer des Kalten Krieges waren. Solange es darum ging, "die Macht des Bösen zu bekämpfen", sei es nicht schwer gewesen, Gelder für die Grundlagenforschung locker zu machen. Jetzt, wo es "nur noch" darum gehe, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der USA durch Forschung zu erhalten, sei die politische Dringlichkeit der Grundlagenforschung weniger leicht zu vermitteln.
Casper sieht zudem ein Zeitalter heraufziehen, in dem sich völlig neue Formen des Lernens durchsetzen werden. Damit könnte die Campus-Universität mit ihrem traditionellen Lehr- und Seminarbetrieb allmählich überflüssig werden. "Microsoft wird ein ernstzunehmender Wettbewerber der Universitäten werden", prognostiziert er.
Analoges ließe sich für mein Forschungsfeld, die Tageszeitungen prognostizieren: Auch für sie bahnt sich eine Zeitenwende an, sie werden sich ebenfalls neuen Wettbewerbern aus der Computer- und Telekommunikationsindustrie stellen müßen, und von diesem Umbruch ist im Umfeld des Silicon Valley bereits mehr zu spüren als anderswo. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, dann wird fast jeder US-Haushalt mit Computer und Modem ausgestattet sein - genauso selbstverständlich wie heute mit Auto oder Telefon. Schon jetzt kostet in Amerika ein PC kaum noch mehr als ein anständiger Farbfernseher.
Die großen amerikanischen Zeitungskonzerne haben, nicht zuletzt alarmiert durch drastisch zunehmenden Leserschwund, längst damit begonnen, sich auf den neuen Trend einzustellen. Immer mehr Zeitungen und Zeitschriften bieten ihre Informationen nicht mehr nur in Papierform, sondern auch elektronisch über das Internet, über Compuserve oder America Online an. Und man weiß in den Forschungsabteilungen der großen Zeitungskonzerne, z.B. bei Gannett und Knight Ridder, ganz genau, daß die neuen Technologien die herkömmliche Tageszeitung nicht nur in ihrer Existenz gefährden, sondern auch immense Gewinnchancen und Einsparmöglichkeiten verheißen: Nur zehn Prozent der Kosten verursacht bei herkömmlicher Produktionsweise in einem amerikanischen Zeitungsverlag die Redaktion, den Rest teilen sich Anzeigenabteilung, Technik und Vertrieb. Gelänge es, die Leser dazu zu bringen, von liebgewordenen Gewohnheiten zu lassen und sich den Teil der Zeitung, den sie tatsächlich lesen wollen, auf den Bildschirm zu holen oder am eigenen PC auszudrucken - dann entfallen für den Zeitungsverlag die beiden größten Kostenfaktoren: der Aufwand für Druck und Papier sowie die Zeitungszustellung. Microsoft and Cyberspace everywhere.
Um Medienzukunft und Zukunftsmedien ging es auch für die meisten der 19 Journalisten, an deren Weiterbildungs-Programm - den John S. Knight Fellowships - ich als Zaungast in Stanford während des Sommersemesters partizipieren durfte. Eine Gruppe handverlesener und berufserfahrener Journalisten erhält jeweils die Möglichkeit, als Stipendiaten ein akademisches Jahr in Stanford zu verbringen - und das zu tun, wozu im journalistischen Alltag wenig Zeit bleibt: Wissen aufzufrischen, zu vertiefen und hinzuzugewinnen, den Dingen auf den Grund zu gehen, Zusammenhängen nachzuspüren und, last not least, sich im Dialog mit Kollegen und Publizistikwissenschaftlern mit dem eigenen Metier auseinanderzusetzen.
Das Programm ist nicht nur eine der vielversprechendsten und unmittelbarsten Formen von Wissenschafts-Transfer, sondern zugleich ein höchst effektiver Beitrag zur Qualitätssicherung im Journalismus. Die Frage drängt sich auf, weshalb es
nicht auch in Mitteleuropa längst solch ein Angebot gibt. Wären nicht Berlin und die seit ihren Anfängen besonders international und transatlantisch orientierte FU geradezu prädestiniert, hier als Schrittmacher zu fungieren? Die herauf
kommende Informationsgesellschaft braucht mehr denn je qualifizierte Journalisten, die sich im Wissenschaftsbetrieb auskennen - und weder Stanford noch die FU Berlin sollten es allein Microsoft überlassen, mehr zu deren Qualifikation beizutragen.

Stephan Ruß-Mohl
Prof. Dr. Stephan Ruß-Mohl lehrt am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der FU Journalistische Praxis und Medienmanagement. Außerdem ist er wissenschaftlicher Leiter des Studiengangs Journalisten-Weiterbildung. Jüngste Buchveröffentlichung: "Der I-Faktor. Qualitätssicherung im amerikanischen Journalismus - Modell für Europa?" Edition Interfrom, Osnabrück/Zürich 1994

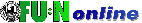 -Startseite
-Startseite