
Der 50. Jahrestag des Anschlags vom 20. Juli 1944 machte im vergangenen Jahr deutlich, in welchem Maße der Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Zeitraum von einigen Jahrzehnten zu einem grundlegenden Bestandteil des deutschen Geschichtsbildes geworden ist. Dies war das Ergebnis eines langen Prozesses, der durch vielfältige Faktoren beeinflußt worden ist und die Erforschung der Rezeption des deutschen Widerstands zu einem wichtigen Fallbeispiel moderner Geschichtspolitik macht: einer Politik mit der gedeuteten Vergangenheit und der inszenierten Erinnerung.
Unmittelbar nach dem Anschlag auf Hitler, gerade einmal neun Monate vor der bedingungslosen Kapitulation, waren dem deutschen "Führer" noch einmal viele Sympathien zugeflogen. Fast alle Berichte, die wir aus dem Jahre 1944 kennen, belegen, daß Hitler kaum jemals so populär war wie nach Stauffenbergs Bombenanschlag. Viele Deutsche sahen in Hitlers Überleben die "Vorsehung" am Werk oder beschworen Tugenden wie "Eidtreue", den "Anstand" der Deutschen gar oder die "Liebe zum Vaterland".
Auch nach dem Kriege hielt diese Stimmung noch lange an. Die Regimegegner wurden oftmals verächtlich gemacht, sogar bedroht, und selbst die engsten Angehörigen bekannten sich vielfach erst nach langer Zeit zu den Ermordeten. Die Deutschen entwickelten in ihrer Mehrheit lange Zeit kein positives Verhältnis zum Widerstand. Sie neigten eher dazu, ihr eigenes Fehlverhalten zu erklären und zu rechtfertigen, als die Möglichkeit des Widerspruchs und Widerstehens angesichts der Wirklichkeit des Völkermords oder des wahnwitzigen Krieges anzuerkennen. Pauschal formulierte Schuldbekenntnisse waren zwar durchaus denkbar, wie das Stuttgarter Schuldbekenntnis der Evangelischen Kirche zeigte, weniger allerdings die Auseinandersetzung mit persönlicher Schuld und Verantwortung. Und schon gar nicht verglich man sich mit denjenigen, die sich nicht willig angepaßt hatten.
Unter dem Eindruck der NS-Strafverfahren, vor allem des Auschwitz-Prozesses, wurde seit den späten fünfziger Jahren aber nicht mehr - wie noch vor zwanzig oder dreißig Jahren- über die Frage gestritten, ob Angehörige des Widerstands wirklich als Patrioten gelten könnten und nicht eher als Landesverräter zu bezeichnen seien. Daß der NS-Staat ein Unrechtsregime war, wurde nun weitgehend anerkannt. Strittig blieb nur die Frage, wie man sich als einzelner gegenüber einem Unrechtsstaat verhalten kann. Viele Deutsche beschworen den angeblichen Befehlsnotstand und wollten damit den Eindruck wecken, Auflehnung sei lebensbedrohend gewesen. Sie verwiesen auf den Widerstand, ohne sich klarzumachen, daß sich seine Anhänger nicht nur verweigert hatten, sondern aktiv das Regime bekämpft hatten. Heftige Kontroversen entzündeten sich weiterhin an der Frage, ob kommunistische Regimegegner des NS-Staates in das Gesamtbild der Regimegegnerschaft einzubeziehen seien. Viele sahen in ihnen nur Menschen, die eine Diktatur durch eine andere ersetzen wollten, als Parteigänger Stalins und Vorläufer des SED-Staates, wo man sich allmählich ebenfalls auf Regimegegner berief (vgl. dazu im Heft S. 29). Widerstand wurde nur dann moralisch gerechtfertigt, wenn er in die Tradition des freiheitlichen Verfassungsstaates gestellt werden konnte. Bald zeigten sich auch hier die Tücken der Argumentation, denn Regimegegnerschaft machte aus Offizieren noch keine freiheitlichen Demokraten im Sinne des Grundgesetzes.
Ohne Zweifel wirkte die Diffamierung des Widerstands durch die Nationalsozialisten sehr lange nach. So verneinten 1954 fast vierzig Prozent der Westdeutschen die Frage, ob Emigranten nach ihrer Rückkehr ein hohes Regierungsamt bekleiden sollten. Noch schlechter waren aktive Widerstandskämpfer angesehen. Während ein Viertel der Deutschen sich vorstellen konnte, daß "Widerstandskämpfer, die in Deutschland selbst gegen Hitler gearbeitet hatten, wie zum Beispiel die Männer vom 20. Juli", ein hohes Regierungsamt bekleideten, lehnten sie Emigranten mehrheitlich ab. 39 Prozent waren der Meinung, Emigranten sollten kein hohes Regierungsamt bekleiden, 13 Prozent meinten, sie könnten überhaupt kein derartiges Amt haben.
Wenige Jahre später waren die Regimegegner aus dem Umkreis des 20. Juli allgemein akzeptiert worden. Man hielt sie nicht mehr für Verräter und lastete ihnen auch nicht mehr, wie noch in den fünfziger Jahren, die deutsche Niederlage an. Viele Bundeswehrkasernen trugen inzwischen die Namen von Offizieren, die den Umsturzversuch Stauffenbergs unterstützt hatten. In Berlin fand seit 1952 alljährlich eine zentrale Gedenkveranstaltung statt, wenige Jahre später auch in Bonn, die immer größere Aufmerksamkeit fand. Anthologien zum Widerstandsrecht entstanden, Sondermarken wurden herausgegeben, und störend war eigentlich nur, daß man in Ost und West an jeweils andere Regimegegner erinnerte. Im Westen beschworen viele Arbeiten sowohl die "Vollmacht" als auch den "Aufstand" des Gewissens, und im Osten feierte man Mitglieder der "Roten Kapelle" als "verdiente Kundschafter des Volkes". Die deutschen Gesellschaften verloren den Gesamtwiderstand aus dem Blick, sie suchten sich selbst im Widerstand zu verwurzeln und jeweils eigene Traditionslinien zu stiften. Eine Folge dieses partiellen Gedenkens war, so paradox es klingt, die immer breitere Anerkennung des Widerstands gegen den Nationalsozialismus.
Den Wandel der Überzeugungen zu erklären, fällt nicht leicht. Viele Faktoren überlagern sich. Zum einen erkannten viele, daß sich der Widerstand benutzen ließe, um die dem Ausland von Deutschen unterstellte Kollektivschuldthese zurückzuweisen. Das "andere Deutschland" sollte belegen, daß etwas an der These von Deutschland als "dem ersten von den Nationalsozialisten besetzten Land" dran war. Die Anerkennung des Widerstands ermöglichte vielleicht auch den vor allem in Wiedergutmachungsdebatten im Bundestag beschworenen Kompromiß zwischen Stalingradkämpfer und Regimegegner.
Die Würdigung des bürgerlichen Widerstands erlaubte weiterhin, auch dem in der DDR kämpferisch gepflegten Antifaschismus etwas entgegenzusetzen. So konnte deutlich gemacht werden, daß auch die Bundesrepublik sich vom NS-Staat absetzen wollte und den Anspruch erhob, nachnationalsozialistische Ordnung zu sein. Das Bekenntnis zum bürgerlichen und militärischen Widerstand löste aber nicht alle Probleme: Denn es war ganz unbestreitbar, daß viele Gegner des NS-Staates keineswegs die überzeugten Vertreter eines parlamentarischen und demokratischen Systems waren, als die sie in den Gedenkreden dargestellt wurden. Bald wurde deutlich, daß auch manche Regimegegner aus dem Umkreis des 20. Juli 1944 von Deutschlands Vormachtstellung träumten.
Dennoch war das Bekenntnis zum Widerstand für die Nachlebenden wichtig und mehr als ein erstarrtes Ritual inszenierter Erinnerung. Vor allem ermöglichten viele Bekenntnisse zum bürgerlichen Widerstand den Nachlebenden, ein wenig an der Regimegegnerschaft teilzuhaben. Manche der Regimegegner im Umkreis des 20. Juli hatten lange Zeit das Regime gestützt und mitgetragen, ehe sie Positionen überwinden konnten, die sie ursprünglich mit den Nationalsozialisten geteilt hatten. Diejenigen, die sich nun auf den Widerstand beriefen, mochten sich versichern, daß sie manche Erfahrungen mit den Regimegegnern gemeinsam hatten, und dies ließ dann auch vergessen, daß sie eines von jenen unterschied: die Entscheidung zur Tat. Dies erlaubte im Nachhinein auch jenen, die sich nicht konsequent gegen den Nationalsozialismus gestellt hatten, ein wenig am Widerstand zu partizipieren. Hinzu kam die Abgrenzung von der DDR.
Die so vorbereitete Wende setzte sich wenige Jahre später im Zusammmenhang mit der Wiedergutmachung und der deutschen Wiederbewaffnung fort.
Die Kluft, die zwischen der apathischen Hinnahme von Hitlers Verunglimpfungen der angeblich "ehrgeizzerfressenen kleinen verräterischen Clique" einiger Offiziere und der heutigen Würdigung des militärischen Widerstands liegt, wirft die Frage nach den Gründen und den Phasen der zunehmenden Anerkennung auf, die der Widerstand gegen den Nationalsozialismus seit 1945 gefunden hat. Sie liegen gewiß nicht in der realen historischen Bedeutung des Widerstands. Denn weil der Umsturz scheiterte, konnte kein Regimegegner den Untergang des Regimes beschleunigen, Einfluß auf den Zusammenbruch des Jahres 1945 nehmen oder die Neugestaltung der politischen Verhältnisse entscheidend beeinflussen. Politisch gesehen, handelt es sich beim deutschen Widerstand um ein geradezu unerhebliches historisches Ereignis. Bedeutsam wird er erst im Denken der Nachlebenden, die sich ein Bild von den Regimegegnern machen, sich an einzelne Menschen und Ereignisse erinnern, ihre Motive deuten und erst im Nachhinein zu einem wichtigen Ereignis der deutschen Geschichte werden lassen. Die macht einen neuen Mißbrauch des Widerstands deutlich: Immer berufen sich oppositionelle Gruppierungen auf ihn, um eigene politische Anliegen zu legitimieren. Deshalb meinte der verstorbene Regimegegner Axel von dem Bussche sarkastisch, in der Geschichte habe es drei hoffnungsvoll überladene Boote gegeben: die Arche Noah, denn alle Tieren hätten gewiß nicht hineingepaßt; die Mayflower, denn angesichts derjenigen, die sich als Nachfahren der ersten Einwanderer bezeichneten, hätte das Schiff schon beim Auslaufen sinken müssen. Schließlich das Boot des Widerstands.
Aber es kommt in der Geschichte nicht nur auf die Realität an, sondern auch darauf, was die Menschen für die Wirklichkeit halten. Die Wandlungen des Widerstandsbildes zeigen die fließenden Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Mehr noch: Nicht selten schafft die Fiktion erst die historische Realität.
Peter Steinbach


![[Inhalt]](../../images/old_stuff/up.gif)

Zurück zur 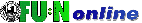 -
Startseite
-
Startseite