Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,
1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4
Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
[ Inhalt
Geldsyndrom ] [ Homepage
www.geldreform.de ]
[ Gästebuch
www.geldreform.de ]
27. Kapitel
Das Problem der Arbeitslosigkeit -
Entwicklungen und Veränderungen am Arbeitsmarkt
„Der Geldzins schraubt die Rentabili-
tätsschwelle der Unternehmen künstlich
hoch, erzeugt so einen zusätzlichen Ratio-
nalisierungsdruck, der sich arbeitsplatzver-
nichtend auswirkt.“
Kath. Familienverband der Erzdiözese Wien *
*In "Zur sozialethischen Problematik der gegenwärtigen Geld- und Kreditordnung“, 1990
Die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik seit 1950
Wenn man die Arbeitslosigkeit genauer analysieren will, muß
man zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Veränderungen un-
terscheiden. Das ist erforderlich, weil diese unterschiedlichen
Veränderungen auch unterschiedliche Ursachen haben.
Vergleichen kann man das mit den Veränderungen der Tempe-
ratur: Für die kurzfristigen Schwankungen ist der Tag-Nacht-
Wechsel verantwortlich, für die mittelfristigen die Großwetter-
lage und für die langfristigen sind es die Jahreszeiten. Und wie bei
der Temperatur nur die mittelfristigen Veränderungen nicht vor-
aussehbar sind, so ist das auch bei der Arbeitslosigkeit der Fall.
Sieht man sich die Entwicklung der Arbeitslosigkeit seit 1950 in
der folgenden Darstellung 65 einmal an, dann zeigt sich langfristig
ein tiefes, langes Tal. Wie ersichtlich, haben wir nach dem Krieg
mit einer ähnlich hohen Arbeitslosigkeit begonnen, wie wir sie
heute wieder haben. Einem raschen, etwa zehnjährigen Abbau
der Nachkriegsarbeitslosigkeit in der ersten Phase folgten zehn bis
zwölf Jahre Vollbeschäftigung in der zweiten. Doch dann, Anfang
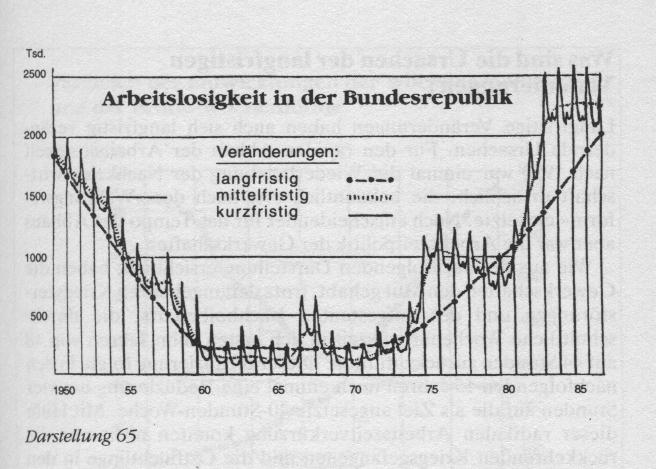
Darstellung 65
der 70er Jahre, ging es mit der Arbeitslosigkeit wieder „aufwärts“,
kaum weniger schnell als der vorherige Abbau.
Auf die Kurve dieser langfristigen Entwicklung satteln sich, wie
die Grafik weiter zeigt, immer höhere mittelfristige „Ausreißer“
auf. Diese wiederum werden von den jährlich sich wiederholen-
den kurzfristigen Schwankungen begleitet. Diese kurzfristigen
Schwankungen, deren Größenordnung bei 200000 Beschäftigten
liegt, sind saisonal und wetterbedingt und können somit auf natür-
liche Ursachen zurückgeführt werden. Trotzdem wären auch
diese Störungen der Beschäftigungslage, die für die Unternehmer
wie die Arbeitnehmer gleichermaßen belastend sind, in ihrem
Umfang reduzierbar. Zum Beispiel, indem man Überstunden in
der Sommerzeit mit „Unterstunden“ in der Winterzeit verrechnet.
Ich habe in den 60er Jahren in einem Betrieb gearbeitet, in dem
man das - mit Einverständnis aller Beteiligten und hinter dem
Rücken der Gewerkschaft - mit Erfolg praktiziert hat.
Doch interessanter und aufschlußreicher als die Untersuchung
der kurzfristigen Veränderungen der Arbeitslosigkeit ist die der
lang- und mittelfristigen.
Was sind die Ursachen der langfristigen Veränderungen?
Langfristige Veränderungen haben auch sich langfristig verän-
dernde Ursachen. Für den rapiden Abbau der Arbeitslosigkeit
nach 1950 war einmal die Wiederbelebung der Nachkriegswirt-
schaft ursächlich, die bekanntlich erst nach der „Währungsre-
form“ einsetzte. Noch entscheidender für das Tempo des Abbaus
aber war die Arbeitszeitpolitik der Gewerkschaften.
Wie aus der nachfolgenden Darstellung ersichtlich, haben die
Gewerkschaften den Mut gehabt, trotz der ungeheuren Kriegszer-
störungen und des aufgestauten Nachholbedarfs, die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit in den ersten zehn Jahren von 48
auf 44 Stunden zurückzuführen. Dieser Reduzierung folgte in den
nachfolgenden 15 Jahren noch einmal eine Reduzierung um vier
Stunden auf die als Ziel angesetzte 40-Stunden-Woche. Mit Hilfe
dieser radikalen Arbeitszeitverkürzung konnten nicht nur die
rückkehrenden Kriegsgefangenen und die Ostflüchtlinge in den
Wirtschaftsprozeß integriert werden. Auch die Position des Ar-
beitnehmers erfuhr eine Aufwertung, wie sie kurze Zeit vorher
noch für undenkbar gehalten wurde : Aufgrund des so erhaltenen
Arbeitskräftemangels war der Arbeitnehmer „König“ am Ar-
beitsmarkt. Er konnte sich die Stellen fast nach Belieben aus-
suchen und wurde in der Mehrzahl aller Fälle über Tarif bezahlt.
Ausgelöst durch die für alle Dollarbesitzer günstigen Wechsel-
kurse, kam es darüber hinaus zu einem Exportboom, den man nur
mit dem Hereinholen von Millionen Gastarbeitern durchziehen
konnte.
Rechnet man die Jahresdurchschnittsreduzierungen aus, dann
wurden die Wochenarbeitszeiten in den 50er Jahren jährlich um
fast 30 Minuten gekürzt, in den folgenden 15 Jahren immerhin
noch um eine gute Viertelstunde. Dann aber - wie die Kurve zeigt
- ruhte man sich auf dem Erreichten aus. Besondes kraß läßt das
die zusätzlich in der Grafik eingetragene Treppe der IG-Metall-
Tarifabschlüsse erkennen. Während die vereinbarte Arbeitszeit
von 1956 bis 1966 (also innerhalb von zehn Jahren!) von 48 auf 40
Stunden heruntergefahren wurde, hat man sie anschließend bis
1985, also über 19 Jahre hinweg, eingefroren.
Betrachtet man nun die Kurve der Wochenlohnentwicklungen
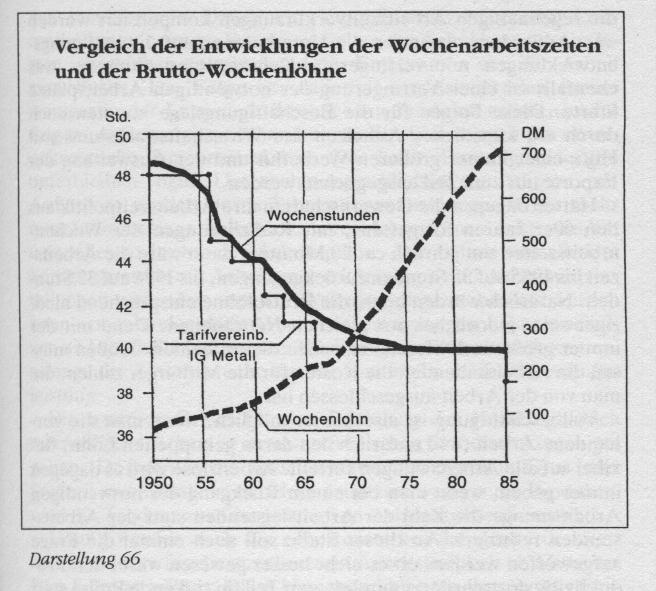
Darstellung 66
in der Grafik, so zeigt sich ein umgekehrter Trend: Während die
Lohneinkommen in den ersten beiden Jahrzehnten gemäßigt an-
stiegen, gingen sie anschließend steiler nach oben. Das heißt, in
den ersten beiden Jahrzehnten hat man die Produktivitätsfort-
schritte sowohl steigenden Löhnen wie sinkenden Arbeitszeiten
zugute kommen lassen. In den anschließenden Jahren aber wurde
der Leistungszugewinn, bei Festschreibung der 40-Stunden-Wo-
che, voll in Lohnerhöhungen umgesetzt. Diese Änderung der vor-
herigen Gewerkschaftspolitik - aus welchen Gründen auch immer
vollzogen - hatte natürlich Folgen für den Arbeitsmarkt : Die ver-
stärkten Produktions- und Kaufkraftzunahmen beschleunigten
die sowieso gegebenen Sättigungsentwicklungen. Dadurch ent-
stand ein zunehmender Arbeitskräfteüberhang, der vorher durch
die regelmäßigen Arbeitszeitverkürzungen kompensiert worden
war. Außerdem reagierten die Unternehmen auf die Sättigungs-
entwicklungen mit verringerten Kapazitätsausweitungen, was
ebenfalls zu einer Verringerung der notwendigen Arbeitsplätze
führte. Diese Folgen für die Beschäftigungslage konnten auch
durch ein künstliches Anheizen des Wirtschaftswachstums mit
Hilfe einer immer größeren Werbeflut und der Ausweitung der
Exporte nur zum Teil ausgeglichen werden.
Hätten dagegen die Gewerkschaften ihre Arbeitszeitpolitik aus
den 60er Jahren fortgeführt, mit Reduzierungen der Wochen-
arbeitszeiten um jährlich ca. 20 Minuten, dann wäre die Arbeits-
zeit bis 1985 auf 35 Stunden zurückgegangen, bis 1994 auf 32 Stun-
den. Natürlich würden heute die Bruttolöhne entsprechend nied-
riger sein, jedoch bei fast gleichen Nettolöhnen. Denn mit der
immer größeren Differenz zwischen diesen beiden Größen müs-
sen die Arbeithabenden die Kosten für die Mitbürger zahlen, die
man von der Arbeit ausgeschlossen hat.
Vollbeschäftigung ist also immer möglich, wenn man die vor-
handene Arbeit (und natürlich den daran gekoppelten Lohn) fle-
xibel auf alle Arbeitswilligen verteilt. Arbeitslose wird es dagegen
immer geben, wenn man bei einem Rückgang der notwendigen
Arbeitsmenge die Zahl der Arbeitsleistenden statt der Arbeits-
stunden reduziert. An dieser Stelle soll auch einmal die Frage
aufgeworfen werden, ob es nicht besser gewesen wäre, den Pro-
duktivitätsfortschritt, zumindest zum Teil, in sinkende Preise statt
steigende Löhne umzusetzen. Denn sinkende Preise wären allen
Menschen zugute gekommen. Sicherlich wäre in diesem Fall unser
heutiger Wohlstandsvorsprung geringer, aber auch die Probleme,
die daraus entstanden sind, von der Diskrepanz zwischen Nord
und Süd bis zu denjenigen unserer eigenen Landwirtschaft.
Gibt es weitere Ursachen für die langfristige Arbeitslosigkeitsentwicklung?
Neben den Folgen der veränderten Gewerkschaftspolitik haben
noch weitere Ursachen zu dem langfristigen Anstieg der Arbeits-
losigkeit seit Anfang der 70er Jahre beigetragen. Hier ist als erstes
die überproportionale Zunahme der Geldvermögen und der dar-
aus resultierende Druck auf kapitalintensivere Produktions-
methoden zu nennen. Die damit steigenden Schulden und Zinsla-
sten verschieben entsprechend die Einkommen von der Arbeit
zum Besitz. Die Folge ist, daß die Arbeitsleistenden immer
weniger in der Lage sind, ihre eigenen Produkte selbst nachzu-
fragen. Andererseits machen höhere Zinsbelastungen das unter-
nehmerische Tun unattraktiver. Das heißt, Firmengründungen
unterbleiben bzw. Unternehmungsschließungen nehmen zu.
Außerdem werden durch Firmenkonzentrationen immer mehr
mittelständische, arbeitsintensivere Unternehmen ausgeschaltet
usw, alles zu Lasten der Arbeitsplätze. Die Folgen von alledem
könnten zwar durch Arbeitszeitverkürzungen und Arbeitsumver-
teilungen verhindert werden. Was aber nicht verhindert werden
kann - ob mit oder ohne Arbeitszeitverkürzungen -, ist ein relati-
ver und schließlich absoluter Rückgang der Arbeitseinkommen,
solange die Zinsansprüche rascher zunehmen als die Wirtschafts-
leistung.
Ein weiterer Grund für den Rückgang der Nachfrage nach
menschlicher Arbeit ist in unseren falschen Steuerstrukturen ge-
geben: Da bei uns die Arbeitseinkommen mit dem Gros aller
Steuern und Sozialkosten belastet sind und weniger die Produkte,
wird die Tendenz zur Einsparung von Arbeitskräften verstärkt.
Häufig werden auch die geburtenstarken Jahrgänge der 50er
und 60er Jahre für die zunehmende Arbeitslosigkeit ab Mitte der
70er Jahre angeführt. Diese Ursachenerklärung aber ist sehr frag-
würdig, da jeder hinzukommende Mensch nicht nur Arbeit sucht,
sondern auch zusätzliche Bedürfnisse hat, die durch Arbeit befrie-
digt werden müssen. Doch noch wichtiger als die Eingrenzung der
Ursachen für die langfristigen Beschäftigungsveränderungen ist
die Untersuchung der mittelfristigen. Denn den langfristigen Ur-
sachen kann mit langfristig wirkenden Gegenmaßnahmen abge-
holfen werden. Die mittelfristigen sind nachträglich kaum auszu-
gleichen. Hier muß bei den Ursachen angesetzt werden.
Die Ursachen der mittelfristigen statistischen „Ausreißer“
Wie schon die Darstellung 65 erkennen läßt, nehmen die mittelfri-
stigen, fast eruptiv ansteigenden Arbeitslosigkeitsschübe an Höhe
zu. Sie katapultieren förmlich in kurzer Zeit die Arbeitslosenzah-
len nach oben, mit Schüben bis zur Millionenhöhe.
Diese plötzlichen Zunahmen sind ein wesentliches Kennzei-
chen jener Konjunkturkrisen, die sich - nach Ansicht der meisten
Wirtschaftswissenschaftler und Politiker - ab und zu wiederholen
und die man hinnimmt wie Ebbe und Flut oder irgendwelche un-
beeinflußbaren Naturkatastrophen.
In der folgenden Darstellung 67 ist noch einmal die Entwicklung
der Arbeitslosigkeit seit 1950 aufgezeigt, jedoch ohne die sich
jährlich wiederholenden Schwankungen. Damit heben sich die
mittelfristigen Veränderungsschübe, hier mit 1 bis 4 gekennzeich-
net, noch deutlicher ab. Zusätzlich ist im oberen Teil der Grafik
die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen eingetragen, also jener
Zinsen, die man für die langfristige Überlassung von Geld erhält
und an denen sich Investoren bei ihren Entscheidungen orientie-
ren.
Verschiebt man -wie in der Grafik geschehen - die Darstellung
der Zinsen parallel zur Kurve der langfristigen Entwicklung der
Arbeitslosigkeit, dann wird die Wechselwirkung zwischen den
Zinssatzveränderungen und den mittelfristigen „Ausreißern“ am
Arbeitsmarkt besonders deutlich: Zwei bis drei Jahre nach dem
Anstieg der Zinssätze schießt auch die Entwicklung der Arbeits-
losigkeit in die Höhe. Bricht der Zinsanstieg ab, ist das ein bis zwei
Jahre später auch bei der Arbeitslosigkeit der Fall.
Wie erkennbar, führte schon die geringe Zinsanhebung um
einen Prozentpunkt im Jahr 1957 ein Jahr später zu einer Unter-
brechung der langfristigen Arbeitslosigkeitsabnahme und einem
leichten Wiederanstieg (1). Noch deutlicher war die Wirkung des
Zinsanstiegs von sechs auf 7,8 Prozent mitten in der Vollbeschäfti-
gungsphase der 60er Jahre, die zu einer Verdreifachung der da-
mals noch geringen Arbeitslosigkeit führte (2). Noch gravieren-
der in ihren Folgen waren dann die beiden Hochzinsphasen 1974
und 1981, in denen die Zinssätze jeweils bis auf die 10,6-Prozent-
Marke kletterten: Bei der ersten Hochzinsphase vervierfachte
sich die Zahl der Arbeitslosen auf rund eine Million (3). In der
zweiten wurde sie von rund 900000 auf mehr als 2 Millionen hoch-
katapultiert (4).
Besonders auffallend ist, wie abrupt der Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit nach jedem Zinsgipfel wieder abbricht. Auch die zusätzlich
eingezeichnete Kurve der Firmenpleiten läuft - wie erkennbar-
hinter den Zinssätzen her, jedoch weicher und verzögerter in ihren
Abschwüngen.

Darstellung 67
Welche Rolle spielen die Verschuldungen?
Bei den hier dargelegten Zinsbelastungen sind jene für die Schul-
den aus mehreren Gründen besonders problematisch. Einmal
stellen sie eine Belastung dar, die auf jeden Fall erwirtschaftet
werden muß, während die Eigenkapitalverzinsung auch mal vor-
übergehend in den Keller gehen kann. Zum zweiten nehmen diese
Fremdkapitalzinsen im Gleichschritt mit der Entwicklung von
Geldvermögen und Schulden zu, die seit 1950 deutlich rascher an-
steigen als die wirtschaftliche Leistung. Vor allem aber - und hier
sind wir wieder bei den Ursachen der mittelfristigen „Ausreißer“ -
verändern sich die Zinslasten für das Fremdkapital schlagartig mit
den Zinssätzen.
Dieser Verdoppelungseffekt trifft in einem besonderen Maße
natürlich hochverschuldete Unternehmen. Dabei gilt das nicht
nur für kleinere und mittlere Betriebe, sondern, wie der Kasten
zeigt, auch für größere.
Der zitierte Text erfordert jedoch einige Klarstellungen: Wie
die meisten Bürger und selbst viele Ökonomen, verfolgen auch die
Gewerkschaftler offensichtlich den Zinsfluß nur vom Schuldner
bis zur Bank. Dabei bleiben bei der Bank nur die Kreditvermitt-
lungskosten hängen. Die eigentlichen Zinsen fließen dagegen
durch die Bank hindurch zu den Geldguthabenbesitzern. Für
Zinsen
Die Arbeitnehmer des AEG-Konzerns haben nach An-
sicht der IG-Metall-Mitgliederzeitschrift „Metall“ seit
1970 „wie wild für die Banken geschuftet“. In einer jüng-
sten Ausgabe wirft das Blatt den Banken vor: Obwohl
die Produktivität jedes AEG-Mitarbeiters über dem
Branchendurchschnitt gelegen habe, sei eine Sanierung
unmöglich gewesen, weil jeder AEG-Beschäftigte, seit
1970 allein 29000 DM Zinsen habe erarbeiten müssen.
Die Banken hätten insgeamt „3,9 Milliarden DM aus
dem Konzern gesaugt“. Das sei dreimal soviel wie der
Staat in der gleichen Zeit an Steuern von der AEG erhal-
ten habe.
Nordwest-Zeitung vom 6. September 1982
diese Geldgeber haben also die Banken den allergrößten Teil der
„3,9 Milliarden DM aus dem Konzern gesaugt“.
Die Arbeitnehmer haben demnach auch nicht „wie wild für die
Banken geschuftet“, sondern für jene, die ihr übriges Geld den
Banken überlassen haben. Außerdem haben die Arbeitnehmer bei
AEG nicht wilder geschuftet als die bei Siemens oder anderen Kon-
zernen. Denn sowohl die Löhne wie die Arbeitszeiten entsprachen
bei AEG den üblichen Tarifen. Das heißt, die Schuldenzinsen eines
Unternehmens werden nicht durch unbezahlte Überstunden oder
Lohnkürzungen finanziert, sondern durch Umlage auf die Preise.
Alle Bürger, ob bei AEG beschäftigt oder nicht, werden also für die
Zinszahlungen zur Kasse gebeten, letztlich auch für die Substanz-
verluste, die mit solchen Pleiten verbunden sind.
Bezeichnend war bei AEG, die mit mehr als sechs Milliarden
Schulden zahlungsunfähig wurde, daß die Banken auf die Hälfte
ihrer Forderungen verzichteten, um das Unternehmen nicht völlig
in den Bankrott zu treiben. Solche Großzügigkeit kommt kleineren
Unternehmen äußerst selten zugute.
Allerdings stehen die Banken bei dieser Großzügigkeit - wie
häufig angenommen - nicht mit ihrem Eigenkapital gerade. Viel-
mehr gleichen sie die in den Schornstein geschriebenen Forderun-
gen etwa zur Hälfte durch Verlustabschreibungen bei der Steuer
aus und zur anderen Hälfte durch eine Erhöhung des Risikoanteils
in ihrer Bankmarge. Das heißt, die Allgemeinheit kommt für diese
Verluste auf, während Einlagen und Einkünfte der geldgebenden
Zinskassierer unbehelligt bleiben.
Kommt es nur durch verschuldete Unternehmen zu Entlassungen?
Nicht nur verschuldete Unternehmen tragen in Hochzinsphasen
durch Pleiten, Entlassungen oder Investitionsrückstellungen zur
Vergrößerung der Arbeitslosenzahlen bei, sondern auch solche
mit großen liquiden Geldbeständen. Erstere unterlassen bei ho-
hen Zinsen Investitionen, weil es fraglich ist, ob sie die hohen Kre-
ditkosten für die Preise an den Markt weitergeben können. Das
vor allem, wenn sie in Konkurrenz zu unverschuldeten Unterneh-
men stehen, die ihre Preise nicht anheben müssen.
Für die liquiden Firmen, die mit eigenem Geld Investitionen
finanzieren könnten, ist es dagegen in Hochzinsphasen vielmals
attraktiver, ihr Geld auf dem Kapitalmarkt anzulegen, als damit
neue Arbeitsplätze zu schaffen. So kommt es, daß manche Firmen
in solchen Zeiten mehr durch das Verleihen ihrer überschüssigen
Geldmittel verdienen als durch ihre Produktion. Das gilt nicht nur
für Daimler-Benz, wie der Kasten zeigt, sondern z. B. auch für die
Firma Siemens und einige andere Konzerne.
„Die Firma Daimler-Benz hat im Jahre
1981 an ihren Einnahmen aus Vermögen,
vor allem an Zinseinnahmen, mehr ver-
dient als am Verkauf ihrer Lkw- und Pkw-
Produktion. Ähnliches gilt für andere
Großunternehmen.“
Prof. Dr. Horst Ehmke vor dem Deutschen
Bundestag am 13. Oktober 1982 („Das Par-
lament“ vom 23.10.1982, Nr. 42, S. 7)
Pikanterweise hatte die Firma Siemens Anfang der 80er Jahre
etwa gleichgroße Überschüsse in der Kasse wie die AEG-Konkur-
renz Schulden. Diese liquiden Mittel hat Siemens so erfolgreich in
der Hochzinsphase angelegt, daß diese - laut „Stern“ - bereits
1986 auf 22 Mrd. DM angeschwollen waren. Wegen dieser erfolg-
reichen Geldgeschäfte wird Siemens auch scherzhafter-, aber
nicht unzutreffenderweise als „Bank mit angeschlossener Elektro-
abteilung“ bezeichnet. Bekanntlich hat Siemens inzwischen auch
offiziell eine Bank gegründet.
Auch die „Kriegskassen“ einiger anderer Unternehmen waren
Mitte der 80er Jahre prall gefüllt. Laut „Stern“ waren es bei Daim-
ler knapp 15 Mrd., bei VW knapp 10 Mrd., während sich die Che-
mieriesen Bayer, Hoechst und BASF mit Größen um die 5 Mrd.
zufriedengeben mußten.
Was sind die Folgen dieser Diskrepanzen?
Während verschuldete Firmen in Hochzinsphasen verstärkt in die
roten Zahlen geraten oder gar das Handtuch werfen müssen,
gehen die Firmen mit großem Geldvermögen reicher daraus her-
vor. Das heißt, die Liquiditätsunterschiede zwischen den Unter-
nehmen vergrößern sich. Und da die Geldvermögen der einen die
Schulden der anderen sind und die Zinseinkünfte der einen die
Zinslasten der anderen, schaukeln sich diese Diskrepanzen immer
höher. Als Folge kommen die verschuldeten Firmen auch nach
der Konjunkturkrise oft nur schwer wieder in Fahrt. Den finanz-
starken Unternehmen dagegen ist es ein leichtes, diese angeschla-
genen Firmen aufzukaufen. Und ist ein Unternehmen noch nicht
verkaufsbereit, kann man es durch Preisunterbietungen am Markt
leicht gefügig machen.
Die Unternehmenskonzentrationen und damit die Machtzu-
sammenballungen nehmen in solchen Zeiten besonders beschleu-
nigt zu. Man denke nur an all das, was sich Daimler-Benz im Laufe
der 80er Jahre „angeschafft“ hat: von AEG über Dornier bis zu
MBB. Und da der Staat über solche Großkonzerne immer erpreß-
barer wird, mußte er seinem eigenen Kartellamt, das er als Wäch-
ter gegen solche marktgefährdenden Zusammenschlüsse einge-
richtet hat, in den Rücken fallen.
Liquide Großunternehmen, die spielend „aus der Westenta-
sche“ Tausende von Arbeitsplätzen schaffen könnten, unterlassen
das aus Renditegründen also nicht nur in Hochzinsphasen, son-
dern auch im anschließenden Konjunkturaufschwung. Und aus
den aufgekauften Unternehmen, mit denen sie sich die Konkur-
renz vom Halse schaffen, werden oft nur die „Rosinen“ herausge-
pickt und die übrigen Produktionsbereiche stillgelegt, was mit ent-
sprechenden Entlassungen verbunden ist.
Wodurch kommt es zu den Hochzinsphasen?
Daß die Zinsen entscheidend von der Inflation in die Höhe getrie-
ben werden, wurde bereits mehrfach gesagt. Das heißt, Hochzins-
phasen, die schließlich zum Abwürgen der Konjunktur führen,
sind die Folgen vorausgegangener Geldmengenausweitung durch
die Notenbank. Nicht die Anpassung der Leitzinsen an den infla-
tionären Auftrieb der Markt- bzw. Geldmarktzinsen ist also die
eigentliche „Sünde“ der Notenbanken, sondern die zwei bis drei
Jahre vorher zu großzügig gehandhabte Geldmengenpolitik. Mit
der Anhebung der Leitzinsen versuchen die Notenbanken, oft
noch zum falschen Zeitpunkt, durch Geldverteuerung nachträg-
lich das gutzumachen, was sie vorher bei der Geldmengensteue-
rung versäumt haben.
Der frühere Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Fritz
Leutwiler, hat bei seiner letzten Rede vor der Generalversamm-
lung der Bank 1984 diese Zusammenhänge beim Namen genannt:
„Eine starke Geldmengenexpansion bleibt nicht ohne Infla-
tionsfolgen, was wiederum die Zinssätze in die Höhe treibt.
Früher oder später schließt sich der Teufelskreis mit dem
Zwang zu einer antiinflationären Politik, deren Wirkungen
heute nur allzu bekannt sind: hohe Zinssätze, Rezession und
Arbeitslosigkeit.“
Der Versuch der Notenbanken, die zinstreibende Inflation durch
hohe Leitzinsen zu bekämpfen, muß also fast als Verzweiflungstat
eingestuft werden. Vergleichbar ist diese Heilungsmethode mit
der eines Arztes, der seinen Patienten durch leichtfertiges Verhal-
ten zuerst in hohes Fieber stürzt und anschließend versucht, den
Kranken durch ein Eisbad wieder auf die Beine zu bringen. Und
so wie bei dieser Doktor-Eisenbart-Kur der Patient auf der
Strecke bleibt, so bei der Kur mit hohen Leitzinsen endgültig die
Konjunktur: Ein Teil der Unternehmen geht in die Knie, die an-
deren sind im Überlebenskampf auf dem geschwächten Markt zu
Preissenkungen gezwungen, womit tatsächlich der inflationäre
Preisauftrieb gestoppt wird. Teuer bezahlt mit Zehntausenden
von Firmenpleiten und Hunderttausenden von zusätzlichen Ar-
beitslosen.
Gilt diese Beziehung zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit überall?
Überprüft man die entsprechenden langfristigen Entwicklungen,
dann zeigen sich mehr oder weniger deutlich die gleichen Bezie-
hungen auch in allen anderen Ländern. Wie die nachfolgende
Grafik 68 der Bundesbank mit den Durchschnittswerten für die
Jahre 1981 bis 1986 zeigt, wird die Höhe der Arbeitslosigkeit über-
all entscheidend von der Inflationsrate beeinflußt.
Die von Helmut Schmidt 1972 verkündete Auffassung, fünf
Prozent Inflation seien besser zu ertragen als fünf Prozent Arbeits-
losigkeit, lag also voll daneben: Inflationen vermeiden keine Ar-
beitslosigkeit, sondern führen dazu.
Auch heute wird in Konjunkturflauten von manchen Politikern
und Gewerkschaftlern einer lockeren Geldpolitik das Wort gere-
det. Offensichtlich haben sie immer noch nicht begriffen, welche
Auswirkungen Inflationen auf die Zinshöhe und diese wiederum
auf das Wirtschaftsgeschehen und die Arbeitslosigkeit haben.
Wofür sich gerade Gewerkschaften wie auch Unternehmerver-
bände einsetzen müßten, wäre also eine verbindliche Verpflich-
tung der Bundesbank zur Kaufkraftstabilität. Doch man hat fast
den Eindruck, daß die Inflation den Gewerkschaftsfunktionären
in den Kram paßt. Denn je höher die Inflationsraten sind, um so
höher können sie ihre nächsten Lohnforderungen schrauben, wie
der Streik der ÖTV 1992 gezeigt hat. Daß uns alle jeder Streiktag
ärmer macht, wird von den Gewerkschaftsbossen um des äußeren
Erfolges willen ebenfalls verdrängt. „Dieser Streik im öffentlichen
Dienst, noch ein paar Tage länger durchgezogen, hätte tatsächlich
bald alle Räder stillstehen lassen. Den Schaden, den er angerich-
tet hat, waren die mickrigen Prozente nicht wert. Streicht man die
Inflation von 4 Prozent ab, sind es wirklich nur 1,4 Prozent mehr“,
schrieb Wilhelm Schmülling, Redakteur der Monatszeitschrift
„Der Dritte Weg“, im Juni 1992. Doch wie die Gewerkschaften
immer nur vordergründig die Gewinne der Arbeitgeber sehen, so
weisen auch die Unternehmer nur auf die hohen Löhne, aber
kaum auf die hohen Zinsen hin. „Auf diesem Auge sind sie blind“,
schreibt Hans Kadereit im Februar 1993 in der gleichen Zeit-
schrift. Und weiter: „Bei den Löhnen wird um so mehr gepokert,
da die Arbeitnehmer erpreßbar sind: Sie müssen arbeiten, sonst
haben sie und ihre Familien nichts zu beißen. Anders das Finanz-
kapital: Es "arbeitet", wann es will. Wenn die Zinsen zu niedrig
sind, legt es sich einfach still auf die faule Haut. Es kann ja warten.
Geld rostet nicht, wenn es rastet.“
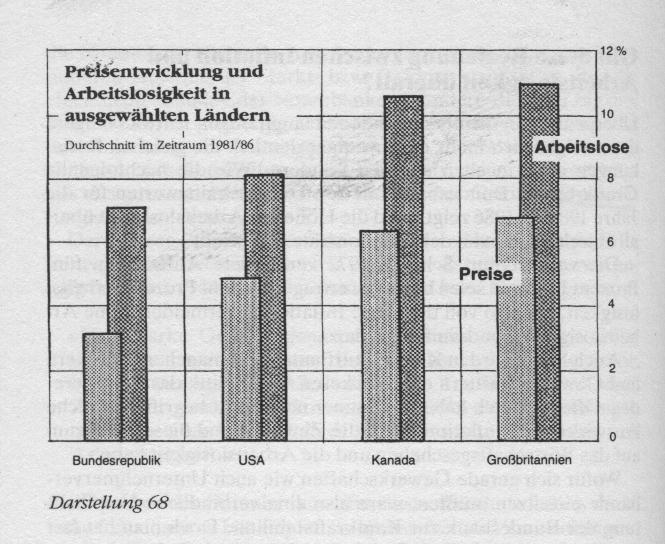
[ Inhalt
Geldsyndrom ] [ Homepage
www.geldreform.de ] [ Gästebuch
www.geldreform.de ]
Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,
1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4
Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Mit Zustimmung des Autors digitalisiert für INWO
Deutschland e.V.