Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,
1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4
Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
[ Inhalt
Geldsyndrom ] [ Homepage
www.geldreform.de ]
[ Gästebuch
www.geldreform.de ]
25. Kapitel
Geld und Krise - Die ökonomischen Folgen
„Immer dann, wenn es in der ökonomischen
Realität anders zugeht, als es die Modelle
der Wirtschaftslehrbücher vorschreiben,
sollten die Ökonomen, statt in der Rumpel-
kammer überholter Theorien herumzustö-
bern, nach den monetären Ursachen der
Krise fahnden.“
Wilhelm Hankel *
* Wirtschaftswissenschaftler, "John Maynard Keynes“, 1988
Versucht man, die Krisenentwicklungen in der Welt einzugren-
zen, kann man das auf verschiedene Weise tun, z. B. von geogra-
phischen, politischen, ökonomischen oder historischen Gesichts-
punkten her. Würde man die von Krisen besonders betroffenen
Länder auf dem Globus markieren, dann wäre sichtbar, daß man
mit dem geographischen Ansatz nicht weit kommt. Wirtschafts-
krisen gibt es überall, in Nord und Süd, in Ost und West. Daß sie
auf der Südhalbkugel gravierender sind, hängt unter anderem
damit zusammen, daß der Norden es verstanden hat, manche Kri-
senursachen und ihre Folgen in die südlichen Länder abzuschie-
ben. Denn wer anderen wirtschaftlich und politisch überlegen ist,
kann nicht nur Güter exportieren, sondern auch Arbeitslosigkeit
und Umweltzerstörung.
Prüft man den politischen Ansatz, dann kommt man auch nicht
viel weiter. Denn Wirtschaftskrisen treffen wir in Demokratien
ebenso an wie in Diktaturen; in Feudal-Systemen ebenso wie in
sozialistischen. Auch eine Untersuchung der verschiedenen Wirt-
schaftsformen bringt nicht viel. Ob Planwirtschaften, mehr oder
minder „freie“ Marktwirtschaften oder irgendwelche Misch-
modelle: alle werden - wie die Erfahrung unserer Tage zeigt - von
Krisen heimgesucht. Rohstoffreiche Länder fallen ebenso dar-
unter wie rohstoffarme, industrialisierte ebenso wie landwirt-
schaftlich orientierte. Selbst Sondermodelle mit oft propagiertem
Vorbildcharakter, wie Schweden und Israel im westlichen oder
Jugoslawien und Kuba im sozialistischen Lager, konnten sich den
zunehmenden Problemen nicht entziehen.
Fündiger wird man jedoch auf der Suche nach den auslösenden
Ursachen der Krisen, wenn man einmal dem historischen Ansatz
folgt. Schon wenn wir uns auf unseren eigenen Raum und dieses
Jahrhundert beschränken, werden wir schnell feststellen, daß alle
unsere bisherigen großen Krisen, wie auch die zwischenzeitlichen
Aufstiegsphasen, in auffallender Weise mit dem Geld zusammen-
hängen.
Was waren die großen Krisen unseres Jahrhunderts?
Bei der großen Inflation in den Jahren 1920 bis 1923 bedarf der
Krisenzusammenhang mit der Geldordnung (bzw. -unordnung)
kaum näherer Erläuterungen. Aber auch die nächste große Krise
Anfang der 30er Jahre hing mit geldbezogenen Problementwick-
lungen zusammen. Auslöser dieser Depression, in der die Arbeits-
losigkeit in Deutschland in kurzer Zeit auf über sechs Millionen
anschwoll, waren vor allem die Börsen- und Bankenkräche in den
USA 1929, nicht zuletzt als Folge überzogener Aktienspekulatio-
nen mit geliehenem Geld. Das hatte auch gravierende Auswirkun-
gen für die Weimarer Republik. Denn aufgrund der Zahlungseng-
pässe der US-Banken forderten diese in aller Welt ihre Kredite
zurück. Auch die Reichsbank mußte solchen Forderungen nach-
kommen. Da die Kreditrückzahlungen in Gold erfolgten, verrin-
gerten sich die entsprechenden Reserven der Reichsbank. Und da
die herausgegebene Geldmenge an die Goldreserven gebunden
war, reduzierte der damalige Reichsbankpräsident Luther pflicht-
gemäß die umlaufende Geldmenge.
Man hatte zwar unter großen Opfern Anfang der 20er Jahre
gelernt, daß man die Geldmenge auf keinen Fall über die Wirt-
schaftsleistung hinaus vermehren dürfe, wußte aber offensichtlich
nicht, daß eine Geldmengenverminderung zu einem depressiven
Zusammenbruch der Wirtschaft führt. Die sowieso prekäre Lage
wurde also durch die deflationäre Geldpolitik der damaligen
Notenbank noch verstärkt, die „in autonomer Erhabenheit die
Weimarer Republik exekutierte“, wie der frühere Bundesminister
Ehrenberg in seinem Buch „Zwischen Marx und Markt“ 1973 tref-
fend schrieb. Da ohne die daraus resultierenden Arbeitslosen-
heere Hitler kaum an die Macht gekommen wäre, kann man auch
das „Dritte Reich“ und den zweiten großen Krieg in diesem Jahr-
hundert auf das Konto jener falschen geldbezogenen Entschei-
dungen buchen.
Auch die Gewerkschaftszeitschrift „Metall“ hat 1953 diese fa-
tale Beziehung bestätigt:
„Zweimal wurde das soziale Gefüge des deutschen Volkes in
den Grundfesten erschüttert: während der großen Inflation des
Jahres 1923 und nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise
im Jahre 1929. Ohne diese Katastrophen wäre der National-
sozialismus niemals eine Macht geworden.“
Für die Unwissenheit der Politiker in der Weimarer Republik über
die monetären Hintergründe der großen Rezession mag das Zitat
des damaligen SPD-Politikers Nölting stehen:
„Die Geldkrisen sind im wesentlichen interne Vorgänge im Be-
reiche des Kapitals, häuslicher Hader der Bourgeoisie, ein sich
in einer höheren Region vollziehendes und sich selbst aufhe-
bendes Kampfspiel.“
Leider hat sich an diesem Erkenntnisgrad bei den meisten Politi-
kern bis heute nicht allzuviel verändert.
Die dritte Wirtschaftskrise in unserem Land, die Wirtschafts-
lähmung von 1945 bis 1948, war ebenfalls währungsbezogen, näm-
lich die Folge einer rüstungs- und kriegsbedingten Überauswei-
tung der Geldmenge, der nach dem Krieg kein ausreichendes
Angebot an Gütern gegenüberstand. Für solches inflationäres
Geld aber ist niemand mit Lust und Laune zu arbeiten bereit.
Trotz der durch die Kriegszeit entstandenen übergroßen öffent-
lichen Aufgaben und persönlichen Bedürfnisse kam die Wirt-
schaft nicht in Gang. Erst nachdem man das inflationäre Geld
gegen ein mengenmäßig reduziertes umgetauscht hatte - fälsch-
licherweise als Währungs-“Reform“ bezeichnet -, kam es zu einer
wirtschaftlichen Wiederbelebung und zu dem sogenannten „Wirt-
schaftswunder“.
Nicht nur die Wirtschaftseinbrüche, auch die Wirtschaftsauf-
schwünge werden also entscheidend von der Geldordnung bzw.
Geldverfassung bestimmt. Das gilt auch für das „Wunder der
Rentenmark“, also jenen kurzen Aufschwung nach der großen In-
flation im Jahr 1923.
Welche Tatbestände könnten auch bei uns zu einer großen Krise führen?
Erinnern wir uns noch einmal an die zweite Wachstumsregel. Da-
nach kann ein Organismus nur stabil bleiben, wenn sich alle seine
Teile im Gleichschritt mit dem Ganzen entwickeln.
Wie hier bereits mehrfach dargelegt, wachsen in unserem Wirt-
schaftsorganismus die monetären Bestandsgrößen Geldvermögen
und Schulden mit exponentieller Tendenz. Die sozialen Folgen
dieser Überentwicklung konnten bislang in den meisten Ländern
durch ständiges Wirtschaftswachstum in erträglichen Grenzen ge-
halten werden. Dieser Ausweg wird jedoch immer weniger gang-
bar, da die Natur einer ständigen Leistungssteigerung Einhalt ge-
bietet. Außerdem muß das noch mögliche Wirtschaftswachstum
immer mehr zur Behebung der bereits bewirkten Naturzerstörun-
gen eingesetzt werden. Diese „Umweltreparaturen“ erbringen
jedoch allein dem eingesetzten Kapital weitere Einkommenszuge-
winne. Die daraus resultierenden Arbeitseinkommen sind dage-
gen fragwürdig. Denn die Arbeitenden müssen - wie bei den
Rüstungsaufgaben - die Kosten dieser Reparaturen über Steuern
und Preisaufschläge selbst tragen. Das heißt, die Arbeitsleisten-
den zahlen sich selbst ihre Löhne, verkürzt um die Verzinsung des
Kapitals, das bei diesen Umweltschutzmaßnahmen zusätzlich ein-
gesetzt wird.
Droht auch dem Kapitalismus unserer Tage eine große Krise?
„Der Kommunismus ist tot - der Kapitalismus todkrank“, hat in
der „Wendezeit“ einmal jemand treffend formuliert. Die „Krank-
heit“ des Kapitalismus läßt sich an vielen Symptomen festmachen,
am besten sicherlich an den monetären „Wucherungen“ und ihren
„Metastasen“, zu denen nicht zuletzt die zinsbedingten Einkom-
mensumschichtungen gehören. Deren Größenordnungen und
Folgen für die Bürger wurden in den Kapiteln 21 und 22 dargelegt.
Aber nicht nur für die Bürger, auch für den Staat haben diese
Diskrepanzentwicklungen schwerwiegende Folgen. Aufgrund der
zunehmenden Staatsverschuldung bluten die öffentlichen Kassen
aus. Die entstehenden Defizite können nur mit verringerten Aus-
gaben, zusätzlichen Schulden oder höheren Steuern geschlossen
werden. Alle drei Maßnahmen treffen zwar die Gesamtheit aller
Bürger, aber die Normalverdiener immer härter als die Geldkapi-
talbesitzer, deren Einkünfte ständig weiter steigen.
Alles in allem wird der finanzielle Spielraum der Regierungen
kleiner, während die sozialen Kosten steigen. Der Sozialstaat
konnte zwar lange Zeit das Auseinanderdriften von Arm und
Reich durch Rückverteilungen in tragbaren Grenzen halten, das
aber wird zunehmend schwieriger. Das „soziale Netz“ reißt nicht
nur an vielen Stellen, weil es allzuoft als „soziale Hängematte“
mißbraucht wird. Es reißt vor allem, weil der Staat immer weniger
in der Lage ist, die zunehmenden „Löcher“ laufend zu flicken. Die
immer höheren Sozialabgaben und der daraus resultierende
Rückgang der Nettolöhne treffen immer mehr jene Schichten, die
der Staat eigentlich unterstützen müßte. Vor allem wächst die
Zahl der Menschen, die durch das soziale Netz hindurchfallen, die
Zahl der Langzeitarbeitslosen, der Sozialhilfeempfänger und der
Nichtseßhaften.
Die Zunahme der sozialen Spannungen in den vom Kapitalis-
mus beherrschten Marktwirtschaften ist also unausweichlich vor-
programmiert. Damit aber auch die nächste große Krise, von der
wir nur erhoffen können, daß sie ohne großen Krieg ablaufen
wird.
Wie erklären sich die dauernden Konjunktureinbrüche?
Wenn ein Automotor nach einigen hundert Kilometern Fahr-
strecke regelmäßig in der Leistung abfallen und erst nach einiger
Zeit wieder auf volle Touren kommen würde, dann würden sich
alle Kfz-Ingenieure Gedanken über die Ursache und deren Ab-
stellung machen.
Wenn aber unser Wirtschaftsmotor alle paar Jahre zu stottern
beginnt, ist das für die Mehrzahl der zuständigen Wirtschaftswis-
senschaftler leider kein Anlaß, den Ursachen auf den Grund zu
gehen. Vielmehr werden diese Störungen im allgemeinen als un-
abänderlicher Tatbestand bzw. als unvermeidbare Erscheinung
einer lebendigen Wirtschaft hingenommen. Manche erklären sie
ganz einfach mit der Unberechenbarkeit menschlichen Verhal-
tens, andere sehen Beziehungen zu den periodisch auftretenden
Sonnenflecken usw. Ernst Helmstädter, Leiter des Instituts für
Industriewirtschaftliche Forschungen an der Uni Münster, hält so-
gar eine Untersuchung der Störungsursachen für überflüssig. So
schrieb er am 18. 9. 1987 in der Wochenzeitung „Die Zeit“:
„Die Konjunktur bezeichnet ein wirtschaftliches Auf und
Ab. Es gibt die Hochkonjunktur, in der alles bestens läuft, und
das Konjunkturtief, in dem die Aktivitäten erlahmen. Eine
Erklärung des Wellenmusters selbst ist gar nicht nötig. Es
genügt, einen solchen Pulsator der Wirtschaft einfach als zu be-
obachtendes Faktum von verläßlicher Regelmäßigkeit nachzu-
weisen.“
Auch die Info-Zeitschrift der Sparkasse „Kleiner Wirtschaftsspie-
gel“ wiegelte 1985 noch ab:
„Das Auf und Ab der Konjunktur ist eigentlich nichts Besonde-
res. Jedem Aufschwung mit stärkerem Wirtschaftswachstum
folgte eine Phase schwächerer Wirtschaftstätigkeit. Das ist das
Kennzeichen jeder Marktwirtschaft. Bemerkenswert ist aber,
daß nahezu jeder Konjunkturaufschwung in der Bundesrepu-
blik schwächer ausfiel als der vorhergehende und daß sich die
Konjunkturtäler immer tiefer einkerben.“
Immerhin kann man dem letzten Satz entnehmen, daß mit diesen
sich wiederholenden Konjunkturschwankungen ein negativer
Trend verknüpft ist. Doch auch diese in vielen Bereichen nach-
weisbaren Negativentwicklungen, die von den zunehmenden Um-
weltzerstörungen bis zu den sozialen Spannungen reichen, sind
offensichtlich kein Grund, den Ursachen genauer nachzugehen.
Was sind ihre Ursachen?
Sucht man für die Konjunktureinbrüche eine Erklärung, dann
müßte sich eine Ursache finden, die mit ihren eigenen Verände-
rungen den Einbrüchen zeitlich vorausläuft. Denn zwischen Ursa-
che und Wirkung gibt es bei komplexen Organismen zwangsläufig
mehr oder weniger lange Verzögerungen.
Untersucht man daraufhin die Schwankungen aller wirtschaft-
lichen Daten unter Einbeziehung des monetären Sektors, dann
zeichnet sich nur eine Größe als vorauslaufend ab, nämlich die der
Zinssätze bzw. der daraus resultierenden Lasten. Daß die
Schwankungen der Zinssätze ihrerseits wiederum entscheidend
von den Inflationsraten beeinflußt werden, wurde bereits mehr-
fach dargelegt.
Um diese Wechselwirkung zu überprüfen, habe ich für den Zeit-
raum 1965 bis 1985 einmal die prozentualen Veränderungsraten
wichtiger Wirtschaftsindikatoren mit der Zinskurve verglichen,
z. B. die des Sozialprodukts, der Beschäftigung, der Verschuldung,
der Ersparnisse usw. Der dafür herangezogene Zeitraum ist beson-
ders aufschlußreich, weil mit ihm drei Hochzinsphasen (1966, '74
und '81) und entsprechend drei Konjunktureinbrüche erfaßt wer-
den.
Verlängert man die Zinsspitzen in die anderen Kurven (siehe
vertikale Strichelungen), dann zeigt sich, daß fast alle Wirt-
schaftsdaten mit etwa einem Jahr Verzögerung auf die Zinssatz-
veränderungen reagieren, entweder gleichgerichtet oder gegen-
läufig. Diese Zeitverzögerungen sind verständlich und ein
Beweis dafür, daß die Zinsschwankungen Auslöser der Konjunk-
turschwankungen sind und nicht etwa umgekehrt.
Vergleicht man die einzelnen Kurven genauer, dann ergeben
sich aufschlußreiche Unterschiede. So verläuft die private Spar-
quote weitgehend parallel mit den Zinsen. Das spiegelt den Tatbe-
stand wider, daß das Gros der Ersparnisse immer mehr aus Zins-
gutschriften besteht. Die Ersparnisse der Unternehmen gehen da-
gegen mit steigendem Zins zurück und umgekehrt. Hier zeichnet
sich der Tatbestand ab, daß bei höheren Zinslasten die erwirt-
schafteten Überschüsse und damit die Ersparnismöglichkeiten re-
duziert werden. Auch die „Risikoprämie“ - Differenz der Netto-
eigen- und der Fremdkapitalrendite - verändert sich gegenläufig
zum Zins. Ebenso die Veränderungsrate des Sozialprodukts und
der Beschäftigung.
Aufschlußreich ist weiterhin die Gegenläufigkeit der Schulden-
zuwachsraten des Staates gegenüber jenen der Unternehmen.
Während letztere ihre Neuverschuldungen in Hochzinsphasen re-
duzieren, ist es beim Staat umgekehrt: Aufgrund rückläufiger
Steuereinnahmen und erhöhter Sozialkosten während der Kon-
junktureinbrüche ist er zu verstärkter Kreditaufnahme gezwun-
gen.
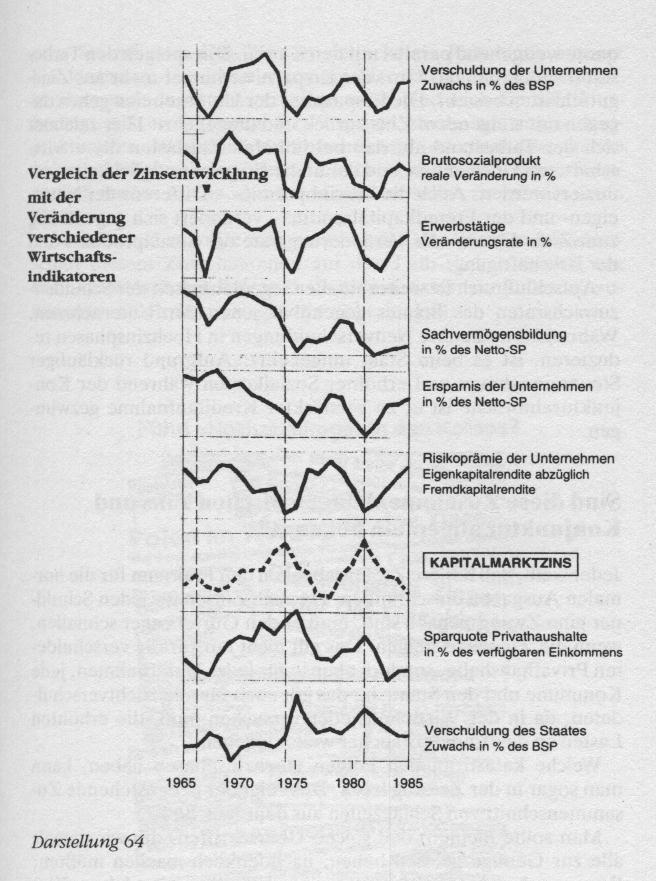
Sind diese Zusammenhänge zwischen Zins und Konjunktur allgemein bekannt?
Jeder weiß, daß höhere Zwangsabgaben den Freiraum für die nor-
malen Ausgaben einschränken. Da auch Zinsen für jeden Schuld-
ner eine Zwangsabgabe sind, muß er den Gürtel enger schnallen,
wenn die Zinssätze steigen. Das gilt nicht nur für die verschulde-
ten Privathaushalte, sondern ebenso für jedes Unternehmen, jede
Kommune und den Staat. Ja, das gilt auch für alle Nichtverschul-
deten, da in der Wirtschaft jeder versuchen muß, die erhöhten
Lasten an den Endverbraucher weiterzugeben.
Welche katastrophalen Folgen Hochzinsphasen haben, kann
man sogar in der Zeitung lesen. Das zeigt der nebenstehende Zu-
sammenschnitt von Schlagzeilen aus dem Jahr 1981.
Man sollte meinen, daß solche Überschriften, die wir damals
alle zur Genüge gelesen haben, nachdenklich machen müßten:
Warum nehmen wir es hin, mit einer Einrichtung zu leben, Zins
genannt, die in einem solchen Maße unser Wirtschaftsleben bela-
stet und gefährdet? Denn beim Zins handelt es sich ja nicht um
irgendwelche unabwendbaren Naturereignisse wie Erdbeben
oder Sturmfluten. Der Zins ist vielmehr ein Phänomen unserer
Geldordnung, die nicht nur von uns Menschen geschaffen wurde,
sondern auch durch uns veränderbar ist. Und auch die inflations-
bedingten Schwankungen der Zinssätze, denen wir unsere kon-
junkturellen Wechselbäder entscheidend „verdanken“, haben
keine natürlichen oder übernatürlichen Ursachen, sondern letzt-
endlich immer solche, die wir Menschen selbst zu verantworten
haben.
Vor allem aber sollte man meinen, daß die Wirtschaftswissen-
schaft diesem Zinsphänomen auf den Leib rücken müßte, um
seine katastrophalen Folgen zu überwinden oder zumindest einzu-
dämmen. Doch das ist so gut wie nicht der Fall.
Warum sind auch zu niedrige Zinsen krisenauslösend?
Zins und Inflation haben nicht nur negative Auswirkungen, sie
sorgen auch dafür, daß Wirtschaftsteilnehmer mit Einkommens-
überschüssen diese wieder in den Umlauf geben. Dabei wirkt der
Zins, als Belohnung für die leihweise Freigabe von Geld, ge-
wissermaßen wie ein Zuckerbrot. Die Inflation wirkt wie eine
Peitsche, die das Geld beschleunigt in die Nachfrage oder in Sach-
anlagen treibt. Kurz: Zins und Inflation sind die Instrumente in
unserer Volkswirtschaft, die für den Umlauf des Geldes sorgen. Je
höher sie sind, um so größer sind ihre umlaufsichernden Wirkun-
gen, allerdings auch ihre destruktiven Auswirkungen. Diese Aus-
wirkungen verringern sich zwar mit einem Absinken der Zins-
bzw. Inflationsraten, jedoch läßt damit auch ihre umlaufsichernde
Wirkung nach.
Läuft das Geld aber nicht mehr regelmäßig um, dann kommt es
zu Stockungen und Unterbrechungen im Nachfragekreislauf. Die
Folgen sind Absatzkrisen und Arbeitslosigkeit. Da die Läden
übervoll sind und die Preise fallen, liegt eine deflationäre Krise
vor. Es handelt sich dabei jedoch um keine echte Deflation durch
Verringerung der Geldmenge wie Anfang der 30er Jahre, sondern
um eine künstliche durch Geldzurückhaltung. Auch die Bezeich-
nung Überangebotskrise ist für diese Situation falsch, denn dieser
Krisenzustand ist nicht die Folge einer Überproduktion, sondern
einer Unternachfrage. Überproduktionskrisen kann es unter nor-
malen Marktbedingungen niemals geben, da jeder Produktion ein
entsprechendes Einkommen gegenübersteht, mit dem das Ange-
bot vom Markt genommen werden kann. Zur Krise kommt es nur,
wenn diese Einkommen nicht in voller Höhe zur Markträumung
eingesetzt werden.
Was löst die deflationären Krisen aus?
Solange ein Konsument überschüssige Einkommensanteile ande-
ren leihweise überläßt, kann es zu keinen Störungen des Nach-
fragekreislaufs kommen. Sie kommen nur dann zustande, wenn
jemand überschüssiges Geld nicht verleiht. Diese Geld(zurück)-
haltung nimmt im allgemeinen in dem Maße zu, wie die Zinsen
sinken, das heißt, wie deren „Zuckerbrotwirkung“ nachläßt. Man
ist in solchen Fällen weniger motiviert, seine Ersparnisse zur Bank
zu bringen, als bei höheren Zinsen. Diese Verhaltensänderung
wirkt sich jedoch nicht nur bei den Konsumenten aus, sondern
ebenso bei denjenigen, die überschüssige Gelder Investoren zur
Verfügung stellen oder selbst investieren. Aufgrund der niedrigen
Zinsen geben auch diese ihr Geld nicht so gerne her, und aufgrund
der marktbezogenen Unternachfrage lohnen sich außerdem die
Investitionen nicht mehr. Die Konjunktur bricht also in Niedrig-
zinsphasen gewissermaßen von zwei Seiten her zusammen: durch
die Investitionsunlust der Geldanleger bzw. der Unternehmer, die
auf höhere Zinsen bzw. Renditen warten, und durch die Nach-
frageunlust der Konsumenten, die auf weiter fallende Preise hof-
fen.
Noch mehr als eine inflationäre, nährt sich also eine deflatio-
näre Krise selbst. Es ist darum verständlich, daß die Regierungen
und Notenbanken vor einer solchen Krise größten Respekt haben
und sie mit allen Mitteln zu verhindern suchen: die Regierungen
durch die verschiedensten Maßnahmen der Wirtschaftsbelebung,
die Notenbanken mit dem Nachschub von Geld bzw. einer ständi-
gen Überausweitung der Geldmenge, mit der sie das Absinken der
Inflation auf Null oder gar darunter zu verhindern suchen, wie im
9. Kapitel beschrieben.
Welche Wirkungen haben Geldzurückhaltungen auf die Beschäftigungslage?
„Millionen Menschen hungern, nicht weil es zuwenig Lebensmit-
tel in der Welt gibt, sondern weil ihnen das Geld fehlt, sie zu kau-
fen.“ - Das hat vor einigen Jahren der Präsident der Weltbank
gesagt.
Bezieht man den Satz auf unsere Wirtschaftskrisen und speziell
auf die Arbeitslosigkeit, dann könnte man ihn so umformulieren:
Millionen Menschen sind arbeitslos, nicht weil es zuwenig Arbeit
in der Welt gibt, sondern weil das Geld fehlt, sie zu bezahlen.
Geld ist also nicht nur das vielgelobte Tauschmittel, das Ange-
bot und Nachfrage in Deckung bringt, sondern allzu häufig auch
ein Tauschverhinderungsmittel, das Angebot und Nachfrage nicht
zusammenkommen läßt. Es ist also nicht nur ein „Schlüssel zum
Markt“, sondern in vielen Fällen auch ein „Riegel“. Und diese
Riegelfunktion nimmt mit sinkenden Zinsen zu.
„Wer Geld einsperrt, sperrt Arbeiter aus“, schrieb bereits in
den 20er Jahren der „Nebelspalter“ zu diesem „Geldstreik“. Und
ein anderes Schlagwort aus jener Zeit besagt: „Kein Zins - kein
Geld, kein Geld - keine Arbeit, keine Arbeit - kein Lohn“, wo-
mit wir an das Zitat des Weltbankpräsidenten anknüpfen kön-
nen.
Auch wenn bei uns bislang ein deflationärer Preisniveauein-
bruch vermieden werden konnte, so werden die Schleifspuren zu
niedriger Zinsen in der Wirtschaft immer häufiger sichtbar. Doch
statt dafür zu sorgen, daß das vom Staat herausgegebene Geld
seine Funktion als Umlaufmittel auch bei niedrigeren Zinsen er-
füllt, hilft man lieber dem Zins auf die Beine, notfalls durch kredit-
finanzierte staatliche Investitionen oder Subventionen privater
Unternehmungen oder auch durch Eingriffe der Notenbanken.
Das heißt, die Zinserträge der Geldüberschußbesitzer werden mit
staatlicher Hilife weiter garantiert, auch wenn der Zins, den
Marktgesetzen folgend, eigentlich sinken müßte. Die Möglichkeit
des Geldes zu streiken zwingt den Staat und die Wirtschaft zu
überhöhten Angeboten, die auf Kosten aller Arbeitsleistenden
gehen.
Hat auch die Misere in den neuen Bundesländern mit der Verzinsung zu tun?
Arbeit ist in den neuen Bundesländern bekanntlich in Hülle und
Fülle vorhanden. Das Gros der Wohnungen ist reparaturbedürf-
tig, Sanierungen und Ausbauten im Verkehrsbereich sind überfäl-
lig, und der Nachholbedarf in privaten und öffentlichen Bereichen
ist groß. Auch leistungsbereite Arbeitsuchende stehen in Scharen
auf der Straße. Woran es alleine mangelt, ist das Geld, um Bedarf
und Arbeit zusammenzubringen.
Fehlt das Geld wirklich? -Keinesfalls! Vielstellige DM-Milliar-
denbeträge kreisen spekulierend um den Globus, und Summen
ähnlicher Größenordnung werden jedes Jahr im Ausland ange-
legt. Sie könnten in die neuen Länder wandern, wenn - und das ist
der Haken - wenn die Rendite in genügender Höhe abgesichert
wäre. Das aber ist im Bereich des Wohnungsbaus aufgrund der
staatlich eingegrenzten Mieten absolut nicht der Fall. Im Konsum-
bereich wiederum reichen die westdeutschen Produktionskapazi-
täten weitgehend aus, um den Bedarf der neuen Länder mit abzu-
decken, notfalls werden einige Überstunden gemacht oder der
Export reduziert. Es bleiben die öffentlichen Investitionen, die
jedoch alleine niemals eine Wirtschaft in Schwung bringen kön-
nen, sondern vielmehr vom Schwung der Wirtschaft leben.
Größere Investitionen in den neuen Ländern würden entweder
eine deutliche allgemeine Bedarfssteigerung voraussetzen oder
entsprechende Standortvorteile, zum Beispiel steuerliche Erleich-
terungen oder nachhaltig billigere Löhne. Die Chance günstiger
Lohnkosten wurde jedoch mit der Währungsunion und der allzu
schnellen Anpassung der Löhne vertan. Und wenn westliche Un-
ternehmen heute verlagern, dann gehen sie nach Fernost oder in
Europa nach Ungarn, Irland oder Portugal, wo ein niedriges
Lohnniveau die Kapitalrendite garantiert.
Zu einer allgemeinen Wirtschaftsbelebung, von der auch die
neuen Länder profitieren würden, könnte es nur durch eine allge-
meine Zinssenkung kommen, die die Umverteilung der Einkom-
men von der Arbeit zum Besitz reduziert und viele heute unrenta-
ble Investitionen rentabel macht. Das gilt nicht nur für den Woh-
nungsbau, sondern auch für die Sanierung der Altlasten. Eine sol-
che Zinssenkung aber wäre nur möglich, wenn der Geldumlauf
zinsunabhängig gesichert, das heißt, wenn die Möglichkeit des
Geldstreiks unterlaufen würde.
[ Inhalt
Geldsyndrom ] [ Homepage
www.geldreform.de ] [ Gästebuch
www.geldreform.de ]
Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,
1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4
Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Mit Zustimmung des Autors digitalisiert für INWO
Deutschland e.V.