Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,
1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4
Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
[ Inhalt
Geldsyndrom ] [ Homepage
www.geldreform.de ]
[ Gästebuch
www.geldreform.de ]
15. Kapitel
Überentwicklung der Geldvermögen
„Es sind gar nicht primär Konsum- und Ge-
winnsucht, die den Kapitalismus rastlos vor-
wärtstreiben, sondern die durch Zins und
Zinseszins lawinenartig wachsenden Geld-
vermögen und ein unerbittlicher Zwang, un-
ter dem die Schuldner stehen, nämlich mit
jeder Produktion auch den Zins erwirtschaf-
ten zu müssen.“
Josef Hüwe *
* „Zinswirtschaft heute - Zum veränderten Erscheinungsbild des Kapitalismus",
„Der Dritte Weg",, November 1991
Der Begriff Geldvermögen ist verbunden mit der Vorstellung von
Reichtum und Wohlstand. Man denkt dabei an Truhen voller
Geldstücke oder mit Geldscheinbündeln gefüllte Tresore. Zum
Geldvermögen gehören aber nicht nur solche Bargeldhaltungen,
sondern auch die Ansprüche aus verliehenem Geld. Dabei spielt
es keine Rolle, ob man diese Geldüberlassungen länger- oder kür-
zerfristig getätigt hat, ob direkt oder über eine Bank.
Unter Geldvermögen versteht man also die Summe von (Bar-)
Geld und Geldguthaben. Trotz dieser Zusammenfassung muß
man jedoch zwischen beiden Bestandteilen präzise unterscheiden.
Geld ist immer das Primäre, die Voraussetzung dafür, daß man
Geld verleihen und ein Guthaben erwerben kann. Guthaben be-
stätigen die Geldüberlassung und den Anspruch auf Rückerhalt.
Außerdem kann Geld alleine von der zuständigen Notenbank
vermehrt werden, Guthaben jedoch von jedem Wirtschaftsteil-
nehmer.
Wie setzen sich Geldvermögen im einzelnen zusammen?
Neben dem Bargeld gehören - wie gesagt - alle Guthabenbe-
stände zu den Geldvermögen. Statistisch werden hierfür alle
Ausleihungen zwischen den drei Sektoren Privathaushalte, Un-
ternehmen und Staat erfaßt, Geldüberlassungen innerhalb dieser
Bereiche jedoch nicht. Kredite eines Unternehmens an ein ande-
res oder eines Bürgers an seinen Nachbarn finden in der Statistik
keinen Niederschlag. Ebenfalls nicht die Direktkredite von Kauf-
häusern oder Autohändlern an ihre Kunden oder die Vermittlun-
gen privater Geldverleiher.

Darstellung 32
Geht man von den Veröffentlichungen der Bundesbank aus,
dann lagen die gesamten Geldvermögen aller Sektoren Ende 1995
bei 7703 Mrd. DM. Ihre Zusammensetzung geht aus Darstellung
32 hervor.
Für viele überraschend ist sicherlich der Posten Aktien in der
Geldvermögensstatistik. Denn Aktien sind weder Geld noch ein
Anspruch auf Geld, sondern eine nicht rückforderbare Risiko-
beteiligung an einem Unternehmen, also an Sachvermögen. Die
Begründung für die Einbeziehung der Aktien, daß diese ähnlich
wie Wertpapiere gehandelt und leicht in Geld umgewandelt wer-
den können, ist sicher mehr als fragwürdig. Denn das trifft ebenso
auf Gold und fast alle Handelsgüter zu.
Ebenfalls wird manchen die geringe Größe der Aktienbestände
verwundern, die mit ihrem Nennwert nur bei sechs und ihrem Ta-
geswert bei 13 Prozent der statistisch ausgewiesenen Geldvermö-
gen liegen. Außerdem haben sie sich in den letzten 40 Jahren lang-
samer entwickelt als die übrigen Geldvermögen. Während diese
von 1950 bis 1995 auf das 128fache anstiegen, nahmen die Aktien
nur auf das 60fache zu. Oder anders ausgedrückt:1950 machten
die Aktien noch rund ein Viertel der gesamten Geldvermögen
aus, heute nur noch ein Achtel. Aufgrund der spekulativen Kurs-
schwankungen und der seitenlangen Notierungen in Wirtschafts-
zeitungen wird die Bedeutung der Aktien meist überschätzt.
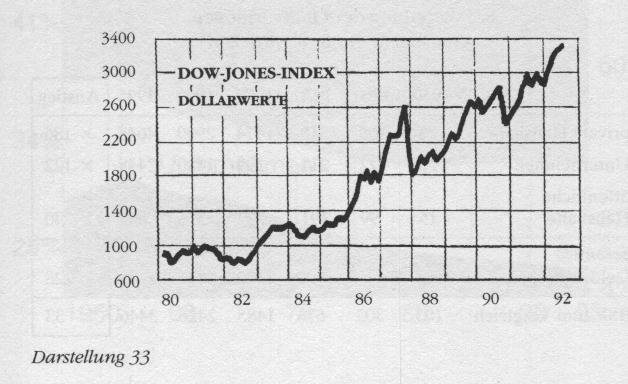
Darstellung 33
Überraschend wird ferner für manchen sein, daß sich der größte
Teil der bundesdeutschen Aktien mit 39 Prozent in den Händen
von Unternehmen befindet, die Privathaushalte nur mit 19 und die
Banken mit elf Prozent am Aktienbesitz beteiligt sind. Der Rest
verteilt sich u. a. mit 20 Prozent auf das Ausland und mit sieben
Prozent auf den Staat. Auch der so groß aufgemotzte „Aktien-
Crash“ 1987 ist längst ausgebügelt. In den Kurven des Dow-Jones-
Index beispielsweise ist der Einbruch Ende 1987 zwar deutlich zu
erkennen, jedoch von den anschließenden Anstiegen bereits bis
1992 auf fast das Doppelte überholt (siehe Darstellung 33). Inzwi-
schen (Sommer '96) hat der Index bereits 5800 Punkte erreicht.
Die Frage ist nur, wann dem rasanten Weiteranstieg ein erneuter
Crash ein Ende macht.
Wem gehören die Geldvermögen?
Wie die Schulden werden auch die Geldvermögen statistisch auf
die drei Sektoren Privathaushalte, Unternehmen und Staat ver-
teilt. Die jeweiligen Anteile und ihre Entwicklungen gehen aus
der nachfolgenden Tabelle hervor, in der die Werte ab 1950 einge-
tragen sind:
Verteilung der Geldvermögen (nominelle Größe in Mrd. DM)
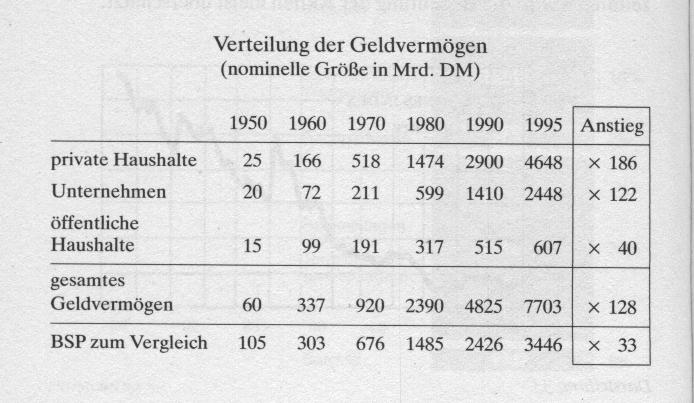
Vergleicht man die Größen, dann haben die privaten Haus-
halte, die an der Gesamtverschuldung 1995 nur mit fünf Prozent
beteiligt waren, bei den Geldvermögen den Hauptanteil. Auch
verzeichnen die Haushalte den schnellsten Anstieg der Geldver-
mögen, nämlich auf das 186fache in den 45 Jahren. Die Geldver-
mögen der Unternehmen nahmen dagegen nur auf das 122fache,
die öffentlichen Vermögen auf das 40fache zu.
Vergleicht man die Anstiegsfaktoren der Geldvermögen mit
denjenigen des BSP, dann zeigt sich wieder die Scherenöffnung,
die wir bereits bei den Schulden festgestellt haben.
Wie haben sich die Anteile der Sektoren verändert?
Die Anteilsverschiebung innerhalb der Geldvermögen geht aus
der Darstellung 34 hervor. In ihr sind die Milliardenbeträge in
Prozente umgerechnet und im Fünfjahresabstand eingetragen.
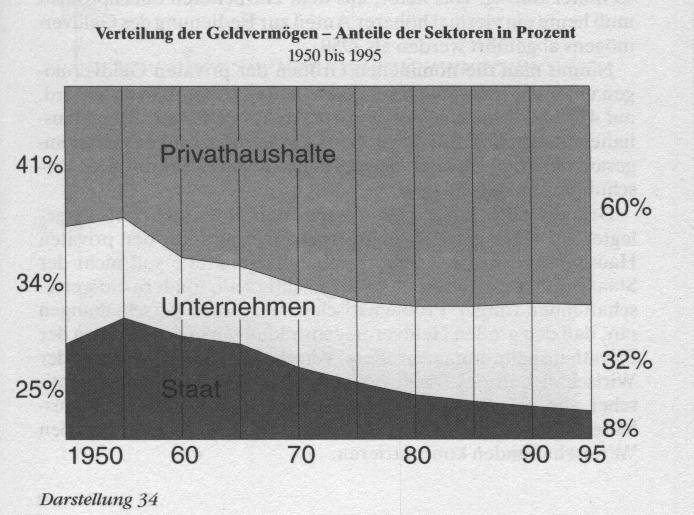
Darstellung 34
Der deutliche Anteilsanstieg bei den öffentlichen Haushalten
von 1950 bis 1955 dürfte weitgehend das Verdienst des ersten Fi-
nanzministers Schäffer gewesen sein. Sein aufgebauter „Julius-
turm“ erreichte 1955 35 Prozent der Geldvermögen. Von da an
ging es bergab, kontinuierlich auf acht Prozent im Jahre 1995.
Dieser Rückgang des Staatsanteils fand weitgehend zugunsten der
Privathaushalte statt. Der Korridor der Unternehmen blieb rela-
tiv konstant. Erst in den 80er Jahren konnte er leicht ausgeweitet
werden.
In Prozenten des BSP aufgetragen, wie in Darstellung 35, wird
die Verschiebung der Anteile innerhalb der Sektoren noch deut-
licher. Wie auch die Schulden, haben die Geldvermögen 1960 die
Größe des Sozialprodukts überstiegen.
Vergleicht man die Situation 1950 mit der von 1995, dann ka-
men zu Beginn der Entwicklung auf jede Mark Sozialprodukt rund
57 Pfennig Geldvermögen, die aus der Wirtschaftsleistung mit
Zinsen zu bedienen waren. 1995 war es mit 224 Pfennig ein viermal
so hoher Betrag. Das heißt, aus dem erarbeiteten Sozialprodukt
muß heute ein viermal höherer Anteil zur Bedienung des Geldver-
mögens abgeführt werden als 1950.
Nimmt man die nominellen Größen der privaten Geldvermö-
gen unter die Lupe, dann sind diese in den 45 Jahren von 25 Mrd.
auf 4648 Mrd. förmlich explodiert. Hier, bei den privaten Haus-
halten, haben sich also die großen Geldvermögensüberschüsse an-
gesammelt, die sich überwiegend in den anderen Sektoren als Ver-
schuldung niederschlagen.
Grundsätzlich könnte man sagen, daß diese mehrfach darge-
legte Verschiebung der Geldvermögen zugunsten der privaten
Haushalte positiv ist. Denn in einer Demokratie soll nicht der
Staat wohlhabend und damit übermächtig sein, sondern die werte-
schaffenden Bürger. Problematisch ist bei diesen Verschiebungen
nur, daß den großen Geldvermögensbildungen in den Händen der
Privathaushalte immer größere Verschuldungen im Bereich der
Wirtschaft und des Staates gegenüberstehen. Noch problemati-
scher aber ist, daß sich die Geldvermögen bei den Privathaus-
halten immer extremer verteilen und sich dabei keinesfalls bei den
Werteschaffenden konzentrieren.
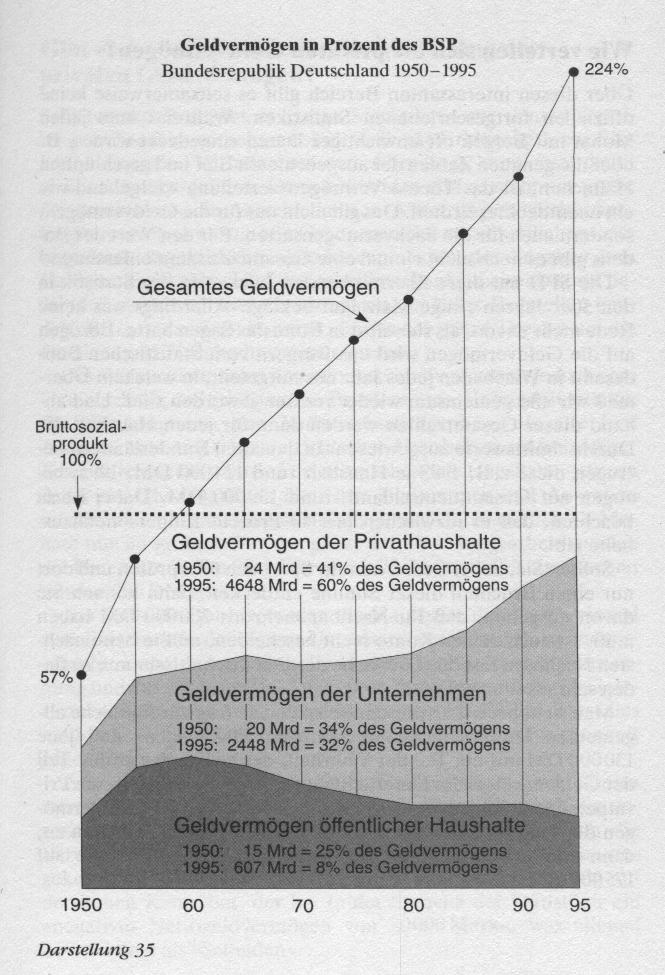
Wie verteilen sich die privaten Geldvermögen?
Über diesen interessanten Bereich gibt es seltsamerweise keine
offiziellen fortgeschriebenen Statistiken. Während man jeden
Monat mit Bergen oft unwichtiger Daten eingedeckt wird, z. B.
über die genauen Zahlen der ausgebrüteten Eier und geschlüpften
Hähnchen, ist das Thema Vermögensverteilung weitgehend wie
ein unentdeckter Erdteil. Das gilt nicht nur für die Geldvermögen,
sondern auch für die Sachvermögensarten. Für den Wert des Bo-
dens gibt es noch nicht einmal eine Gesamt-Zusammenfassung.
Die SPD hat diese überraschenden Lücken in der Statistik in
den 50er Jahren einige Male laut beklagt. Allerdings war keine
Rede mehr davon, als sie selbst in Bonn das Sagen hatte. Bezogen
auf die Geldvermögen wird uns Bürgern vom Statistischen Bun-
desamt in Wiesbaden jedes Jahr nur mitgeteilt, in welchem Über-
maß wir alle gemeinsam wieder reicher geworden sind. Und an-
hand dieser Gesamtzahlen werden dann für jeden Haushalt die
Durchschnittswerte ausgewiesen. In den alten Bundesländern be-
trugen diese z. B. 1993 je Haushalt rund 124 000 DM,1995, be-
zogen auf Gesamtdeutschland, rund 130 000 DM. Dabei ist zu
beachten, daß es inzwischen fast 40 Prozent Einpersonenhaus-
halte gibt.
Sollten Sie, lieber Leser, nun Ihr Sparbuch überprüfen und dort
nur einen Bruchteil dieser Summe entdecken, dann können Sie
davon ausgehen, daß Ihr Nachbar mehr als 200 000 DM haben
muß. Ist auch dessen Konto recht bescheiden, müßte beim näch-
sten Nachbarn fast das Dreifache der Durchschnittssumme zu fin-
den sein, usw.
Man sieht bereits an diesem Beispiel, wie fragwürdig solche all-
gemeinen Durchschnittsumrechnungen sind. Dabei sind jene
130 000 DM nur ein Teil der Wahrheit, denn auch der größte Teil
der Geldvermögen im Unternehmenssektor gehört wiederum Pri-
vatpersonen. Schlägt man von jenen 2448 Mrd. DM Geldvermö-
gen der Unternehmen nur zwei Drittel den Privathaushalten zu,
dann erhöht sich der Durchschnittsbetrag Ende 1995 sogar auf
175 000 DM.
Gibt es Anhaltspunkte für die Verteilung der privaten Geldvermögen?
Selbstverständlich gibt es einige Statistiken, aus denen Vertei-
lungsschlüssel zu entnehmen sind. Z. B. die Erklärungen zur Ein-
kommens- oder Vermögenssteuer. Allerdings kann man damit
nicht allzuviel anfangen. Denn bei beiden gibt es nicht nur große
Freigrenzen und die verschiedensten Absetzungsmöglichkeiten.
Es gibt vor allem allzugroße Grauzonen der versehentlichen oder
bewußten Vergeßlichkeit, gerade wenn es um die Angaben zum
Geldvermögen geht. Und das geheiligte Bankgeheimnis sorgt da-
für, daß es sich bei diesen Grauzonen um keine Bagatellen han-
delt. Wäre das anders, könnten wir uns das ganze Theater um die
Quellen- und Zinsabschlagsteuer sparen.
Der Wirklichkeit näher - zumindest relativ – kommt jedoch eine
Untersuchung des Statistischen Bundesamtes. Es handelt sich um
die „Einkommens- und Verbrauchsstichprobe“, die alle fünf
Jahre bei rund 45 000 bundesdeutschen Haushalten auf freiwilliger
Basis durchgeführt wird. Die mitmachenden Haushalte müssen
dabei ein Jahr lang Buch über ihre Einkommen und Ausgaben
führen, einen Monat lang akribisch genau, die restlichen elf Mo-
nate nur im groben. Für das ganze Jahr Buchungsarbeit wurden
die Haushalte in den 80er Jahren mit 70 DM entlohnt. Inzwischen
werden 200 DM geboten.
Am Ende des Jahres werden die Haushalte dann noch einmal
zum Einsammeln der letzten Unterlagen von ihrem Betreuer auf-
gesucht. Dabei befragt man die Haushalte - meist ohne Vorwar-
nung und auf die Schnelle - auch nach ihren wesentlichsten Geld-
vermögensarten und nach ihren Konsumentenschulden. Das alles
natürlich anonym und unter dem Siegel der Verschwiegenheit
gegenüber dem Finanzamt.
Aus den erfragten Größen der Geldvermögen und Konsu-
mentenschulden errechnet man dann für jeden Haushalt das so-
genannte „Nettogeldvermögen“, das „positiv“ heißt, wenn die
Vermögen die Schulden übersteigen, und „negativ“, wenn es um-
gekehrt ist. Wer also 20 000 DM Miese und keinen Pfennig auf
der hohen Kante hat, der hat in der Sprache der Statistiker ein
„negatives Nettogeldvermögen von 20 000 Mark“, was allemal
besser klingt als „Schulden“.
Was kann man diesen Stichprobenerhebungen entnehmen?
Bei der Stichprobenerhebung 1983 (die nachfolgenden Ergebnisse
wurden leider nicht so differenziert ausgewertet), hat man die so
ermittelten „Nettogeldvermögen“ nach ihren jeweiligen Anteilen
auf 26 Haushaltsgruppen verteilt. Danach hatten acht Prozent der
Privathaushalte ein „negatives Nettogeldvermögen“, also mehr
Schulden als Vermögen bzw. nur Schulden. Bei der „Spitzen-
gruppe“ der Schuldenmacher lag der Minussaldo bei 72 000 Mark.
Wohlgemerkt: nur für Konsumentenschulden! Also für Möbel
Reisen und natürlich die Autonachfrage, mit der wir die Konjunk-
tur (auf Pump) weiter anheizen.
Fünf Prozent aller Haushalte hatten nach der Auswertung einen
Nullsaldo, das heißt, sie hatten entweder soviel Schulden wie Ver-
mögen oder von beiden gar nichts. Die restlichen 87 Prozent der
Haushalte waren besser dran. Sie verfügten über ein „positives
Nettogeldvermögen“.
Trägt man die Verteilung einmal grafisch auf, wie in der Dar-
stellung 36 geschehen, dann werden die Unterschiede plastischer.
Dies trifft vor allem für die „positiven Nettogeldvermögen“ zu, die
anfangs nur sehr zögernd ansteigen. Dafür schießen sie gegen
Ende um so kräftiger in die Höhe, nämlich auf 341 000 DM in der
Spitzengruppe.
Teilt man einmal die gesamten Haushalte in zwei Hälften und
rechnet bei jeder Hälfte die gesamten Nettogeldvermögen zusam-
men, dann hat nach dieser Erhebung die ärmere Hälfte gerade
vier (!) Prozent des gesamten Geldvermögens in der Hand, die
andere Hälfte den „Rest“ von 96 Prozent. Dabei konzentriert sich
auch hier das Gros der gesamten Vermögen bei den letzten zehn
Prozent der Haushalte. Allerdings „verschönt“ diese Erhebung
die Wirklichkeit erheblich, da die Haushalte mit einem Monats-
einkommen von mehr als 25 000 Mark „außen vor“ gelassen wur-
den. Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes geschah das
wegen „statistischer Unsicherheiten“. Konkret: Aus dieser reich-
sten Gruppe der Haushalte hatten sich zu wenige zur Teilnahme
an der Erhebung bereit gefunden, was man verstehen kann. Denn
einmal sprechen diese Superreichen nicht gerne über ihr Vermö-
gen. Zum anderen dürfte sie ein Honorar von 200 DM kaum ver-
locken, zur Freude der Statistiker ein ganzes Jahr lang über alle
Einkommen und Ausgaben Buch zu führen. Entsprechend be-
wegt sich auch das Gesamtergebnis dieser Befragungen mit
504 Mrd. DM weit unter jenen 1842 Mrd., die von der Bundes-
bank für 1983 als private Geldvermögensbestände ausgewiesen
werden.
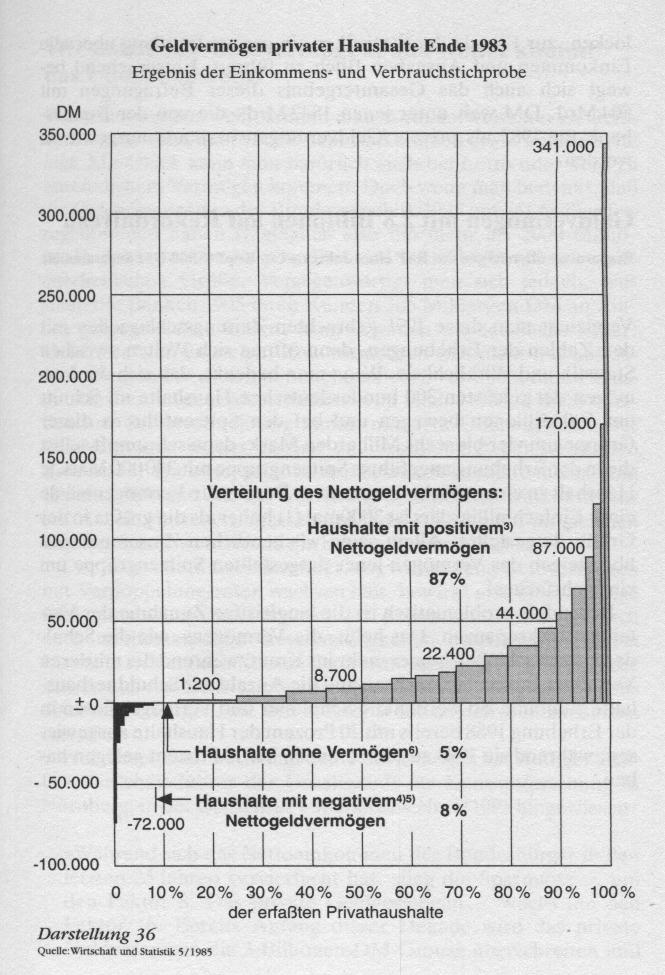
Geldvermögen mit 2,8 Billionen auf Rekordniveau
Ersparnisse übersteigen das BSP eines Jahres -
Pro Kopf 45 000 DM angesammelt
Vergleicht man diese 1991 gebrachten Zeitungsschlagzeilen mit
den Zahlen der Erhebungen, dann öffnen sich Welten zwischen
Statistik und Wirklichkeit. Wenn man bedenkt, daß sich die Ver-
mögen der reichsten 300 bundesdeutschen Haushalte im Schnitt
um 500 Millionen bewegen und bei den Spitzenführern dieser
Gruppe um vier bis sechs Milliarden Mark, dann schrumpft selbst
die in der Erhebung angeführte Spitzengruppe mit 340 000 Mark je
Haushalt zu einem Nichts zusammen: Bereits die Vermögenssäule
eines Einfachmilliardärs ist 3000mal (!) höher als die größte in der
Grafik dargestellte. Allein seine wöchentlichen Zinseinnahmen
übersteigen das Vermögen jener dargestellten Spitzengruppe um
ein Mehrfaches!
Besonders problematisch ist die langfristige Zunahme der Ver-
teilungsdiskrepanzen. Das heißt, die Vermögens- wie die Schul-
denspitzen schießen immer mehr ins Kraut, während die mittleren
Vermögen langsamer wachsen und die Anzahl der Schuldnerhaus-
halte zunimmt. So werden die Schuldner und Vermögenslosen in
der Erhebung 1988 bereits mit 20 Prozent der Haushalte ausgewie-
sen, während sie 1983 zusammen noch bei 13 Prozent gelegen ha-
ben.
Wie entstehen Geldvermögen, und woher kommt das Überwachstum?
Wie jeder von uns weiß, kommt man normalerweise nur zu Geld-
vermögen, wenn man von seinem Einkommen etwas auf die Seite
legt. Mit Glück kann man natürlich auch bei Lotto oder Toto zu
ansehnlichem Vermögen kommen. Doch wenn man bedenkt, daß
die Geldvermögen in der Bundesrepublik 1995 um 751 Milliarden
zugenommen haben (tagtäglich also um mehr als 2000 Millio-
nen!), dann werden die paar Dutzend Lotto-Millionäre zu einer
unerheblichen Größe. Vergegenwärtigt man sich jedoch, daß
allein die Banken 1995 ihren Kunden 365 Milliarden DM an Zin-
sen gutgeschrieben haben, dann kommen wir der Sache näher:
Geldvermögen entstehen bzw. vermehren sich nicht nur aus zu-
rückgelegten Arbeitseinkommen, sondern vor allem durch Zins-
gutschriften, also gewissermaßen „von alleine“! Und diese wun-
dersame Selbstvermehrung nimmt mit dem Überwachstum der
Geldvermögen immer rascher zu, beschleunigt bei steigenden
Zinssätzen. Da aber auch in der besten Wirtschaft nichts vom
Himmel fällt und alle zur Verteilung kommenden Einkünfte nur
aus Arbeit entstehen, müssen die Arbeitsleistenden im gleichen
Umfang ärmer werden wie die bereits Reichen reicher.
Der Zins- und Zinseszinseffekt, der vorhandene Geldvermögen
mit Verdoppelungsraten wachsen läßt, bewirkt also eine ständige
Einkommensumschichtung von der Arbeit zum Besitz, die sich
nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten beschleunigt. Dabei
sammeln sich auf den Konten der Vermögensbesitzer nicht nur die
Zinsen aus den Geldvermögen an, sondern auch die Renditen aus
den Sachvermögen, die sich in ihrer Höhe an den Geldzinssätzen
orientieren.
Auf dieses Überwachstum der Geldvermögen hat Rüdiger Szal-
lies, Geschäftsführer der Gesellschaft für Konsumforschung in
Nürnberg, in der Zeitschrift „Sparkasse“ Nr. 4/ 1991 hingewiesen:
„Während sich das Nettoeinkommen der Bundesbürger in den
letzten 25 Jahren vervierfacht hat, stieg die Sparquote. . . um
den Faktor 8. Das private Geldvermögen. . . wuchs um den
Faktor 16. Bereits Anfang dieser Dekade wird das private
Geldvermögen die 3-Billionen-DM-Grenze überschreiten und
sich bis zum Jahr 2000 auf ca. 5 Billionen DM hinaufkatapultiert
haben.“
Da die Geldvermögensbesitzer ihre Zinserträge nur zu einem ge-
ringen Teil selbst ausgeben oder investieren, können sie nur über
Kredite in den Kreislauf zurückgeschleust werden. Diese Zurück-
schleusungen sind jedoch wieder mit Zinsen verbunden, die dieje-
nigen aufbringen müssen, die bereits zuwenig Geld hatten und es
sich leihen mußten. Die Folgen sind ein weiteres beschleunigtes
Geldvermögenswachstum und ein entsprechend vergrößerter er-
neuter Verschuldungszwang. Diese sich selbst nährende Problem-
entwicklung macht die Schemadarstellung 37 deutlich.
Ursache dieses Dilemmas sind die Wirkungsmechanismen un-
seres Geldes, die einer positiven Rückkoppelung entsprechen.
Positiv rückgekoppelte Systeme aber sind aus einfachen mathe-
matischen Gründen immer zum Zusammenbruch verurteilt.
Was sagt die Wissenschaft zur Überentwicklung der Geldvermögen?
Während die Geldvermögensexplosion und -konzentration in den
Schlagzeilen der Printmedien ab und zu Spuren hinterläßt, ist das
Ganze für die Wissenschaft kein Thema. Allenfalls einige Außen-
seiter streifen es einmal. So z. B. der US-Ökonom Ravi Batra, der
sich mit seinem Titel „Die große Rezession von 1990“ aufs Pro-
gnose-Glatteis wagte. Doch er weist darin zumindest einmal auf
die zunehmenden Reichtumskonzentrationen als Auslöser ökoso-
zialer Spannungen und damit einer möglichen Krise hin:
„Nach einem Bericht der "New York Times" hat sich die Zahl
der Milliardäre in den Vereinigten Staaten im Jahre 1986 von 14
auf 26 erhöht und damit innerhalb eines Jahres nahezu verdop-
pelt. Sie nehmen damit einen immer größeren Anteil des Volks-
einkommens auf Kosten der Armen für sich in Anspruch.
Von den superreichen Amerikanern verfügen fünf Prozent
über mehr Einkommen als 40 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Und unter den Allerreichsten der Reichen verfügt ein Prozent
über ein größeres Vermögen als 90 Prozent der Bevölkerung.“
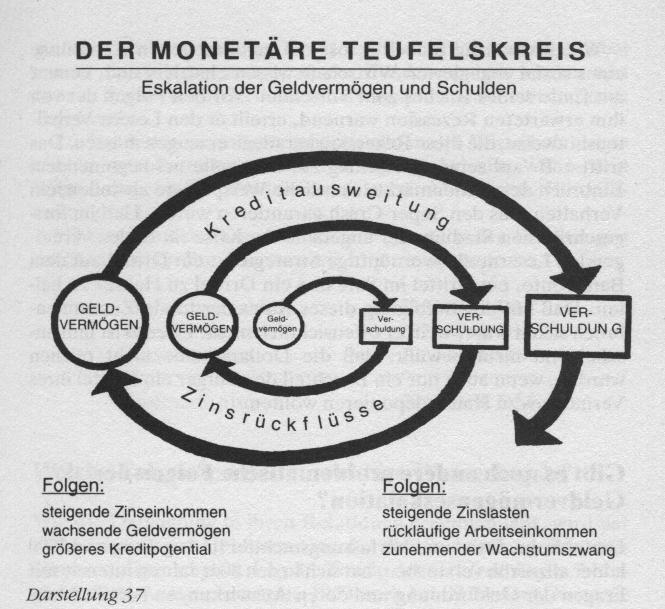
Darstellung 37
Von den wesentlichsten Ursachen und Folgen dieser Vermögens-
konzentration, nämlich den immer größeren Zinsströmen, ist al-
lerdings auch bei Batra nicht die Rede. Vielmehr macht er als
Hauptgrund für die Reichtumszunahme die Steuergesetze aus.
Und als Auslöser für die Krise sieht er den Tatbestand der
wachsenden Bankrisiken, die mit dem zunehmenden „Geldauf-
nahmebedürfnis der unteren und mittleren Einkommensgrup-
pen“ verbunden sind: „Je höher die Vermögenskonzentration ist,
desto höher ist auch die Zahl der potentiellen Bankzusammen-
brüche.“ Bei diesen Erklärungen stützt er sich vor allem auf die
Entwicklung der späten 20er Jahre in den USA, in denen - nach
seinen Untersuchungen - ähnlich große Vermögensdiskrepanzen
entstanden waren wie in unserer Zeit.
Wie fragwürdig jedoch selbst die geldbezogenen Kenntnisse
eines sozial engagierten Wirtschaftswissenschaftlers sind, kommt
am Ende seines Buches zum Vorschein. Vor den Folgen der von
ihm erwarteten Rezession warnend, erteilt er den Lesern Verhal-
tenshinweise, die diese Rezession geradezu erzeugen müssen. Das
trifft z. B. auf seinen Vorschlag zu, man solle bei beginnendem
Einbruch der Aktienmärkte sämtliche Wertpapiere abstoßen, ein
Verhalten, das den Super-Crash garantieren würde. Und im fort-
geschrittenen Stadium der angelaufenen Krise rät er den vermö-
genden Lesern, als „vernünftige Strategie. . . ein Drittel auf dem
Bankkonto, ein Drittel im Safe und ein Drittel zu Hause“ zu hal-
ten. Daß mit der Befolgung dieses Rates der totale Zusammen-
bruch sicher wäre, weiß er offensichtlich nicht. Ebenso ist ihm an-
scheinend nicht bewußt, daß die Dollarscheine nicht reichen
würden, wenn auch nur ein Bruchteil der Bürger ein Drittel ihres
Vermögens zu Hause deponieren wollten.
Gibt es noch andere problematische Folgen der Geldvermögenseskalation?
Dieter Suhr, Jurist und Verfassungsrechtler in Augsburg und 1990
leider allzufrüh verstorben, hat sich in den 80er Jahren intensiv mit
Fragen der Geldordnung und deren Auswirkungen befaßt. Mehr
als ein halbes Dutzend Bücher auf wissenschaftlichem Niveau ge-
ben davon Zeugnis. Auch wenn die Wirtschaftswissenschaft ihn
bislang „übersehen“ und niemand sich zu einer Rezension oder
kritischen Prüfung seiner Veröffentlichungen bereit gefunden hat,
wird man an seinen Untersuchungen nicht vorbeigehen können.
Bezogen auf die Überentwicklung der Geldvermögen hat Die-
ter Suhr einmal den Begriff des „monetären Wasserkopfs“ ge-
prägt, dessen Größe den „Wirtschaftskörper“ immer mehr bela-
stet. Diese Problematik des Überwachstums läßt sich jedoch nicht
nur an der zurückbleibenden Entwicklung der Leistungsgrößen
festmachen. Sie kann auch verdeutlicht werden an der Diskrepanz
zwischen der Entwicklung der Geldvermögen und der mit ihrer
Hilfe geschaffenen Sachvermögenswerte.
In der Darstellung 38 sind diese relativen Verschiebungen zwi-
schen Geld- und Sachvermögen für die Jahre 1950, 1970 und 1990
grafisch sichtbar gemacht. Die „Körper“ der Figuren geben dabei
jeweils die Anlagevermögen in der Bundesrepublik wieder, und
zwar zu ihrem Netto-Wiederbeschaffungspreis, das heißt zu ihrem
Tageswert.
Zu den Anlagevermögen gehören alle in der Wirtschaft einge-
setzten reproduzierbaren Sachvermögen, also alle Wohn- und
Wirtschaftsgebäude, Produktionsanlagen, Maschinen, Büroein-
richtungen usw.
1990 setzten sich diese Anlagevermögen nach den Erfassungen
des Statistischen Bundesamtes wie folgt zusammen:
| Wohnungsbauten: |
3353 Mrd. DM |
| sonstige Bauten: |
2426 Mrd. DM |
| Ausrüstungen: |
1263 Mrd. DM |
| insgesamt also: |
7042 Mrd. DM |
Welche Folgen hat der „monetäre Wasserkopf“?
Wie die Darstellung in ihren Relationen erkennen läßt, wird der
„Wasserkopf“ der Geldvermögen für den Sachvermögenskörper
immer weniger tragbar. Lag die Größe der Geldvermögen, bezo-
gen auf die Anlagevermögen, 1950 noch bei 32 Prozent, hatte sie
1970 bereits 52 Prozent erreicht und 1990 69 Prozent.
Die Problematik dieser Überentwicklung wird vor allem klar,
wenn man sich vergegenwärtigt, daß den Geldvermögen entspre-
chende Verschuldungen gegenüberstehen. Diese Verschuldungen
erfahren ihre Deckung und Absicherung aber alleine durch die mit
ihrer Hilfe geschaffenen Sachwerte. Da diese aber seit 1950 „nur“
auf das 38fache angestiegen sind, die Geldvermögen jedoch auf
das 82fache, steigt der Verschuldungsgrad der Sachvermögen im-
mer mehr an.
1950 entsprachen die Schulden gut einem Drittel der Anlage-
vermögen.1970 lagen sie bereits bei der Hälfte, und 1990 hatten
sie drei Fünftel der Sachwerte bereits überschritten. Nimmt man
einmal an, daß sich diese Entwicklung fortsetzt, dann läge der
Verschuldungsgrad im Jahr 2010 bei 75 Prozent und im Jahr 2030
bei 88 Prozent. Das heißt, die in der Wirtschaft eingesetzten Sach-
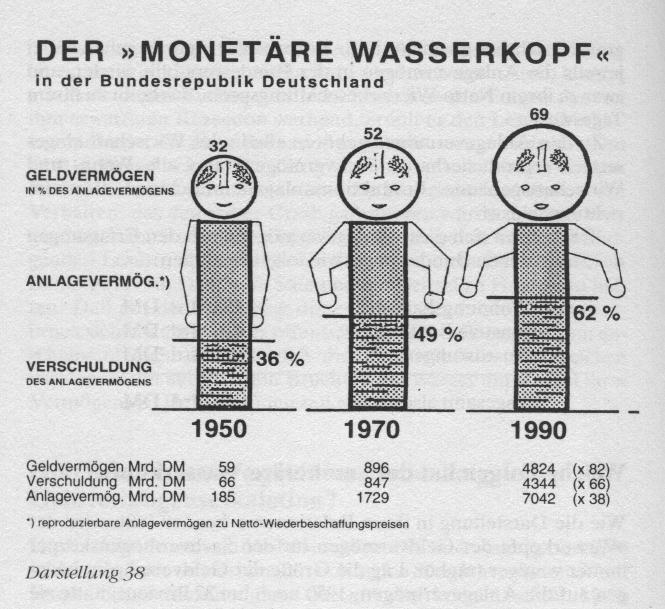
vermögen „versinken“ immer mehr in Schulden. Mit der zuneh-
menden Verschuldung nimmt jedoch nicht nur die Unsicherheit
für die Geldgeber zu, sondern auch die Konkursanfälligkeit für die
Sachvermögensbesitzer. Schon bei geringen Zinserhöhungen
und/oder Konjunktureinbrüchen werden die Unternehmen
Opfer ihrer nicht mehr zu bedienenden Schulden. Und wenn eines
Tages die Banken die Risiken nicht mehr auffangen können und
dem Staat nur noch die Flucht in eine inflationäre Geldvermeh-
rung übrigbleibt, dann werden schließlich auch die Geldbesitzer
Opfer ihres Vermögens-Überwachstums.
Der in Aachen lehrende Ökonom Karl-Georg Zinn hat diese
Entwicklung im „Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik
1986“ einmal angesprochen:
„Die Wachstumsrate des Geldvermögens der privaten Haus-
halte der Bundesrepublik betrug seit 1980 im Jahresdurch-
schnitt über 12 %. Entsprechend hoch lag auch der Anstieg der
Zinseinkommen, damit war eine starke Zunahme der Zinsein-
kommensquote verbunden. Diese Entwicklung wirft die Frage
auf, wie lange sich die Zunahme des Zinseinkommensanteils
fortsetzen kann und welche Konsequenzen für Inflation und
Beschäftigung aus dem Zinsquotenanstieg resultieren. Da die
starke Geldvermögensbildung nicht mit einem entsprechenden
Zuwachs des Realvermögens verbunden war. . ., stellt sich wei-
terhin das Problem einer möglichen (wachsenden) Diskrepanz
von Geld- und Realvermögensbeständen.“
[ Inhalt
Geldsyndrom ] [ Homepage
www.geldreform.de ] [ Gästebuch
www.geldreform.de ]
Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,
1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4
Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Mit Zustimmung des Autors digitalisiert für INWO
Deutschland e.V.