Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,
1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4
Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
[ Inhalt
Geldsyndrom ] [ Homepage
www.geldreform.de ]
[ Gästebuch
www.geldreform.de ]
11. Kapitel
Die „Geldschöpfung“ der Banken
"Es kann an sich kaum bezweifelt werden,
daß das Banksystem insgesamt keine grö-
ßere Geldmenge schaffen kann, als mit der
von der Zentralbank geschaffenen Zentral-
bankgeldmenge vereinbar ist.“
Deutsche Bundesbank, Juli 1971
Können Banken Geld schöpfen?
In fast allen Lehrbüchern kann man heute noch lesen, daß die
Banken an der „Geldschöpfung“ beteiligt sind. Daß damit keine
Herstellung von Geldscheinen oder Münzen gemeint sein kann,
ist klar, dazu sind nur die Notenbanken berechtigt. Wahrschein-
lich ist mit dieser Aussage also „Kreditschöpfung“ gemeint. Wird
darunter das Umschöpfen von Kaufkraft aus dem Einlage- in den
Kredittopf verstanden, dann kann man diese Formulierung akzep-
tieren. In den meisten Lehrbüchern wird der Vorgang jedoch so
dargestellt, als ob die Banken auch ohne Einlagen der Sparer bzw.
darüber hinaus Kredite schöpfen könnten. Ja, in vielen Beschrei-
bungen sind diese Einlagen gar nicht existent. Sie sehen immer nur
den „Bankausgang“, aus dem laufend neue und immer größere
Kredite herauskommen, ohne den „Bankeingang“ zu beachten, in
den die Sparer ihre Überschüsse einbringen.
Andere sagen, daß geschöpfte Kredite problemlos wären, weil
sie irgendwann auch wieder zu einer Einlage würden, womit sich
die Schöpfung gewissermaßen selbst ausgleicht. Diese Argumen-
tation ist so überzeugend wie die eines Geschäftsmannes, der rei-
nen Gewissens Falschgeld produziert, weil irgendwann die Kun-
den mit dem Falschgeld auch wieder in seinem Laden einkaufen
werden. Daß mit beiden Schöpfungen - dem Falschgeld wie den
Krediten ohne Ersparnis - das Nachfragepotential ungedeckt ver-
mehrt wird, dürfte einsichtig sein. Denn nur Kredite, die aus lei-
stungsbezogenen Ersparnissen stammen, sind durch reale Gegen-
werte gedeckt. Wenn also die Banken tatsächlich ohne Spareinla-
gen Kredite schöpfen, ist das genauso ein Fall für den Staatsanwalt
wie die Inumlaufsetzung von Falschgeld.
Gibt es Beweise für diese Geld- oder Kreditschöpfung?
Wer die jährlichen Ergebnisse örtlicher Banken überprüft, wird
fast immer feststellen, daß die Einlagen der Kunden die Kreditge-
währungen übersteigen. Die daraus resultierenden Überschüsse
werden entweder in Wertpapieren angelegt oder fließen anderen
Banken, vor allem Hypothekenbanken zu, die selbst keine Spa-
rerkunden haben. In den Bilanzen der einzelnen Banken wie des
gesamten Bankenapparates sind selbstverständlich Passiva und
Aktiva - wie bei allen Bilanzen - ausgeglichen. Eine Bank, die
mehr ausgeliehen als an Mitteln erhalten hat, ist jedoch nirgendwo
zu finden. Auch der Präsident der Landeszentralbank in Baden-
Württemberg, Guntram Palm, bestätigte, bezogen auf die Kredit-
aufnahme des Staates, in der Stuttgarter Zeitung vom 13. Novem-
ber 1992 noch einmal diesen Sachverhalt: „Die zur Abdeckung
der öffentlichen Defizite benötigten Mittel werden von den in-
und ausländischen Sparern... bereitgestellt.“ Und der Wirt-
schaftsjournalist Franz Thoma schreibt in der Süddeutschen Zei-
tung vom gleichen Tag: „. . . das Geld, das Banken über Anleihen
kreditieren. . . stammt vom Bürger. Würde er nicht sparen, wäre
zum Verleihen nichts da. Dann bliebe nur noch der Druck von
Banknoten. Und das führte in finanziellen Ruin.“
Den „Beweis“ für die „Geldschöpfung“ der Banken kann man
also wieder nur in Lehrbüchern entdecken, ungeprüft weitergege-
ben von Ausgabe zu Ausgabe. Ähnlich wie vor einigen Jahrzehn-
ten die Theorie von der notwendigen Golddeckung für alle Wäh-
rungen noch in den Lehrbüchern zu finden war, als die Praxis
längst ohne sie funktionierte. Der Geldschöpfungsbeweis in den
Lehrbüchern ist sogar in mathemtatische Formeln gekleidet, was
einer Theorie offensichtlich auch dann das nötige Gewicht ver-
leiht, wenn sie in der Wirklichkeit keine Bestätigung findet.
Kurz: Nach der Theorie sind die Geldschöpfungsmöglichkeiten
der Banken im Prinzip unbegrenzt. Eingeschränkt werden sie le-
diglich durch die Kassenhaltung und die Mindestreserven, die von
den Banken in den meisten Ländern bei den Notenbanken gehal-
ten werden müssen. Auch das wird mathematisch exakt vorge-
rechnet: Liegen diese Rücklagen insgesamt bei fünf Prozent, dann
können die Banken aus einer Einlage das l9fache an Kredit schöp-
fen, bei Rücklagen von zehn Prozent das Neunfache und bei einer
Rücklage von 20 Prozent nur das vierfache, also immer reziprok
zu den Reserven der Banken.
Wie läßt sich die Geldschöpfungstheorie erklären?
Sehen wir uns in Darstellung 21 noch einmal das Kreislaufmodell
an mit den monatlichen Ersparnisbildungen und Kreditgewährun-
gen (vgl. Darstellung 5, 3. Kapitel). Statt der sich akkumulieren-
den Guthaben- und Kreditbestände sind im unteren Teil der Dar-
stellung 21 die bei jedem Einkommensumlauf hinzukommenden
Beträge eingesetzt, zusätzlich dazwischen eine Buchungsreihe mit
den Reservebildungen der Bank in Höhe von jeweils zehn Prozent
der Neuersparnis.
Da die im ersten Umlauf bei der Bank eingehende Geldeinzah-
lung hier mit 20 Geldeinheiten (GE) eingesetzt ist, ergibt sich eine
Rückhaltung in der Reserve von 2 GE und eine Ausleihung von 18
GE. (Auf den Tatbestand, daß aufgrund dieser Reservehaltungen
die reale Nachfrage nach dem ersten Umlauf auf 98 und nach dem
fünften bereits auf rund 92 GE zurückgeht, soll hier nicht weiter
eingegangen werden.)
Wichtig für die Geldschöpfungsfrage ist nun, daß sich die aus
den Krediten ergebenden rücklaufenden Guthabenbuchungen,
entsprechend den sich ansammelnden Geldeinheiten in der Bank-
reserve, mit jedem Umlauf um zehn Prozent verringern, während
die direkte Nachfrage mit 80 Prozent der Einkommen konstant
bleibt. Als Folge dieser ständigen (wenn auch kleiner werdenden)
Reduzierungen müssen schließlich irgendwann alle Postenzu-
gänge bei der Bank bei null enden. Zählt man dann die in der
Reserve angesammelten Geldeinheiten zusammen, kommt man
auf 20 GE, also genau den Betrag, der als Ersteinzahlung bei der
Bank eingegangen war. Die Addition der Einzahlungs- bzw. Gut-
habenbeträge ergibt eine Summe von 200 GE, die der Auszah-
lungs- bzw Kreditbeträge 180 GE. Damit scheint die „multiple
Geldschöpfung“ bewiesen, denn bei einer Reservehaltung von
zehn Prozent wurden nach x Umläufen die Kredite auf das Neun-
fache der Ersteinlage ausgeweitet!
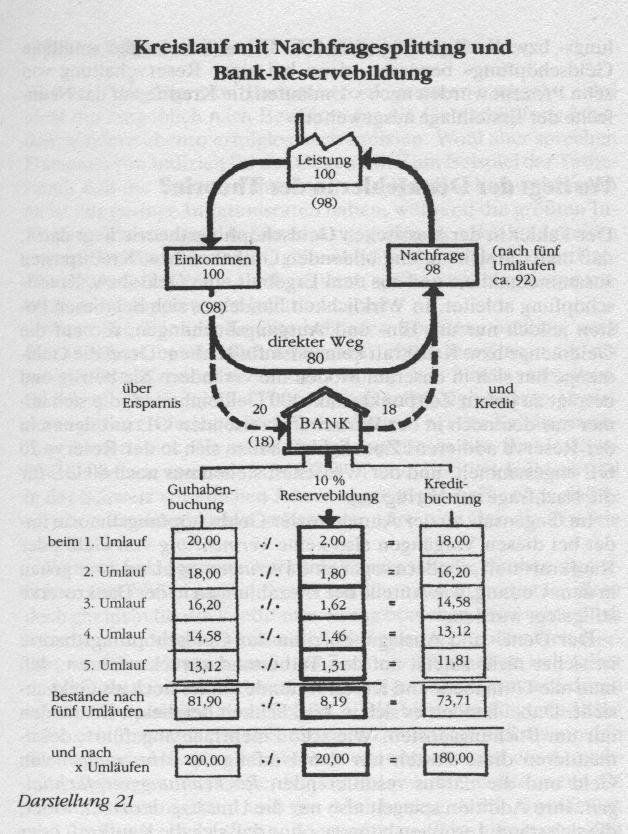
Wo liegt der Denkfehler in der Theorie?
Der Fehler in der klassischen Geldschöpfungstheorie liegt darin,
daß man die sich laufend bildenden Guthaben bzw. Kreditposten
zusammenaddiert und aus dem Ergebnis eine Geld- bzw. Kredit-
schöpfung ableitet. In Wirklichkeit handelt es sich bei diesen Po-
sten jedoch nur um Ein- und Ausgangsbuchungen, die auf die
Geldmenge bzw. Kaufkraft keinen Einfluß haben. Denn die Geld-
menge hat sich in unserem Modell nie verändert. Sie betrug und
beträgt zu jedem Zeitpunkt exakt 100 Geldeinheiten, die sich im-
mer aus den noch in der Wirtschaft kreisenden GE mit denen in
der Reserve addieren! Zum Schluß haben sich in der Reserve 20
GE angesammelt, und der Wirtschaft stehen nur noch 80 GE für
die Nachfrage zur Verfügung.
Im Gegensatz zu der Annahme der Geldschöpfungstheorie fin-
det bei diesen Vorgängen also keine Vermehrung von Geld oder
Kaufkraft statt, sondern sogar eine Verringerung! Und zwar genau
in dem Umfang, wie Anteile der Einzahlungen in der Bankreserve
stillgelegt wurden.
Der Denk- und Auslegungsirrtum der Geldschöpfungstheorie
ist sicher nicht zuletzt auf den Tatbestand zurückzuführen, daß
man alle Guthaben- und Kreditbestände immer noch als Geld an-
sieht. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit bei diesen Beständen
nur um Buchungsposten. Wie schon mehrfach angeführt, doku-
mentieren diese Posten nur den Umfang der Abtretungen von
Geld und die daraus resultierenden Rückzahlungsverpflichtun-
gen. Ihre Addition spiegelt also nur die Umsätze der Bank wider,
die sich ständig erhöhen können, ohne daß sich die Kaufkraft oder
die Geldmenge vergrößern.
Gibt es Indizien für die Geldschöpfung?
Wer den Vorgängen im Bankenbereich genauer nachgeht, wird
nicht nur vergeblich nach Beweisen für die Geldschöpfung fahn-
den, sondern ebenso erfolglos nach Indizien. Wohl aber sprechen
Dutzende von Indizien für das Gegenteil. Zum Beispiel der Tatbe-
stand, daß die Industrieländer trotz riesiger Kreditgewährungen
meist nur geringe Inflationsraten haben, während die größten In-
flationen überwiegend in Ländern mit geringeren Banktätigkeiten
anzutreffen sind. Das heißt, gäbe es bei uns eine Geld- oder Kre-
ditschöpfung durch die Banken, dann müßten wir längst eine tra-
bende bis galoppierende Inflation haben.
Wenn die Banken Kredite schöpfen könnten, müßten auch
ihre Gewinne beträchtlich höher sein, da ja die Zinsen für die
geschöpften Kredite in vollem Umfang bei ihnen verbleiben.
Weiter spricht gegen die Theorie, daß selbst signifikante Verän-
derungen der Mindestreserve keine Spuren bei der Kreditgewäh-
rung hinterlassen. So wurde beispielsweise in der Bundesrepu-
blik die Mindestreserve von 1973-81 und 1993-94 halbiert und
in der Schweiz vor etlichen Jahren sogar abgeschafft, ohne daß es
zu jener Kreditexplosion gekommen wäre, von der die Theorie
ausgeht.
Weiter könnte man auch fragen, warum sich die Banken eigent-
lich so viel Mühe um die Sparerkunden machen, wenn sie diese
doch gar nicht für die Kreditausweitung brauchen. Und schließlich
wäre noch zu fragen, warum die US-Regierung in aller Welt Kre-
dite zusammenkratzen muß, wo doch die US-Banken sich selbst
und der ganzen Nation einen Gefallen täten, die Etatlücken durch
eigene Schöpfungen zu schließen. - Die Liste der Gegenindizien
ließe sich fortsetzen. So z. B. mit dem Tatbestand, daß man in den
50er Jahren auch dann oft Wochen oder Monate auf die Auszah-
lung zugesagter erststelliger Hypotheken warten mußte, wenn die
Restfinanzierung stand und die Absicherung durch Grundstück
und Rohbau gegeben war. Begründung: „Wir haben zur Zeit
keine Mittel.“ - Offensichtlich wußten die Banken damals noch
nichts von ihrer „Schöpfungsfähigkeit“. Sie waren noch auf neue
Einlagen, rücklaufende Kredite oder die Überlassung von Über-
schüssen anderer Banken angewiesen. Heute „schwimmen“ die
Banken eher in Geld und haben Schwierigkeiten, seriöse Kredit-
nehmer zu finden. Doch das ist nicht die Folge von „Geldschöp-
fungen“, sondern die der Guthabeneskalationen, bedingt vor al-
lem durch den Zinseszinseffekt.
Haben die hohen Sichtguthaben mit Schöpfung zu tun?
Die Sichtguthaben in der BRD waren Ende 1993 mit rund 514
Mrd. DM etwa 2.5 mal so hoch wie die von der Bundesbank her-
ausgegebene Bargeldmenge. Das - so wird häufig angenommen-
könne nur auf Geldschöpfungen der Banken zurückzuführen sein.
In Wirklichkeit spiegeln sich in beiden Größen jedoch nur die
Zahlungsgewohnheiten in unserer Wirtschaft wider, genauer: der
Bedarf an liquiden Zahlungs- bzw. Verrechnungsmitteln. Wenn
„morgen“ aufgrund der codierten Scheck- und Kreditkarten die
bargeldlosen Zahlungen zunehmen, werden die Wirtschaftsteil-
nehmer ihre Geldbestände zugunsten erhöhter Sichtguthaben
noch weiter reduzieren. Das heißt, sie zahlen das nicht mehr benö-
tigte Bargeld auf ihre Sichtguthaben ein. Sowenig aber wie in die-
sem Fall die Banken etwas „schöpfen“, sowenig war das in der
Vergangenheit der Fall.
Im übrigen lagen die Sichtguthaben von 1970 bis 1989 - von
zwischenzeitlichen Schwankungen abgesehen - ziemlich konstant
beim Doppelten der Bargeldmenge, während sie in den 50er und
60er Jahren relativ zugenommen hatten. Grund für diesen Anstieg
war die Umstellung der Lohnzahlungen von bar auf unbar in die-
ser Zeit. Auch hier gab es keine Schöpfungstätigkeit der Banken.
Vielmehr wurden mit der Aufstockung der Sichtguthaben die Bar-
geldbestände abgebaut, sogar relativ mehr, als die Sichtguthaben
zunahmen, was auf deren größere Umschlagshäufigkeit zurückzu-
führen ist.
[ Inhalt
Geldsyndrom ] [ Homepage
www.geldreform.de ] [ Gästebuch
www.geldreform.de ]
Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,
1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4
Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Mit Zustimmung des Autors digitalisiert für INWO
Deutschland e.V.