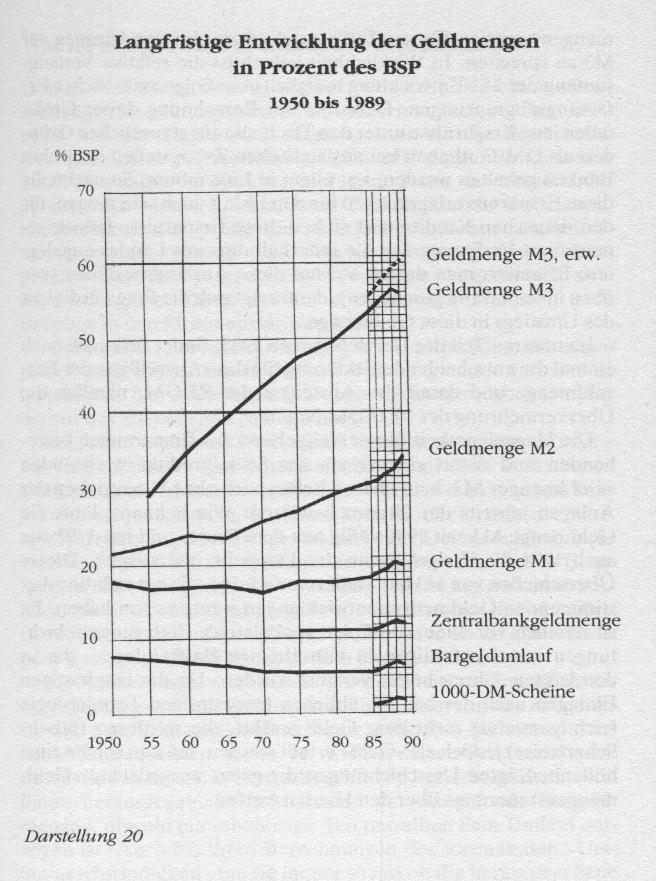Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,
1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4
Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
[ Inhalt
Geldsyndrom ] [ Homepage
www.geldreform.de ]
[ Gästebuch
www.geldreform.de ]
10. Kapitel
Das Dilemma der Geldmengensteuerung
„Ich möchte bekennen, daß mich die prakti-
schen Ergebnisse der Geldmengensteuerung
sehr enttäuscht haben... In der Theorie
besteht weiter Einigkeit darüber, daß die
Geldmenge allein noch nicht alles besagt,
sondern es sehr auch auf die jeweilige Um-
laufgeschwindigkeit des Geldes ankommt.
Diese entzieht sich aber bisher einer ge-
nauen Berechnung. Bei der Berechnung der
zulässigen Geldmengenvermehrung wird
die Umlaufgeschwindigkeit... mehr oder
weniger geschätzt. Es fehlt also in der Praxis
letztlich an einer exakten Geldmengenbe-
rechnung.“
Karl Klasen *
* Ehemaliger Präsident der Bundesbank, „Die Welt“ vom 3.10.1983
Zweifellos haben die Notenbanken in diesem Jahrhundert viel da-
zugelernt. Leider jedoch immer erst nach großen Opfern für die
Bürger. 1923, in der Hyperinflation, mußte die Bevölkerung das
Lehrgeld mit dem Verlust ihrer gesamten Ersparnisse bezahlen,
Millionen sogar mit ihrer Existenz.
Kaum zehn Jahre später saß die Reichsbank erneut in einer
hoffnungslosen Falle, diesmal in einer des Geldmangels. Zwar
hatte man die Gefährlichkeit inflationärer Überentwicklungen be-
griffen, nicht aber die noch größere der deflationären Geldmen-
genverringerungen. Den Lernprozeß, daß man die Geldmenge
alleine an die Wirtschaftsleistung binden darf und nicht an das
Gold im Keller, bezahlten sechs Millionen Menschen mit Arbeits-
losigkeit und bitterer Not.
„All die unglückseligen Ereignisse, die Reichtum und Glück
auf der ganzen Welt so empfindlich getroffen haben, sind den
Leitern der Notenbanken anzukreiden“,
schrieb damals John Maynard Keynes. Und vielleicht muß man
sogar die 50 Mio. Toten des Zweiten Weltkrieges auf das Konto
unzulänglicher Kenntnisse der Reichsbanker verbuchen. Denn
ohne die große Deflation wäre uns der Aufstieg Hitlers
höchstwahrscheinlich erspart geblieben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Lernprozeß im nachhin-
ein weiter: Falsche festgeschriebene DM-Dollar-Wechselkurse
führten zur Bereicherung anderer Länder auf unsere Kosten. Die
Folge des Billigeinkaufs bei uns führte zu einem Exportboom,
dem man nur mit dem Import von zwei Millionen Gastarbeitern
nachkommen konnte. Da die exportüberschußbedingten Dollar-
zuflüsse außerdem in DM umgewandelt werden mußten, be-
scherte uns der falsche Wechselkurs eine laufend zunehmende In-
flation. Denn das Einfangen der zuviel gedruckten Scheine war
weitaus schwieriger als ihre Inumlaufsetzung.
Auch die Gefährlichkeit dieser noch relativ geringen Inflations-
raten - lange Zeit von vielen Fachleuten als Wirtschaftsstimulans
gesehen - hat man erst begriffen, als die inflationären Zinsauf-
triebe die Konjunktur mehrmals in die Knie zwangen.
Gibt es auch in unseren Tagen Lernbedarf ?
Auch heute stehen die Notenbanken immer noch vor Schwierig-
keiten. Vor allem vor dem Problem, die Geldmenge kaufkraft-
und konjunkturstabil zu steuern. Die Schwierigkeiten dabei fan-
gen mit dem Dilemma an, daß man die Menge einer Sache steuern
möchte, unter der bislang jeder etwas anderes versteht. So kann
man noch im Monatsbericht der Bundesbank vom Januar 1992
lesen:
„Da Geld nicht eindeutig und einheitlich definiert ist, gibt es
analog dazu auch verschiedene Abgrenzungen für die Geld-
menge.“
Machen wir uns das ganze Dilemma der heutigen Gegebenheiten
an einem Beispiel klar:
Wenn ein Autofahrer die Aufgabe hat, die Geschwindigkeit
eines Wagens stabil zu halten, dann braucht er lediglich den Ta-
chostand zu beobachten: Sinkt die Tachonadel unter die einzuhal-
tende Marke, dann führt er dem Motor über den Gashebel mehr
Treibstoff zu. Schlägt die Tachonadel nach oben aus, drosselt er
die Zufuhr. Über die „richtige“ Treibstoffmenge braucht sich der
Fahrer keine Gedanken zu machen: Hält er die vorgegebene Ge-
schwindigkeit ein, dann ist die zugeführte Treibstoffmenge auto-
matisch optimal dosiert.
Würde der Autofahrer die Geschwindigkeit über eine festge-
legte Treibstoffmenge stabilisieren wollen, dann müßte er diese
im voraus errechnen und sich beim Fahren daran orientieren.
Doch auch dann, wenn er Steigungen, Gefälle und Windverhält-
nisse auf der zurückzulegenden Strecke kennen und bei der Vor-
ausberechnung einbeziehen würde, dürfte die Geschwindigkeit
allenfalls einmal zufällig dem gewünschten Maß entsprechen.
Geradezu unmöglich wäre für den Fahrer jedoch die Einhaltung
einer bestimmten Geschwindigkeit, wenn ein Dritter während der
Fahrt die Treibstoffzufuhr beeinflussen könnte. Das heißt, wenn
irgend jemand die Möglichkeit hätte, jeweilige Entscheidungen
des Fahrers durch Entzug oder Zuführung von Treibstoff zu kon-
terkarieren.
Nehmen wir jetzt noch an, daß eigentlich niemand weiß, was
Treibstoff ist und welche Treibstoffmenge auf den Motor tatsäch-
lich wirkt, dann wird das Ganze zu einer kabarettreifen Farce.
Man braucht statt „Treibstoff“ nur Geld einzusetzen und statt
„Tachostand“ den des Preisniveaus, um das Dilemma auf den Be-
reich der Notenbanken zu übertragen.
Wie praktizieren die Notenbanken ihre Stabilitätsbemühungen?
Anstatt die nachfragewirksame Geldmenge direkt am „Tacho-
stand“ des Preisniveaus zu steuern, beschreiten die meisten No-
tenbanken seit etwa zwei Jahrzehnten den komplizierten Weg der
Geldmengenvorausberechnung. Jedes Jahr aufs neue verkünden
sie, von welchem Geldbedarf sie in den nächsten zwölf Monaten
ausgehen werden. Das Ergebnis ihrer Hochrechnungen und
Schätzungen, die Zuwachsrate, geben sie jeweils in Prozentgrö-
ßen bekannt. Das tun sie in der Erwartung, daß sich die Wirtschaft
und vor allem die Tarifpartner an diesen Werten orientieren. Als
Orientierungsgröße für die Vorausberechnungen beziehen sie sich
jedoch meist nicht auf das von ihnen selbst herausgegebene Bar-
geld, sondern auf sogenannte Geldmengenaggregate, die in den
einzelnen Ländern wiederum unterschiedlich sind.
Eine größere Anzahl der Notenbanken, darunter die britische
orientiert sich z. B. an der sogenannten Geldmenge M l. Das ist
die Zusammenfassung der Bargeldmenge mit den Sichtguthaben
der „Nichtbanken“, also der Wirtschaftsteilnehmer außerhalb des
Bankenapparates. Obwohl über die Größe dieser Sichtguthaben
nicht die Notenbanken bestimmen, sondern die Wirtschaftsteil-
nehmer mit ihren Zahlungsgewohnheiten, scheint diese Misch-
größe noch halbwegs logisch. Denn immerhin gehören die Sicht-
guthaben, neben dem Bargeld, zum Nachfragepotential in der
Wirtschaft. Die Schweizer Nationalbank benutzt als Orientie-
rungsgröße die sogenannte Notenbankgeldmenge. Diese enthält
ebenfalls die in Umlauf gegebene Bargeldmenge, zuzüglich jener
Guthaben, die die Geschäftsbanken bei der Nationalbank unter-
halten, vor allem zum Zwecke der internen Verrechnungen.
Die Deutsche Bundesbank hat 1974 als Vergleichsgröße für ihre
Geldmengensteuerung ein eigenes Aggregat kreiert, die soge-
nannte Zentralbankgeldmenge (ZBGM). Diese besteht etwa zur
Hälfte aus dem Bargeld, zur anderen Hälfte aus bestimmten An-
teilen der Sichteinlagen sowie der Termin- und Spareinlagen bis
vier Jahre Laufzeit. Dieses Aggregat ist also eher als ein Konglo-
merat von Geld und Guthaben zu bezeichnen. Denn zumindest
mit den beiden letztgenannten Posten sind darin Anteile enthal-
ten, die überhaupt kein Geld sind, sondern Buchungen von Er-
sparnissen, die man anderen überlassen hat.
Bei den Vorausberechnungen der jährlichen Geldmengen-Zu-
wachsrate legt die Bundesbank vor allem die Ausweitungen des
Produktionspotentials zugrunde, aber auch Geldabflüsse ins Aus-
land oder ähnliche Faktoren. Außerdem rechnet sie mit rund zwei
Prozent eine sogenannte „unvermeidliche Preissteigerungsrate“
ein, die man also planmäßig mit neuem Geld unterfüttert.
Wie sieht das Ergebnis dieser Stabilitätsbemühungen aus?
In der Darstellung 17 sind die Zielvorgaben der Bundesbank und
die tatsächlichen Ergebnisse seit Einführung dieser Art von Geld-
mengensteuerung eingetragen. Das schraffierte Feld gibt dabei je-
weils die Bandbreite oder Prozenthöhe der angestrebten Wachs-
tumsraten wieder, die Kurve mit den Kreispunkten das tatsäch-
liche Ergebnis. Wie ersichtlich, hat man für die Jahre 1975 bis 1978
und das Jahr 1989 jeweils einen festen Prozentsatz vorgegeben,
ansonsten wechselnde Bandbreiten von zwei bis drei Prozent. Im
Jahr 1991 wurde sogar mitten in der Jahresperiode die Bandbreite
noch einmal um einen Prozentpunkt nach unten korrigiert, weil
sich die Entwicklung der Geldmenge in der ersten Hälfte des Zeit-
raums deutlich unterhalb des Zieltrichters bewegte.
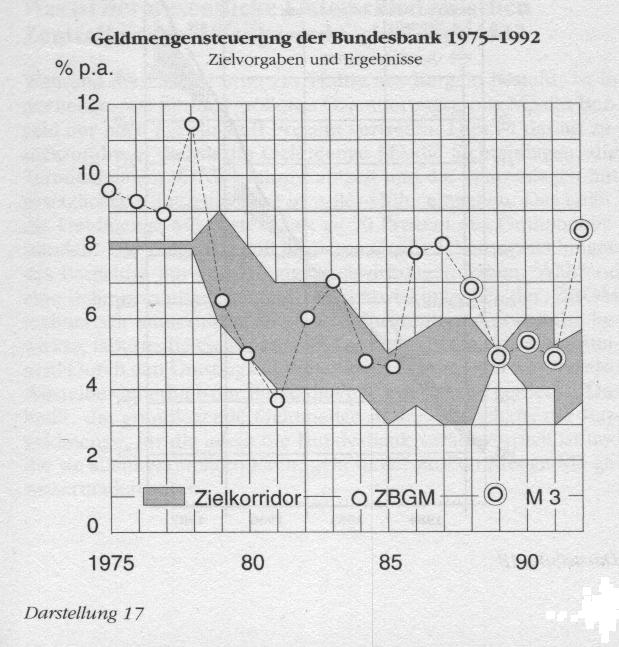
Doch trotz des meist relativ großen Spielraums und der fast jähr-
lichen Korrekturen der Bandbreite war die Erfolgsquote in den
meisten Jahren enttäuschend. In der ganzen dargestellten Zeit hat
man allenfalls sechsmal ins Schwarze getroffen. Zweimal lag man
gerade noch am Rande des Korridors, während die Ergebnisse in
den übrigen Jahren oft weit neben den Zielvorgaben lagen.
Das Ergebnis dieser Art von Stabilitätspolitik über Geldmengen-
Zielvorgaben erinnert auf fatale Weise an das beliebte Schüler-
spiel „Schiffe versenken“. Auch hier landen die meisten Versuche
im Wasser, und Volltreffer sind weitgehend dem Zufall zu verdan-
ken.
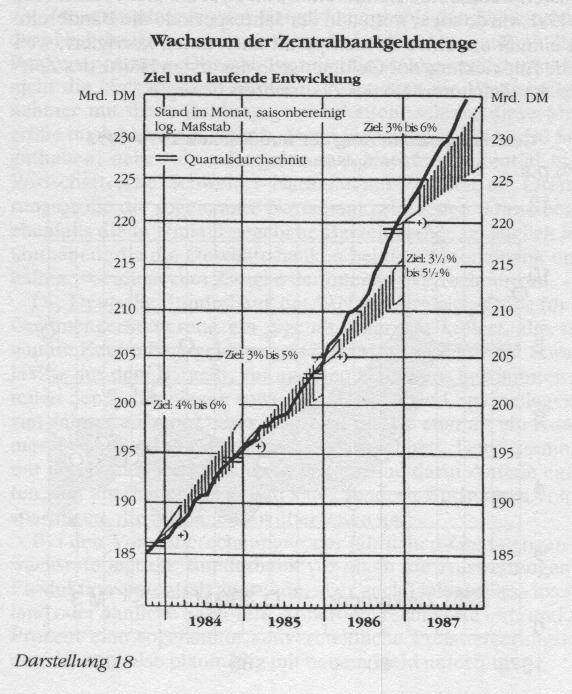
Darstellung 18
In welcher Größenordnung die tatsächlichen Entwicklungen
der Zentralbankgeldmenge oft neben den Erwartungen und Vor-
ausberechnungen gelegen haben, zeigt die Originalgrafik der
Bundesbank für die Jahre 1984 bis 1987 (Darstellung 18). Wäh-
rend sich die Entwicklung der Geldmenge in den beiden ersten
Jahren optimal im Zieltrichter bewegte, schoß sie in den beiden
folgenden Jahren weit über das Ziel hinaus. Dieses fast schon
peinliche Abweichen von der Zielvorgabe war dann der Anlaß
für die Bundesbank, nach einer anderen Geldmenge als Orientie-
rungsgröße Ausschau zu halten. Man fand sie in der sogenannten
Geldmenge M3, deren Entwicklung den Zielvorgaben der Jahre
1986 und 1987 näher lag.
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Zentralbankgeldmenge und Geldmenge M3?
Während die ZBGM etwa zur Hälfte aus Bargeld besteht, ist in
der neuen, fast fünfmal größeren Orientierungsgröße M3 das Bar-
geld nur noch mit rund elf Prozent vertreten. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, daß in die Geldmenge M3 die Sichteinlagen, die
Termineinlagen bis vier Jahre Laufzeit und die Spareinlagen mit
gesetzlicher Kündigungsfrist in voller Höhe eingehen. Das heißt
die Geldmenge M3 besteht fast zu 90 Prozent aus Guthabenbe-
ständen. Die Folge ist, daß in dieser Größe Überentwicklungen
des Bargeldes nur geringfügige Auswirkungen haben. Während
eine zehnprozentige Bargeld-Überentwicklung bei der ZBGM
rechnerisch immerhin noch eine fünfprozentige Ausweitung be-
wirkte, läßt sie die Geldmenge M3 nur um gut ein Prozent anstei-
gen. Durch den Umstieg auf dieses größere Aggregat werden also
Ausreißer innerhalb der Bargeldmenge weitgehend verdeckt. Das
heißt, die grundlegende Geldmenge in der Wirtschaft, die Bar-
geldmenge, für die allein die Bundesbank verantwortlich ist und
die sie allein vermehren kann, geht in der großen Menge M3 ge-
wissermaßen unter.
Wodurch kam es zu den großen Abweichungen der Zentralbankgeldmenge?
Die Ursachen für das Ausreißen der ZBGM in den Jahren 1986
und 1987 gehen aus der nachfolgenden Darstellung 19 hervor. In
ihr sind noch einmal die Entwicklungen der ZBGM und der Geld-
menge M3 in den kritischen Jahren 1985 bis 1989 eingetragen, und
zwar in ihrer prozentualen Zunahme. Außerdem wurde zusätzlich
die Entwicklung der Bargeldmenge sowie der 1000-DM-Scheine
aufgenommen, zum Vergleich mit der Wirtschaftswirklichkeit
auch noch die Entwicklung des realen Sozialprodukts.
Wie die Grafik sichtbar macht, nahm die ZBGM in den Jahren
1986, 1987 und 1988 tatsächlich schneller zu als die Geldmenge
M3.
Die Bargeldmenge stieg jedoch nochmals steiler an als die bei-
den Mischaggregate. Das heißt, der Überanstieg der ZBGM war
die Folge der Überentwicklung der Bargeldmenge, also jener
Hauptgröße in der ZBGM, für deren Zunahme alleine die Bun-
desbank zuständig ist. Warum die Bargeldmenge wiederum so ex-
plosiv zunahm, erklärt sich aus der Kurve der zusätzlich eingetra-
genen 1000-DM-Scheine.
Wie schon im 9. Kapitel beschrieben, war die Ursache dieser
völlig unnormalen Geldvermehrung vor allem die äußerst nie-
drigen Zins- und Inflationsraten in der Zeit von 1985 bis 1987,
verstärkt noch durch die Einführung der Quellensteuer. Der
Wiederanstieg beider Raten nach 1988 führte dann auch zu einem
Abbrechen der Bargeld-Überentwicklung. Wie aus der Grafik er-
sichtlich, ging die Menge der 1000-DM-Scheine, trotz des deut-
licheren Wirtschaftswachstums 1989, sogar zurück.
Doch statt diesen Ursachen der Überentwicklung der Bargeld-
menge und vor allem der 1000-DM-Noten nachzugehen und sol-
che inflationsträchtigen Entwicklungsstörungen für die Zukunft
zu unterbinden, stieg man, die Augen vor den Problemen der eige-
nen unzulänglichen Geldmengensteuerung verschließend, auf
eine im Augenblick „passendere“ Geldmenge um, nämlich auf die
mehrfach größere Geldmenge M3.
Man verhielt sich also wie ein Biologe, der für die Einhaltung
bestimmter Schadstoffgrenzen in einem Fluß zuständig ist und
beim Überschreiten der Grenzwerte seine Messungen in einen See
verlegt, in dem das Flußwasser nur noch einen Bruchteil aus-
macht. Es ist eigentlich unverständlich, daß diese Vogel-Strauß-
Politik der Bundesbankvon der Fachwelt fast kommentarlos hin-
genommen wurde.
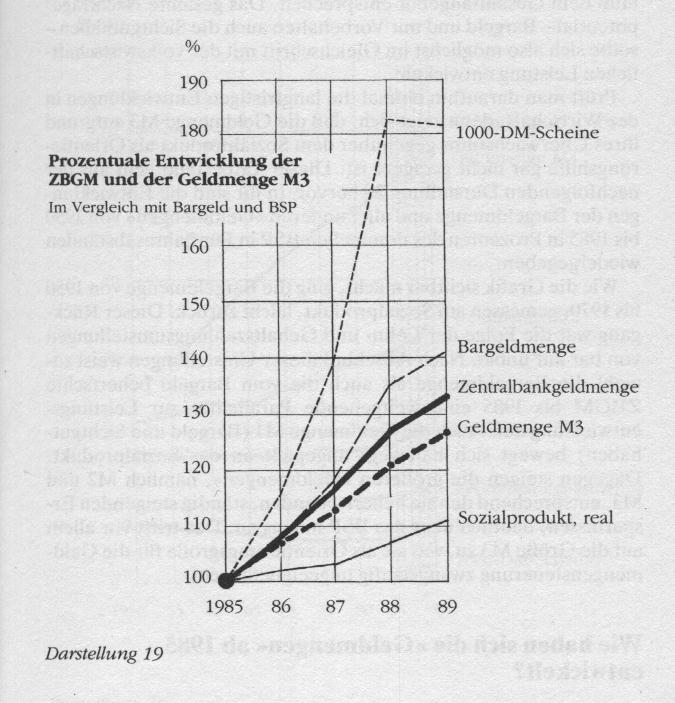
Darstellung 19
Ist die Geldmenge M3 als Orientierungsgröße überhaupt geeignet?
Erinnern wir uns: Die Gesamtnachfrage in einer Volkswirtschaft
muß dem Gesamtangebot entsprechen. Das gesamte Nachfrage-
potential - Bargeld und mit Vorbehalten auch die Sichtguthaben -
sollte sich also möglichst im Gleichschritt mit der volkswirtschaft-
lichen Leistung entwickeln.
Prüft man daraufhin einmal die langfristigen Entwicklungen in
der Wirtschaft, dann zeigt sich, daß die Geldmenge M3 aufgrund
ihres Überwachstums gegenüber dem Sozialprodukt als Orientie-
rungshilfe gar nicht geeignet ist. Dieser Tatbestand geht aus der
nachfolgenden Darstellung 20 hervor. In ihr sind die Entwicklun-
gen der Bargeldmenge und aller anderen „Geldmengen“ von 1950
bis 1985 in Prozenten des nominellen BSP in Fünfjahresabständen
wiedergegeben.
Wie die Grafik sichtbar macht, ging die Bargeldmenge von 1950
bis 1970, gemessen am Sozialprodukt, leicht zurück. Dieser Rück-
gang war die Folge der Lohn- und Gehaltszahlungsumstellungen
von bar auf unbar. Nach Abschluß dieser Umstellungen weist so-
wohl die Bargeldmenge als auch die vom Bargeld beherrschte
ZBGM bis 1985 eine weitgehende Parallelität zur Leistungs-
entwicklung auf. Auch die Geldmenge Ml (Bargeld und Sichtgut-
haben) bewegt sich halbwegs angepaßt an das Sozialprodukt.
Dagegen steigen die größeren „Geldmengen“, nämlich M2 und
M3, entsprechend den sie beherrschenden, ständig steigenden Er-
sparnissen, deutlich über das BSP hinaus an. Das trifft vor allem
auf die Größe M3 zu, was sie als Orientierungsgröße für die Geld-
mengensteuerung zwangsläufig ungeeignet macht.
Wie haben sich die „Geldmengen“ ab 1985 entwickelt?
In der langfristigen Darstellung 20 sind die Veränderungen ab
1985 im Jahresabstand dargestellt, wegen der vereinigungsbeding-
ten Größensprünge jedoch nur bis 1989.
Zu erkennen ist, daß von 1985 bis 1989 die Entwicklung der
Größe M3 leicht nachließ, während sie bei allen anderen „Geld-
mengen“ anstieg. Dieser Tatbestand scheint für den Umstieg auf
M3 zu sprechen. In Wirklichkeit jedoch ist die relative Verlang-
samung der M3-Entwicklung lediglich eine Folge statistischer Er-
fassungsabgrenzungen. Denn bei der Berechnung dieser Größe
fallen jene Ersparnisse unter den Tisch, die aus steuerlichen Grün-
den als DM-Guthaben bei ausländischen Zweigstellen deutscher
Banken gehalten werden, vor allem in Luxemburg. So nachteilig
diese Ersparnisverlagerungen für den Fiskus auch sein mögen, für
den deutschen Kreditmarkt stehen diese Ersparnisse jedoch ge-
nauso zur Verfügung wie die innerhalb unseres Landes angeleg-
ten. Erweitert man darum M3 um diese Auslandsbestände (wie
oben in der Grafik geschehen), dann zeigt sich die Fragwürdigkeit
des Umstiegs in diese Geldmenge.
Im unteren Teil der Darstellung, ab 1985, findet sich auch noch
einmal die entscheidende Erklärung für das „Ausreißen“ der Bar-
geldmenge und damit das Ansteigen der ZBGM, nämlich die
Übervermehrung der 1000-DM-Noten.
Die Ungeeignetheit dieser weitgehend aus Ersparnissen beste-
henden und damit rascher als das Sozialprodukt wachsenden
„Geldmenge“ M3, hat sich inzwischen auch ohne Hinzuziehen der
Anlagen jenseits der Grenze bewiesen: Wie bekannt, läuft die
Geldmenge M3 seit 1991 völlig aus dem Ruder und hat 1992 wie
auch 1994 die Zielgröße um das Doppelte überstiegen. Dieses
Überschießen von M3 hat wiederum Gründe, die mit inflationsbe-
stimmenden Geldmengenentwicklungen wenig zu tun haben. Es
ist nämlich vor allem die Folge spekulativer Einlagenumschich-
tungen von langfristigen in mittelfristige Bankeinlagen, die in
den letzten Jahren höher verzinst wurden. Da die langfristigen
Einlagen nach der bei uns üblichen fragwürdigen Terminologie
(richtigerweise) nicht zum Geld gezählt, die mittleren (fälsch-
licherweise) jedoch als „Geld“ erfaßt werden, müssen solche zins-
höhenbedingten Umschichtungen die ganze ausgedachte „Geld-
mengensteuerung“ über den Haufen werfen.
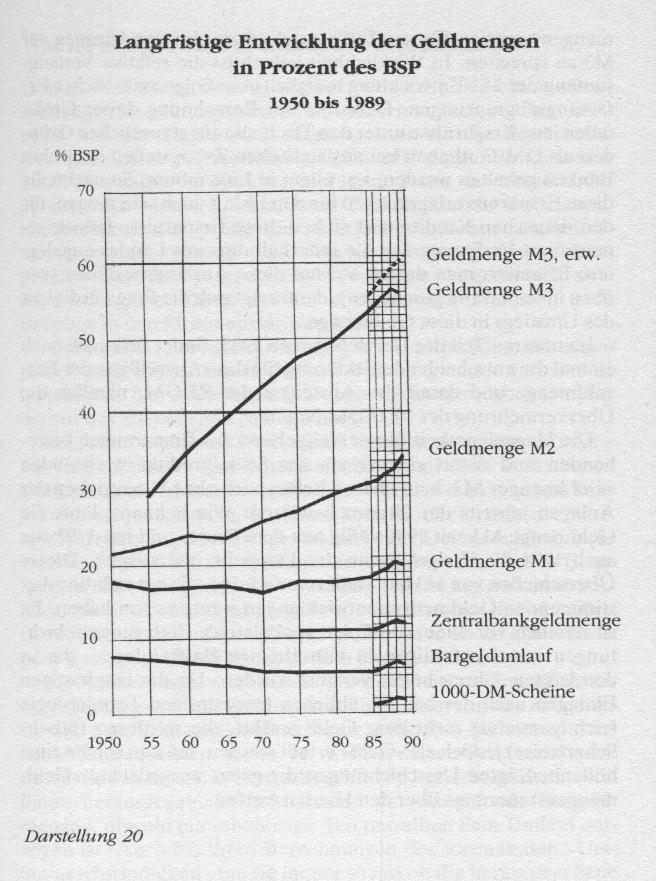
Was ist das größte Dilemma der Notenbanken?
Erinnern wir uns an den Autofahrer: Wenn er sich nicht mit Ben-
zinmengenberechnungen belastet, sondern einfach mit dem Gas-
pedal auf die Tachonadel reagiert, kann er die gewünschte
Geschwindigkeit präzise einhalten. Das allerdings nur, wenn nie-
mand ihm dabei ins Handwerk pfuscht. Denn der Versuch des
Fahrers, den Motor durch erhöhte Treibstoffzufuhr zu beleben,
bleibt wirkungslos, wenn die zusätzlich zugeführte Treibstoff-
menge von einem Dritten „aus dem Verkehr gezogen“ wird. Um-
gekehrt kann der Motor durch den Fahrer nicht gedrosselt wer-
den, wenn jener Dritte den zuvor entzogenen Treibstoff nach
Belieben in den Motor einspritzen kann.
Als Autofahrer braucht man sich über solche Einmischungen
jedoch keine Gedanken zu machen. Fahrzeug und Motor sind so
konstruiert, daß mit solchen Störungen nicht zu rechnen ist. An-
ders ist das aber bei den Notenbanken:
Sieht eine Notenbank die Konjunktur erlahmen, kann sie zwar-
wie unser Fahrer - den Wirtschaftsmotor mit einer zusätzlichen
Geldspritze zu beleben versuchen. Im Gegensatz zu unserem Fah-
rer weiß sie jedoch nicht, ob der zusätzliche „Treibstoff“ die Wirt-
schaft erreicht, also nachfragewirksam wird. Denn das hängt nicht
von der Notenbank ab, sondern von Dritten, nämlich den Emp-
fängern des Mehrgeldes. Sie entscheiden jeden Tag aufs neue dar-
über, ob sie dieses Geld ausgeben, verschenken oder verleihen
(womit der Kreislauf geschlossen bleibt) oder ob sie einen mehr
oder weniger großen Teil davon dem Kreislauf entziehen.
Die Notenbanken wissen zwar von diesen Störungsmöglichkei-
ten, die ihre ganzen Bemühungen zur Stabilisierung von Konjunk-
tur und Kaufkraft unterlaufen. Sie ziehen jedoch bis heute daraus
keine Konsequenzen. Ja, sie verwischen diesen Tatbestand noch
durch die von ihnen benutzten Begriffe. So bezeichnen sie das von
ihnen herausgegebene Geld immer als „umlaufende Bargeld-
menge“, obwohl ein erheblicher Teil derselben dem Umlauf ent-
zogen ist. Auch bei ihren Berechnungen der sogenannten „Um-
laufgeschwindigkeit“ tun sie immer so, als ob die herausgegebene
Geldmenge mit der tatsächlich umlaufenden und nachfragenden
identisch sei. Entsprechend fragwürdig sind die darauf aufbauen-
den Berechnungsergebnisse. Erschwerend kommt noch hinzu,
daß die nicht umlaufenden - also gehorteten - Teile der Bargeld-
menge keinesfalls stabil sind, sondern - wie im 9. Kapitel darge-
legt - großen Schwankungen unterliegen.
Was müßte zur Erreichung der Stabilität geändert werden?
Niemand kann sich vorstellen, daß der Konstrukteur eines Motor-
wagens Dritten die Möglichkeit einräumen würde, in die Rege-
lung der Geschwindigkeit beliebig einzugreifen.
Die Verantwortlichen für unser Geld, die Notenbanken, lassen
dies jedoch tatenlos zu. Ja, sie bezeichnen diese Eingriffe gera-
dezu als ein zu verteidigendes Stück persönlicher Freiheit. So
schrieb die Bundesbank auf die Frage, ob jedermann berechtigt
sei, Geld aus dem Verkehr zu ziehen:
„Die Möglichkeit, rechtmäßig erworbenes Geld dem Zahlungs-
verkehr auf gewisse Zeit zu entziehen, ist Ausfluß des Grund-
satzes, daß der Eigentümer beweglicher Sachen hiermit. . .
nach Belieben verfahren darf. . . Ein "Horten" von Bargeld
kann somit von der Bundesbank nicht verhindert werden. Es
sind hierdurch aber bisher praktisch keine ernsthaften wäh-
rungspolitischen Probleme entstanden, auch nicht aus der Sicht
der Steuerung des Geldumlaufs.“
Angesichts der hier dargelegten ständigen Probleme bei der
Stabilerhaltung der Geldkaufkraft kann man über den letzten Satz
nur den Kopf schütteln. Nicht minder kann man es über den Tat-
bestand, daß es in das Belieben eines jeden gestellt ist, das von der
Bundesbank herausgegebene Geld als öffentliche Einrichtung
oder als beliebig verfügbares Privateigentum zu sehen und ent-
sprechend zu behandeln. Solange der Gesetzgeber diese Unlogik
und Unrechtslage unverändert läßt, wird man weder die Mengen-
steuerung noch die Kaufkraftstabilität des Geldes in den Griff be-
kommen. Auch nicht durch immer neue „Geldmengenkreatio-
nen“ oder ein immer häufigeres Umsteigen von der einen auf eine
andere Größe. Das vor allem nicht, solange man in diesen „Geld-
mengen“ weiterhin Geld und Guthaben zusammenfaßt.
Im übrigen ist es überhaupt nicht die Aufgabe der Notenban-
ken, sich eine wie auch immer geartete Geldmenge vorzugeben,
an der man sich dann festzuklammern versucht. Es ist vielmehr
allein ihre Aufgabe, die Kaufkraft des Geldes stabil zu halten und
die Wirtschaft mit ausreichenden Geldmitteln zu versorgen. Hal-
ten sie die Geldkaufkraft stabil, das heißt, orientieren sie die
Geldversorgung allein an den Schwankungen des Preisstandes, so
ist automatisch auch die zweite Aufgabe optimal gelöst, nämlich
die Versorgung der Wirtschaft mit den erforderlichen Tausch- und
Verrechnungsmitteln. Denn deren Menge ist immer richtig, wenn
die Kaufkraft stabil bleibt. Doch um diese Ziele zu erreichen, be-
nötigen sie keine im voraus prognostizierten Geldmengenziele.
Wohl aber eine klare juristische Einordnung unseres Geldes als
öffentliche Einrichtung und eine wirksame Umlaufsicherung. Nur
dann ist es möglich, die nachfrageaktive Geldmenge mit der her-
ausgegebenen in Übereinstimmung zu bringen. Und nur dann sagt
auch die „Umlaufgeschwindigkeit“ etwas aus, die heute von den
schwankenden, nicht umlaufenden Geldmengenbeständen und
durch die Einbeziehung von Guthabenanteilen total verfälscht
wird. Daß man mit Geldmengenaggregaten, die nur zu einem ge-
ringen Teil nachfragewirksam sind, keine Kaufkraftstabilität er-
reichen kann, bedarf keiner weiteren Erklärungen.
[ Inhalt
Geldsyndrom ] [ Homepage
www.geldreform.de ] [ Gästebuch
www.geldreform.de ]
Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,
1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4
Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Mit Zustimmung des Autors digitalisiert für INWO
Deutschland e.V.