Thomas Betz
10 Jahre keine Einheit
Ein Kompendium wirtschaftspolitischer Fehler
„Die
Einheit ist den Deutschen nicht bloß in den Schoß,
sie ist ihnen vor allem auf den Kopf gefallen.“
Adolf
Muschg, 1993, Schweizer Schriftsteller
10 Jahre nach Vollzug der politischen Einheit ist Deutschland von einer Einheitlichkeit der wirtschaftlichen Verhältnisse so weit entfernt wie vom Selbstverständnis einer homogenen Nation. Offenbar hat nicht einmal jeder fünfte Deutsche heute den Eindruck, dass Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West überwiegen.[1] Und der Spiegel konstatiert: „Von der viel beschworenen ‚inneren Einheit’ sind die Deutschen heute weiter entfernt als vor der offiziellen Vereinigungsfeier am 3. Oktober 1990.“[2] Für die wirtschaftliche Ebene lassen sich konkrete und einigermaßen objektive Messgrößen ermitteln, die auch Gegenstand der vorliegenden Betrachtung sind. Für die menschliche Ebene sind wir auf subjektive Einschätzungen verwiesen. Aber es muss alarmieren, dass heute nur noch 41% der 16-29-jährigen Westdeutschen mit den Ostdeutschen in einem Staat zusammenleben wollen.[3] Das Ansehen der Marktwirtschaft hat sich im Osten rapide verschlechtert: Kurz nach dem Mauerfall äußerten 77% der Ostdeutschen eine gute Meinung zum Wirtschaftssystem der Bundesrepublik. Heute ist dieser Wert auf 26% gesunken.[4] Ganz offenbar besteht zwischen den beiden Ebenen ein Zusammenhang, denn auch im ökonomischen Bereich lassen sich Stagnationen bzw. rückläufige Entwicklungen feststellen, wie noch gezeigt wird. Nicht zuletzt angesichts der Aufwendungen in Billionenhöhe, die die Einheit bislang gefordert hat und weiter fordern wird (s.u.), ist diese Entwicklung mehr als unbefriedigend.
Für dieses Missverhältnis gibt es konkrete Ursachen. Sicher ist es ein Leichtes, in einer ex-post-Betrachtung Fehler aufzuzeigen. Hinterher ist man immer klüger. Aber vor 10 Jahren und auch noch lange danach wurden in Deutschland Entscheidungen getroffen, deren teilweise verheerende Auswirkungen durchaus vorhersehbar waren und auch vorhergesehen wurden und – nicht immer, aber doch oft – sogar von den verantwortlichen Entscheidungsträgern selbst.
1. Die DDR am Ende ─ Das Ende der DDR
Bis zur Wende waren die europäischen Nationen jeweils einem der beiden weltpolitischen Lager zugehörig; mit der Ausnahme Deutschlands, welches die Spaltung Europas gewissermaßen am eigenen Leib erfuhr. Die DDR war also das einzige COMECON-Land mit einer kulturellen Entsprechung auf der westlichen Hemisphäre und dadurch einem besonderen Druck ausgesetzt.
Das östliche Deutschland rangierte auf der Skala der stärksten Industrienationen der Welt auf Platz 10. Der Lebensstandard der Bevölkerung war (gemessen in Kaufkraftparitäten) höher als in den EU-Mitgliedsstaaten Griechenland und Portugal und der höchste aller sozialistischen Staaten sowieso. Ähnliches galt für die medizinische und die Sozialversorgung. Es hat alles nichts genutzt: Solange der „große Bruder“ in Sachen Wohlstand eben auch die „bessere Hälfte“ war und mit diesem materiellen Glück auch lockte, indem er Staatsangehörige der DDR als solche nicht anerkannte, sondern rechtlich als Bundesdeutsche betrachtete und damit eine völlig unkomplizierte Übersiedlung in Aussicht stellte, war Unfreiheit eine notwendige Voraussetzung für die staatliche Existenz der DDR: Physische Unfreiheit wurde durch die hermetisch abgeriegelten Westgrenzen und entsprechende Abkommen mit den östlichen Nachbarländern gewährleistet. Geistige Unfreiheit wiederum gewährleistete die physische Unfreiheit, indem sie verhindert hat, dass letztere in Frage gestellt werden konnte.
Diese Kombination aus Gängelung und Beschränkung konnte die Existenz der DDR über Jahrzehnte erfolgreich sichern. Aber die Zeit spielte gegen sie. Denn im Rest der Welt entwickelte sich eine immer intensiver werdende – Grenzen eben gerade überschreitende – Verflechtung wirtschaftlicher, politischer, kultureller und nicht zuletzt auch individueller Natur; später Globalisierung genannt. Der Anachronismus, den eine Politik der Isolation, wie sie die DDR betrieb, bedeutete, wurde immer augenscheinlicher.
Letzter Garant für die Sicherstellung der existenznotwendigen Unfreiheit in der DDR war die Sowjetunion. Als aber Gorbatschow, Perestroika und Glasnost in Moskau einzogen, war das Ende nicht mehr weit. Nicht genug damit, dass die bisherige Rückversicherung der Macht auszufallen drohte und letztlich auch tatsächlich ausfiel:[5] Ausgerechnet Moskau propagierte nunmehr Offenheit, angstfreie Kommunikation, internationalen Austausch und demokratischen Wandel. So etwas konnte der Staat DDR nicht nur nicht gebrauchen. Es war für ihn eine tödliche Bedrohung. Die Machthaber versuchten sich zu retten, indem sie die Absurdität noch steigerten und die Isolation nach Osten hin ausdehnten: So wurde z.B. im Sommer 1989 die Auslieferung der sowjetischen Kulturzeitschrift Sputnik in der DDR unterbunden. Erst die Einsicht in ökonomische Zusammenhänge verhalf der Führungsriege schließlich zu der Erkenntnis, dass es wohl nichts mehr zu retten gab.
Direkt nach Honeckers Sturz am 18.10.1989 wird Gerhard Schürer, Chef der staatlichen Plankommission, von Egon Krenz beauftragt, die wirtschaftliche Lage der DDR zu analysieren und dem Politbüro der SED ungeschminkt zu präsentieren. Von der „geheimen Verschlußsache b5 1158/89“ werden exklusiv 40 nummerierte Exemplare erstellt. Nicht einmal der später Krenz nachfolgende Ministerpräsident Hans Modrow – immerhin noch SED-Mitglied – hat davon Kenntnis (hingegen offenbar Helmut Kohl[6]). Am 30. Okt. 1989 wird das später so genannte „Schürer-Papier“ dem Politbüro vorgestellt. Es ist das vielleicht wichtigste wirtschaftshistorische Dokument der ehemaligen DDR überhaupt:
Schürer
beginnt zunächst mit dem Üblichen und lobt und preist die DDR und ihre
Leistungen. Dann erwähnt er, was schon nicht mehr so üblich ist, dass die DDR in ihrer Arbeitsproduktivität
weit hinter der Bundesrepublik zurückliegt und kommt schließlich unvermittelt
auf den Kern des Problems zu sprechen. Dabei bemühte er sich noch um eine
marxistische Terminologie: „Im Einsatz
des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens sowie der zur Verfügung stehenden
Ressourcen besteht ein Missverhältnis zwischen dem gesellschaftlichen Überbau
und der Produktionsbasis. Die Verschuldung im nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet
ist seit dem VIII. Parteitag gegenwärtig auf eine Höhe gestiegen, die die Zahlungsfähigkeit
der DDR in Frage stellt.
....
Im Zeitraum seit dem
VIII. Parteitag wuchs insgesamt der Verbrauch schneller als die eigenen
Leistungen. Es wurde mehr verbraucht als aus eigener Produktion erwirtschaftet
wurde zu Lasten der Verschuldung im NSW[7],
die sich von 2 Mrd. VM [8]
1970 auf 49 Mrd. VM 1989 erhöht hat.“ [9]
Zwischen 1971 und 1980 wurden Waren im Wert von 21 Mrd. VM mehr importiert als exportiert. Bereits ab 1981 war man bemüht, den Schuldenberg wieder abzutragen. Das von der Sowjetunion gelieferte Erdöl wurde weniger verbrannt, sondern in seiner Funktion als Brennstoff verstärkt durch Braunkohle und Erdgas ersetzt, zu Erdölprodukten veredelt und diese auf den Weltmarkt gebracht. Die so erzielten Exportüberschüsse reichten aber gerade für die Zinszahlungen, so dass der von Schürer so genannte „Sockel“ im Zeitraum zwischen 1980 und 1986 auf einem in etwa gleichbleibenden Niveau i.H.v. ca. 28 Mrd. VM gehalten werden konnte.
Aber 1986 brachen die Preise für Erdölprodukte weltweit ein. Im Zeitraum zwischen 1986 und 1988 beliefen sich die gesamten Exportüberschüsse auf nur noch 1 Mrd. VM, während allein der Kapitaldienst für die Devisenkredite mit 13 Mrd. VM zu Buche schlug. Statt des geplanten Devisenexportüberschusses von 23 Mrd. VM für den Fünfjahresplan von 1986 bis 1990 ist nunmehr von einem Importüberschuss i.H.v. 6 Mrd. VM auszugehen. Entsprechend beläuft sich der „Sockel“ Ende 1989 bereits auf 49 Mrd. VM. Die Folge: „Mit den geplanten Valutaeinnahmen 1989 werden nur etwa 35% der Valutaausgaben insbesondere für Kredittilgungen, Zinszahlungen und Importe gedeckt. 65% der Ausgaben müssen durch Bankkredite und andere Quellen finanziert werden. Das bedeutet, dass die fälligen Zahlungen von Tilgungen und Zinsen, d.h. Schulden mit neuen Schulden bezahlt werden.“[10] Selbst wenn es gelingen würde, in 1990 die Handelsbilanz wieder einigermaßen auszugleichen, wäre im selben Jahr ein Kapitaldienst i.H.v. 8 Mrd. VM fällig, der „Sockel“ würde auf 57 Mrd. VM anwachsen u.s.w..
Angst vor dem IWF
Schürer entwickelt drei Szenarien und beschreibt zunächst, was passiert, wenn nichts passiert: „Die Konsequenz der unmittelbar bevorstehenden Zahlungsunfähigkeit wäre ein Moratorium, bei dem der IWF bestimmen würde, was in der DDR zu geschehen hat. Solche Auflagen setzen Untersuchungen des IWF in den betreffenden Ländern zu Fragen der Kostenentwicklung, der Geldstabilität u.ä. voraus. Sie sind mit der Forderung auf den Verzicht des Staates, in die Wirtschaft einzugreifen, der Reprivatisierung von Unternehmen, der Einschränkung der Subventionen mit dem Ziel, sie gänzlich abzuschaffen, dem Verzicht des Staates, die Importpolitik zu bestimmen, verbunden. Es ist notwendig, alles zu tun, damit dieser Weg vermieden wird.“ [11]
Was sollte also geschehen? Der Planungschef zeigt eine
Modellrechnung, der zufolge der „Sockel“ bis 1992 nochmals leicht auf 63 Mrd.
ansteigt, um dann allmählich bis 1995 auf 57 Mrd. zurückzugehen: Dies setzt allerdings
voraus, dass es gelingt, nicht nur zum Exportüberschuss zurückzukehren, sondern
diesen jährlich um 2 Mrd. bis auf 11,3 Mrd. im Jahre 1995 zu steigern. Er nennt
über mehrere Seiten allerlei dringend erforderliche Maßnahmen wie die
Reduzierung unproduktiver Wasserkopf-Verwaltungen, Stärkung des
Leistungsprinzips, Priorisierung der Investitionen zu Lasten des Konsums und Einschränkung
der Sozialleistungen, um schließlich zu resümieren:
„Auch wenn alle
diese Maßnahmen in hoher Dringlichkeit und Qualität durchgeführt werden, ist
der im Abschnitt I dargelegte, für die Zahlungsfähigkeit der DDR erforderliche NSW-Überschuß nicht
sicherbar. 1985 wäre das noch mit großen Anstrengungen möglich gewesen. Heute besteht
diese Chance nicht mehr. Allein ein Stoppen der Verschuldung würde im Jahre
1990 eine Senkung des Lebensstandards um 25-30% erfordern und die DDR unregierbar machen.“[12]
Deshalb schlägt er schließlich „ein konkretes Konzept der Zusammenarbeit mit der BRD und anderen kapitalistischen Ländern“ vor, welches „alle Formen der Zusammenarbeit mit Konzernen“, insbesondere Joint-Ventures und Lohnfertigung, die „Erhöhung der Attraktivität des Tourismus aus kapitalistischen Ländern“, insbesondere aber auch neue und erweiterte Kreditlinien aus dem Westen vorsieht. Und schließlich in schönstem SED-Deutsch:
„Um der BRD den ernsthaften Willen zu unseren Vorschlägen
bewusst zu machen, ist zu erklären, dass durch diese und weitergehende Maßnahmen
der ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit DDR – BRD noch in
diesem Jahrhundert solche Bedingungen geschaffen werden könnten, die heute
existierende Form der Grenze zwischen beiden deutschen Staaten überflüssig zu
machen.“[13]
Jeder, der das hörte und denken konnte, wusste: Es ist vorbei! Die DDR war in die Schuldenfalle geraten. An eine Absenkung des (im innerdeutschen Vergleich) ohnehin geringeren Lebensstandards der Bevölkerung um ein Drittel über Jahre hinweg bei einer gegebenen hochexplosiven politischen Ausgangssituation wie der gegenwärtigen war schlechterdings nicht mehr zu denken. Woran wenigstens noch zu denken war, war die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Westen über Konzessionen betreffend Zins- und Tilgungskonditionen. Aber der Westen würde – in welcher Form auch immer, ob nun als Bundesrepublik, als IWF oder als internationales Gläubiger-Konsortium – die Mauer schleifen und damit jedenfalls mittel- bzw. langfristig die DDR gleich mit. Worin aber sollte der Sinn bestehen, in einem Zwischenstadium – formal zwar noch eigenständig, aber doch bereits abhängig und fremdbestimmt – Valutaschulden abzuarbeiten, um irgendwann dann als Staat doch von der Landkarte zu verschwinden? War es da nicht besser, den zukünftigen Erben der DDR auch gleich die Schulden mitzuvermachen? So geschah es denn auch. Zehn Tage später, am 9. November 1989, wurden die Grenzen geöffnet.
2. Die
Währungsunion
Am 1. Juli 1990, pünktlich um Mitternacht, öffnete die Hauptfiliale der Deutschen Bank in Ost-Berlin am Alexanderplatz ihre Pforten. Wenige Augenblicke später sprangen die ersten Überglücklichen, laut jubelnd und druckfrische DM-Scheine in Händen haltend, in die Menschenmenge vor dem Gebäude. Was die Jubler nicht wussten und auch nicht wissen konnten: Die gesamte Volkswirtschaft der DDR – bis dahin gehandelt als die zehntstärkste der Welt – war genau deshalb und genau in diesem Moment pleite.
Der Marktkurs zwischen der D-Mark und der Mark der DDR schwankte in den letzten Jahren der DDR zwischen 1:4 und 1:5. Zuletzt lag er bei 1:4,4. Das war der Kurs, den die VEBs und Kombinate als sog. „Valuta-Koeffizient“ ihrem Außenhandel mit dem NSW – also dem Westen – zugrundelegten, zu dem aber auch der Verkauf von Westprodukten gegen Ostwährung in den „Exquisit“-Geschäften der DDR kalkuliert wurde und der sich überall dort bildete, wo der Preis der Währungen ohne staatliche Eingriffe durch Angebot und Nachfrage vom Markt ermittelt wurde; insbesondere in den Wechselstuben West- und auf dem Schwarzmarkt Ost-Berlins und nach der Maueröffnung schließlich auch in den Wechselstuben Ost-Berlins. Einzig West-Touristen mussten vor der Wende pro Tag Aufenthalt in der DDR 25,- DM zu einem östlicherseits administrativ festgelegten Kurs von 1:1 tauschen. Dies war auch insoweit gerechtfertigt, als Preise für Lebensmittel, öffentliche Verkehrsmittel, Bücher etc., also der typische „Warenkorb“ eines Touristen, in der DDR staatlich subventioniert waren und ohne diesen „Zwangsumtausch“ (West-Jargon) die ohnehin materiell besser gestellten West-Touristen unnötigerweise durch die DDR mitsubventioniert worden wären. Der „Mindestumtausch“ (Ost-Jargon) zum Kurs von 1:1 hatte allerdings nichts mit den „terms of trade“ zu tun, nichts damit, welche Preise Produkte der DDR auf dem Welt- bzw. Westmarkt erzielen konnten und umgekehrt. Betrachtete man den Zwangs- bzw. Mindestumtausch der Valuta-Touristen im Verhältnis zum Außenhandel der DDR insgesamt, so stellte dieser nur einen kleinen Bruchteil dar. Angesichts der Tatsache, dass also fast der gesamte West-Außenhandel der DDR zu Kursen zwischen 1:4 und 1:5 valutiert wurde, ist es nachgerade absurd, den seinerzeitigen Zwangsumtausch, der vom Westen auch immer als ungerechtfertigt angeprangert und nur unter Protest akzeptiert wurde, als Begründung für eine Währungsumstellung 1:1 anzuführen.
Nichtsdestoweniger wurden Stromgrößen wie Löhne und Einkommen im Verhältnis 1:1 und nominelle Geldvermögen wie Sparkonten bis zu einer Höhe von DM 4.000,- im Verhältnis 1:1 und darüber hinaus im Verhältnis 1:2 umgestellt. Im Durchschnitt ergab sich so für die Sparkonten ein Umtauschkurs von 1:1,4. Am 1. Juli 1990 starteten die Noch-DDR-Bürger mit 115 Mrd. DM in eine neue Zeit.[14]
Viel bedeutender war aber die Umstellung der Stromgrößen. Die Umstellung im Verhältnis 1:1, also der Umstand, dass an die Stelle einer bisherigen Mark der DDR nunmehr eine D-Mark trat, bedeutete bei einem gegebenen Wertverhältnis der beiden Währungen von 1:4 bzw. 1:5 in Wirklichkeit eine Aufwertung aller Löhne, Kosten und Preise in der DDR um den Faktor 4 bzw. 5. Dazu ein authentisches Beispiel aus der Praxis: Ein ostdeutscher Klavierhersteller verkaufte seine Pianos vor der Wende stolz bis nach Kanada. Abgerechnet wurde bei einem durchschnittlichen Modell zu einem Stückpreis von 2.000 VM, also DM. Die auf das einzelne Klavier umgelegten Herstellungskosten beliefen sich auf ca. 4.000 Mark der DDR. Bei einem zugrundegelegten Valuta-Koeffizienten von 1:4 bzw. 1:5 war das ein Bombengeschäft: Die Herstellungskosten beliefen sich somit auf 800 – 1.000 DM. Man konnte die Sache auch andersherum betrachten und gewissermaßen in Kanada 8.000 – 10.000 Mark der DDR für das Piano erlösen. Wie auch immer: Es war eine gewinnträchtige Sache.
Nach der Währungsumstellung hatte sich in Kanada nichts geändert. Das Klavier wurde dort noch immer für 2.000 DM verkauft. Auch die auf das Stück bezogenen Herstellungskosten beliefen sich noch immer auf 4.000 Mark; aber nicht mehr der DDR, sondern es waren jetzt D-Mark: Macht pro Klavier einen Verlust von DM 2.000. Eigentlich hätte man jetzt den Verkaufspreis verdoppeln oder vervielfachen müssen, um wieder in die Gewinnzone zu kommen. Aber das wollten die Kanadier nicht mitmachen. Was also blieb zu tun?
So wie dem Klavierhersteller ging es nach dem 1. Juli 1990 der gesamten Volkswirtschaft der DDR. Auf den Westmärkten lief es wie beschrieben. Auf den Ostmärkten war man nicht nur wie im Westen nicht willens, kostendeckende Preise in DM zu bezahlen. Man war dazu in Ermangelung von Devisen auch gar nicht in der Lage. Und auf dem heimischen Markt? Dort kam – um im Bild zu bleiben – der bisherige kanadische Konkurrent zum Zuge, der zwar nicht Pianos für 800 DM herstellen konnte, aber doch für deutlich unter 4.000 DM. Und er konnte das trotz ebenso hoher Löhne deshalb, weil seine Arbeitsproduktivität[15] höher war als die unseres ostdeutschen Herstellers; d.h. er hatte teure Arbeit teilweise durch modernere, bessere, leistungsfähigere Maschinen ersetzt und konnte deshalb hohe Löhne bezahlen und trotzdem konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt anbieten. Unser ostdeutscher Pianoproduzent konnte das nicht. Die Währungsunion bedeutet für ihn die Verfünffachung der Kosten und damit ohne fremde Hilfe das sichere Aus.
Das Beispiel mag veranschaulichen, wie wichtig das Verhältnis zwischen Arbeitsproduktivität und Lohnniveau ist. Dies gilt im sog. Mikro- bzw. im betriebswirtschaftlichen Bereich, also bezogen auf das Einzelunternehmen, genau so wie im sog. Makro- bzw. volkswirtschaftlichen Bereich. Zwar zieht eine Steigerung der Produktivität nicht automatisch eine entsprechende Steigerung der Reallöhne nach sich, sondern muss normalerweise erst mühsam von den Gewerkschaften erkämpft werden. Aber das Produktivitätsniveau definiert die obere Grenze für mögliche Reallöhne. Insofern ist eine hohe Produktivität zwar keine hinreichende, aber doch eine notwendige Voraussetzung für hohe Reallöhne.[16]
Die ökonomische Situation in der Noch-DDR nach dem 1. Juli 1990 war gekennzeichnet von einem Missverhältnis zwischen einem mittlerweile – am Weltmaßstab gemessen – hohen Reallohnniveau und einer Arbeitsproduktivität, die diesem nicht gewachsen war. Mit anderen Worten: Die hohen Löhne, die die Unternehmen über Nacht gezwungen wurden zu zahlen, konnten am Markt nicht verdient werden: Durch die Währungsunion stiegen die Ostlöhne von 7%[17] des Westniveaus über Nacht auf ca. 35%. Die durchschnittliche Arbeitsproduktivität blieb aber auf einem Niveau von 25% der westdeutschen unverändert. Doch damit nicht genug: Die Tarifpartner setzten eine schnelle Angleichung der Ostlöhne an das Westniveau durch, so dass 1995 75% der westlichen Löhne und Einkommen nominal[18] und (aufgrund der teilweise geringeren Lebenshaltungskosten) 87% der westlichen Kaufkraft[19] erreicht waren mit der Konsequenz, dass z.B. die Arbeitskosten pro Stunde in der Automobilindustrie mit 34 DM höher waren als in Japan mit 30 DM.[20]
Es ist Allgemeingut, dass eine vergleichsweise minimale Veränderung der Wechselkurse um 10% über Exportchancen und Wohl und Wehe ganzer Industriebranchen entscheiden kann. Die DDR hatte es aber nicht mit einer Aufwertung ihrer Währung um 10%, sondern um 400% zu tun und war damit schlechterdings überfordert. Man stelle sich einmal vor, Deutschland (West) hätte über Nacht – aus welchen Gründen auch immer – eine ähnlich hohe Aufwertung der DM zu gewärtigen: Nächstentags würde hierzulande kein einziges Brötchen mehr gebacken, sondern selbige aus Paris eingeflogen. Es gäbe nicht die geringste Chance, sich aus eigener Kraft von einem ökonomischen Erdbeben dieser Größenordnung zu erholen. Man wäre von einem Tag auf den anderen zum Bittsteller degradiert und auf die Unterstützung von außen angewiesen.
Nicht anders ging es der Noch-DDR bzw. dem späteren Anschlussgebiet. Die Unterstützung von außen kam; und nicht zu knapp: Das wirtschaftliche Hilfsprogramm – betrachtet man es denn als solches – ist gigantisch und mit Abstand das größte der Weltgeschichte: Die Netto-Transferzahlungen – also abzüglich der Steuerrückflüsse – von West nach Ost, geleistet von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen belaufen sich mittlerweile auf etwa 1,5 Billionen DM[21]. Seit 1995 haben sich die Brutto-Zahlungen auf einem gleichbleibend hohen Niveau von jährlich 185-190 Mrd. DM stabilisiert. Abzüglich der Steuerrückflüsse in Höhe von jährlich 45-50 Mrd. DM ergeben sich so jährliche Netto-Transfers in Höhe von 140 Mrd. DM; und ein Ende ist nicht in Sicht.
Der größte Teil dieser Transfers fand und findet konsumtive Verwendung und fließt hauptsächlich in die Sozialversicherungen, weil die Ausgaben der Renten-, Arbeitslosen- und Krankenkassen die entsprechenden Einnahmen teilweise um ein Vielfaches übersteigen.[22] Ostdeutschland hatte 1995 ein Bruttosozialprodukt i.H.v. rund 220 Mrd. DM selbst erarbeitet. Verbraucht wurden im selben Zeitraum allerdings 420 Mrd. DM. Die Differenz von 200 Mrd. DM wurde i.H.v. 150 Mrd. DM durch die beschriebenen Transferleistungen ausgeglichen. In Höhe der restlichen 50 Mrd. wurden Kredite aufgenommen.[23] Auch heute noch gilt annähernd, dass nur wenig mehr als jede zweite im Osten verbrauchte Mark auch dort erwirtschaftet wird.
Ca. 60 Mrd. DM der jährlichen Transferleistungen haben investiven Charakter; d.h. fließen in Form von Subventionen in private Unternehmen, unterstützen oder ermöglichen Neu- oder Ersatzinvestitionen. Dank dieser Maßnahmen konnte der Kapitalstock in den neuen Ländern modernisiert und wertmäßig erhöht werden. Infolgedessen stieg die Produktivität auf 40% des Westniveaus in 1992 und schließlich auf 60% in 1996. Allerdings: Seitdem verharrt sie unverändert auf genau diesem Wert.[24] Seit Mitte der 90-er Jahre stagniert also die relative Produktivität im Osten bei 60%, das Lohnniveau bei 75% und die alljährlichen Netto-Transfers, die die sog. Produktivitätslücke[25] ausgleichen, bei 140 Mrd. DM. Was nicht stagniert, ist die Arbeitslosigkeit. Sie stieg kontinuierlich: 1992 belief sich die offizielle Quote auf 14,4%, 1994 auf 15,2%, 1996 auf 15,7%, 1998 auf 18,2%.[26] Für August 2000 wird eine offizielle Quote von 17,0% angegeben. Dabei darf allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, dass das Jobwunder am deutschen Arbeitsmarkt – auch im Westen – „leider nicht mehr als statistischer Zauber“ ist, wie die Wirtschaftswoche schreibt. Denn seit April 1999 sind die 630-Mark-Jobs sozialversicherungs- und meldepflichtig und seit Juni diesen Jahres zählen die so geringfügig Beschäftigten voll zu den Erwerbstätigen, deren Zahl allein auf diese Weise um 1,8 Millionen gestiegen ist.[27]
Mit anderen Worten: Der Aufbau Ost, die Angleichung der
Lebensverhältnisse, ist zum Stillstand gekommen bzw. in mancherlei Hinsicht sogar
rückläufig; und das bereits seit Jahren. Bevor unmissverständlich deutlich
wurde, dass diese gefürchtete Entwicklung eingetreten ist, traute sich Lothar Späth noch zu sagen: „Mißlingt der Versuch, Ostdeutschland auf
eine eigene wirtschaftliche Grundlage zu stellen, ist der bundesdeutsche
Wohlfahrtsstaat nicht zu halten.“[28]
Von einer selbsttragenden Entwicklung aber sind die fünf neuen Länder weit
entfernt. Der Osten hängt am Finanztropf des Westens und das auf unabsehbare
Zeit. Schon jetzt gilt es als ausgemacht, dass sich an den Solidarpakt I, der
im Jahre 2005 auslaufen wird, nahtlos ein Solidarpakt II anschließen soll.
Staatlich finanzierte Arbeitsbeschaffungs- und Weiterbildungsmaßnahmen verschleiern
das wahre Ausmaß der Arbeitslosigkeit: Die offizielle Quote sagt nur die halbe
Wahrheit. Das ist durchaus wörtlich zu verstehen, denn die Zahl der Umschüler
und ABM-Kräfte ist in manchen Gegenden der neuen
Länder so hoch wie die offizielle Zahl der arbeitslos gemeldeten.
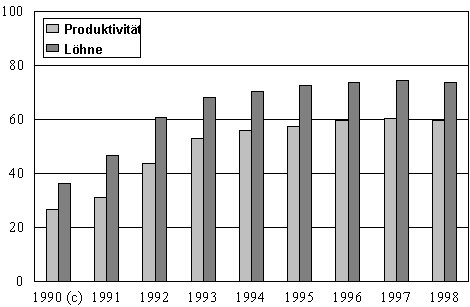
Grafik 1 Relative
Arbeits-Produktivität und Relative Löhne in Ostdeutschland (Westdeutschland =
100)
Quelle: DIW, IfW, IWH (1999); aus dem Englischen
nach Klodt,
S. 2
Aus den strukturschwachen Gebieten wandert die Jugend in größere Städte oder gleich gen Westen. Nach wie vor gibt es eine signifikante Netto-Wanderungsbewegung von Ost nach West, die in letzter Zeit auch wieder stärker geworden ist.[29] Was zurückbleibt, sind sozialer Sprengstoff, entvölkerte Stadtteile[30] und „national befreite Zonen“.
Aber gab es denn überhaupt eine Alternative? Es gab!
Der konsequenteste Weg wäre die Anerkennung der Staatsbürgerschaft der DDR gewesen. Die Staatsführung der DDR hatte dies bereits seit Gründung der beiden deutschen Staaten gefordert. Die Bundesrepublik ist aus guten Gründen sehr lange nicht darauf eingegangen. Gegen Ende der 80-er-Jahre formierte sich aber auch an der SPD-Basis eine Strömung, die sich für die Anerkennung einsetzte. Spätestens seit der freien und geheimen Wahl der Volkskammer am 18.03.1990 und von Lothar de Maizière zum Ministerpräsidenten der DDR ist jedoch die moralische Rechtfertigung der Nicht-Anerkennung entfallen, die ja hauptsächlich darin bestand, ein System, das Deutsche in Unfreiheit hielt, nicht diplomatisch stärken zu wollen und den Betroffenen eine Alternative mindestens anzubieten. Angesichts der beschriebenen Konsequenzen der Vereinigung in der vorgenommenen Form muss heute sogar danach gefragt werden dürfen, ob es nicht umgekehrt nach dem Herbst 1989 eher eine moralische Verpflichtung zur Anerkennung der Staatsbürgerschaft gegeben hat.
Was hätte eine solche Anerkennung bedeutet? Das politische Verhältnis der beiden Staaten wäre dem zwischen der Bundesrepublik und Österreich vor dessen Beitritt zur EU im Jahre 1995 vergleichbar gewesen. Das heißt: Man betreibt Handel, die Menschen können frei reisen, es gibt die unterschiedlichsten Formen von Austausch zwischen beiden Ländern. Aber, und das ist entscheidend: Es gibt zwei Währungen und die Bürger des einen Landes können sich nicht so ohne weiteres im anderen Land niederlassen und dort eine Arbeit aufnehmen. Und das hätte wiederum für die DDR (oder wie immer sie sich dann genannt hätte) bedeutet, dass der Lohnkostenvorteil voll zum Tragen gekommen wäre. Der größte Teil der privaten Investitionen, die später von Westdeutschland nach Ungarn, Tschechien, Polen und anderswohin nach Osteuropa geflossen sind, wäre im zweiten deutschen Staat gelandet, weil die Kombination aus geographischer Nähe, gemeinsamer Sprache, vergleichsweise hohem Ausbildungsstand und nur wenig höheren Lohnkosten das östliche Deutschland in den meisten Fällen zur ersten Wahl gemacht hätte. Löhne, Kosten und Preise wären zunächst unverändert geblieben und hätten sich erst allmählich angepasst. Arbeitslosigkeit wäre auch weiterhin ein Fremdwort gewesen. Im Gegenteil hätte die enorme Nachfrage nach der günstigen Arbeitskraft sehr bald dafür gesorgt, dass die Reallöhne steigen; langsam, allmählich, behutsam, ganz ähnlich wie das in Ungarn, Tschechien, Polen zu beobachten war. Nur schneller wäre es gegangen. Und vor allem: Selbstverdient wäre es gewesen.
Deutlicher als für viele Westdeutsche ist die tägliche Arbeit für ihre östlichen Nachbarn mehr als nur ein bloßes Mittel zum Broterwerb. Die Arbeitsgruppe („das Kollektiv“) war für viele eine Art zweite Familie und für manche die Familie schlechthin. Insofern war der Verlust eines Arbeitsplatzes nicht nur ein Verlust materieller Natur, sondern der Verlust der Mitmenschen, des Lebensinhaltes, der Sinngebung. Mochte sein, dass man unterm Strich materiell besser dran war als die polnischen Nachbarn, die Arbeit hatten oder als man selbst noch vor der Wende. Aber der allgemeinen Befindlichkeit ist das Gefühl, eigentlich überflüssig zu sein und vom großen Bruder nur noch alimentiert zu werden, sicher nicht zuträglich gewesen: „Alles verkommt zu einem Gnadenakt des überlegenen Teils, wenn eine Volkswirtschaft eine andere übernimmt, aus der sie gar nichts braucht.“[31] Die tiefe Frustration über die eigene unwürdige Situation hatte verheerende psychische Folgen, die zumindest bis heute andauern und deren Konsequenzen unabsehbar sind.
Wer etwas genauer hinschaute, der merkte, dass in Wirklichkeit auch diejenigen alimentiert wurden, die einen Arbeitsplatz hatten; sei es in einem Treuhandunternehmen, das rote Zahlen schrieb, in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder auch in einem durchsanierten bzw. nagelneuen Unternehmen. Die „privaten Investoren“ ließen sich zwar gerne als solche feiern, meistens aber blieb unerwähnt, dass ihre „privaten Investitionen“ häufig zum überwiegenden Teil und manchmal auch komplett vom Staat getragen wurden (über das Finanzamt, die Treuhand und sonstige Fördertöpfe) und deshalb den Namen „privat“ eigentlich auch gar nicht mehr verdienten. Denn ohne den Staat – der dabei aber immer die Marktwirtschaft im Munde führte – hätte es in der vorliegenden Situation der Währungsunion 1:1 nebst auf dem Fuße folgenden dramatischen Lohnerhöhungen womöglich keine einzige private Investition in Ostdeutschland gegeben. Wozu auch? Die zum Zeitpunkt der Wende unterbeschäftigte westdeutsche Industrie konnte großenteils schon durch Auslastung brachliegender Kapazitäten den neuen Bundesbürgern ihre realsozialistische Warenwelt ersetzen; also ohne zu investieren und mit entsprechend traumhaften Gewinnen. Aber selbst in den Fällen, in denen eine Erweiterungsinvestition nötig geworden ist, hätte es ohne Steuererleichterungen und anderweitige Subventionen keine Veranlassung gegeben, bei mehr oder weniger westdeutschem Lohnniveau diese auf ostdeutschem Grund und Boden vorzunehmen.
Anders beim beschriebenen Szenario der Zweistaatlichkeit: „Echte“ private Investitionen wären erfolgt und die so entstandenen neuen oder neu sanierten Unternehmen würden auch in einer echten marktwirtschaftlichen Konkurrenzsituation zueinander stehen und hätten längst entsprechende Strukturen ausgebildet. Dagegen stand und steht die real existierende Pseudo-Marktwirtschaft in den neuen Ländern, „die Fortsetzung der DDR mit anderen Mitteln“, wo das angeblich ja angestrebte Entstehen privatwirtschaftlicher Unternehmensstrukturen durch die expandierte öffentliche Alimentation der Wirtschaft in Wahrheit ernsthaft behindert wird.[32] Der tiefere Grund dafür, dass es so schwierig ist, die staatliche Förderung für die neuen Länder endlich spürbar zurückzufahren, ist nämlich der, dass es so schwierig ist, eine einmal entstandene Subventionsmentalität (nicht der Menschen, sondern der Unternehmen!) zurückzufahren. Das beste Beispiel hierfür ist wohl die westdeutsche und westeuropäische Stahlindustrie, die – einmal vom Tropf der Förderung genossen – davon einfach nicht mehr lassen will. Als flächendeckendes Phänomen kennt man die Problematik ansonsten auch in Italien und nennt das dort Mezzogiorno-Effekt. Der Osten ist dort im Süden, aber das Problem ist das gleiche.
Die Marktwirtschaft im Osten wäre also echter und entsprechend effizienter, die Menschen zufriedener und der Staat auf beiden Seiten könnte sich „seinen Teil sparen“, sich auf seine ureigensten Aufgaben – u.a. auf die Verbesserung der Infrastruktur – konzentrieren und wäre längst nicht so hochverschuldet wie der real existierende. Schließlich hätte auch nichts dagegen gesprochen, dass sich die beiden Deutschländer unter dem Dach einer gemeinsamen Föderation zusammenschließen, u.a. auch finanzielle Unterstützung – auf zwischenstaatlicher Ebene – vereinbaren und dass irgendwann einmal dann auch zusammengehört, was so zusammengewachsen ist.
Der Münchner Ökonom und Präsident des dortigen ifo
(Institut für Wirtschaftsforschung), Hans-Werner Sinn, hält zwar die Währungsumstellung im Verhältnis 1:1 für
sehr problematisch, glaubt aber, dass sie als solche noch zu verkraften gewesen
wäre; und zwar für beide Seiten: Ausgehend von einem Ostlohnniveau von 7% des
Westlohnniveaus lag das Ostlohnniveau nach der Währungsunion (also nach einer
entsprechenden Aufwertung um den Faktor 5) bei ca. 35% des Westlohnniveaus.
Dies korrespondierte in etwa mit der Kaufkraft des Ostlohnniveaus vor der
Wende. Insofern wäre die Kaufkraft im Osten durch die Währungsunion zunächst
fast unverändert, aber gleichzeitig die neuen Länder für (im o.g. Sinne echte)
private Investoren noch attraktiv genug geblieben. Auch die Gefahr einer
schnellen Abwanderung in den Westen wäre kaum gegeben gewesen, da
Arbeitsmigration zwar durch Arbeitslosigkeit induziert werde, nicht aber durch
starke Reallohndifferenzen. Sinn
verweist in diesem Zusammenhang auf entsprechende empirische Belege. Auch noch
in dieser Situation hätten die Investoren im Wettbewerb um knappe Arbeitskräfte
selbst höhere Löhne angeboten und: „Die
Angleichung der Lebensumstände wäre schneller gekommen, als wir sie so erwarten
können.“[33]
Aber diese (vorläufig letzte) Chance wurde durch die von westlichen Politikern, Arbeitgebern und Gewerkschaften verantwortete – aber eben unverantwortliche – Lohnpolitik zunichte gemacht: Zwischen 1990 und 1996 wurden dem Osten Lohnerhöhungen von insgesamt 1.100% verordnet: „Diese Entscheidungen haben das industrielle Kapital vernichtet.“[34] Westunternehmer fürchteten unternehmerische und Westgewerkschaften fürchteten Lohn-Konkurrenz aus dem Osten. In seltener Eintracht sorgten beide dafür, dass beides nicht passierte und gerierten sich dabei noch als im Interesse der betroffenen Menschen im Osten handelnd. Sinn dazu: „Das war eine bewusste Strategie, um die Weststandorte zu halten.“[35]
Ökonomen – beider Seiten – hielten es für eine Selbstverständlichkeit, von einer längeren Periode der allmählichen Annäherung der wirtschaftlichen Verhältnisse der beiden Staaten ausgehen zu können und waren fast ausnahmslos gegen die Sturzgeburt Beitritt und vor allem gegen die Konditionen der Währungsreform; durchaus um die Konsequenzen für die ostdeutsche Wirtschaft wissend. Es gab diverse Interventionen seitens der Wissenschaft:[36] Sachverständigengutachten waren voll kritischer Töne und Warnungen. Selbst der Regierung nahestehende Gremien wie wissenschaftliche Beiräte beim Finanz- und beim Wirtschaftsministerium machten Verbesserungsvorschläge. Aber die Bundesregierung hat sich über alles hinweggesetzt.[37] Die Politik hat die ökonomischen Zusammenhänge einfach ignoriert.
Der seinerzeitige Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl weilte gerade in Ost-Berlin und
wähnte sich mit dem Kanzler einig darüber, dass es noch viel zu früh sei, die
Währungsunion auch nur zu planen, als ihn die Meldung aus Bonn ereilte: „Kohl will sofortige Verhandlungen über
die Wirtschaftsunion.“ Pöhl hatte
es zwar öffentlich nie bestätigt, ist aber mutmaßlich aus Protest gegen die
Währungsunion vorzeitig von seinem Amt zurückgetreten. Jedenfalls hatte er 1993
vor dem Treuhand-Untersuchungsausschuß im Bonner Bundestag ausgesagt, dass die DDR-Wirtschaft durch
die Währungsunion „uno actu“ nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen sei. So
ähnlich sei das gewesen, als wenn man „die
D-Mark in Österreich einführen und den
Schilling 1:1 umstellen würde“.[38]
Statt die Menschen in Ost und West auf „blood, sweat and tears“ einzuschwören, wofür in dieser historischen Situation die Bereitschaft seitens der Bevölkerung beider deutscher Staaten durchaus gegeben gewesen wäre, wurden vollmundig und in unverantwortlicher Weise „blühende Landschaften“ – und diese auch noch kurzfristig – angekündigt, was nachfolgende Enttäuschung und Unzufriedenheit fast zwingend zur Konsequenz hatte. „Blühende Landschaften“ ließen sich zwar nach Vollzug der Währungsunion nicht mehr schaffen, wohl aber Bundestagswahlen gewinnen. Kohls seinerzeitiger Kontrahent Oskar Lafontaine wies zurecht darauf hin, dass die Konsequenz der Währungsunion ein Millionenheer von Arbeitlosen im Osten Deutschlands sein würde und resümierte: „Was wirtschaftlich falsch ist, kann politisch nicht richtig sein“. Er hatte mit seiner Prognose zwar Recht behalten, die Wahl aber verloren.
Mittlerweile scheint sich aber die Wahrheit zumindest bei den Betroffenen herumgesprochen zu haben: 64% der Menschen im Westen und sogar 46% im Osten waren Mitte September 2000 der Meinung, dass die D-Mark nicht so schnell und nicht zum Kurs von 1:1 bzw. 1:2 hätte eingeführt werden dürfen.[39] Aber die Mischung aus hohen Löhnen, niedriger Produktivität und entsprechend Lohnstückkosten, die um ein gutes Drittel über dem westdeutschen Niveau liegen, bleibt das zentrale Problem der ostdeutschen Wirtschaft. Deshalb ist der Zeitpunkt günstig, erneut über Sinns Vorschlag nachzudenken, die Beschäftigten im Gegenzug zu Lohnsenkungen an den Unternehmen zu beteiligen. Die Betriebe würden mehr Gewinne machen, wären kreditwürdig und könnten expandieren. Und die arbeitenden Menschen wären motiviert, den Wert ihrer Beteiligungen zu mehren, könnten allmählich Vermögen akkumulieren und wären nicht zuletzt auch mittel- bis langfristig in der Lage, selber Kredite aufzunehmen und sich so auch in einem eigentumswirtschaftlichen Sinne in das Wirtschaftsleben einzubringen.
3. Die
Treuhandanstalt
Am 1. März 1990 wurde auf Vorschlag des Runden Tisches die Gründung einer „Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums“ beschlossen und am 15. März – also noch vor den ersten freien Wahlen – vom Ministerrat der DDR bestätigt. Auf Beschluss der Volkskammer (Treuhandgesetz vom 17. Juni 1990) erhielt die dann bereits so genannte Treuhandanstalt (THA) von der Regierung de Maizière ihren eigentlichen Auftrag:
- Privatisierung und Verwertung des ihr übertragenen volkseigenen Vermögens
- Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler Unternehmen
·
Unterstützung
der Sanierung und Strukturanpassung der Unternehmen an die Erfordernisse des
Marktes
- Förderung der Entwicklung effizienter Unternehmensstrukturen
- Bereitstellung von Grund und Boden für wirtschaftliche Zwecke
Neben der Berliner Zentrale wurden 15 Niederlassungen in den Bezirkshauptstädten der DDR erreichtet. Die Zahl der Beschäftigten in der Treuhandanstalt lag im November 1990 bei 900 und stieg bis März 1992 auf fast 5.000 an. Nach Treuhandgesetz und Einigungsvertrag war sie eine sog. rechtsfähige bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts und als selbständige Verwaltungseinheit vom Bund ausgegliedert. Das bedeutete u.a., dass sie dem Haushaltsrecht des Bundes entzogen war, ihren Haushalt selbst aufstellen konnte und Ressourcen- und Budgetgewalt hatte. Sie konnte also eigenständig Schuldverschreibungen in den Kapitalmarkt geben und dort Geld aufnehmen und machte davon später auch regen Gebrauch.
8.500 ehemals volkseigene Betriebe und Kombinate mit etwa 70.000 Betriebsstätten und anfangs ca. 4,1 Mio. Beschäftigten, rund 25.000 Liegenschaften und ca. 2,4 Mio. Hektar land- und forstwirtschaftliche Nutzfläche wurden treuhänderisch übernommen und sollten in die soziale Marktwirtschaft überführt werden.[40] Aber nach der Währungsunion war die Treuhandanstalt im Prinzip vor die Aufgabe gestellt, ein unlösbares Problem zu lösen und konnte insofern von Anfang an nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Unabhängig von den jeweiligen Eigentumsverhältnissen gab es und gibt es in einer derartigen Situation – im Hinblick auf die Einzelunternehmen wie auch im Hinblick auf die gesamte Volkswirtschaft – nur 3 Möglichkeiten:
1. Alimentation: Ausgleich der laufenden Verluste
2. Liquidation: Stillegung und Abwicklung, Veräußerung der Liquidationswerte
3. Investition: Sanierung, Erhöhung des Kapitalstocks und Anhebung der Produktivität auf ein konkurrenzfähiges Niveau
Am Anfang stand die Alimentation: Bereits in den ersten beiden Monaten brauchte die Treuhand 30 Mrd. DM, um das Schlimmste zu verhindern.[41] Im September 1990 waren drei Viertel aller Treuhand-Unternehmen insolvent. Es war klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Das erste und im Jahre 1990 auch einzige Unternehmen, das in die Liquidation geschickt wurde, war ausgerechnet der bis dahin als Juwel gehandelte Kamerahersteller Pentacon in Dresden. Die Reaktion in der Öffentlichkeit war entsprechend. Betriebswirtschaftlich ging die Entscheidung gleichwohl in Ordnung, denn die technische Ausstattung der Kameras Marke Praktika stand in keinem Verhältnis zu den Preisen, die mittlerweile hätten verlangt werden müssen, um auch nur Kostendeckung zu erreichen und die Alimentations-Rechnung hätte sich auf ca. 100 Mio. DM jährlich belaufen. Aber mit dem Namen des Unternehmens verband sich doch auch ein Stück Stolz auf die bisherige Volkswirtschaft der DDR. Also hielt man sich mit Schließungen fürderhin vornehm zurück; jedenfalls bis zur Bundestagswahl im Dezember. Danach ging es allerdings Schlag auf Schlag.
Die dritte Möglichkeit, die der Sanierung, war in
vielerlei Hinsicht problematisch: Zunächst waren die Unsummen, die nötig
gewesen wären, um die gesamte ehemalige Volkswirtschaft der DDR auf ein dem
Westen vergleichbares Produktivitätsniveau zu heben – und das möglichst noch
von einem Tag auf den anderen – einfach nicht verfügbar und so ohne weiteres
auch nicht beschaffbar. Ohnehin wurde von Ökonomen kritisiert, dass die
Kapitalisierung Ostdeutschlands zu schnell voranschritt. Denn ob nun der Staat
oder auch die private Hand Kredite aufnahmen, um Investitionen (oder die
Kaufpreise der Treuhandanstalt) zu finanzieren: In beiden Fällen induzierte die
Schuldenaufnahme eine Tendenz der Kapitalmarktzinsen nach oben. Hohe Zinsen stellen
aber immer eine Gefahr für eine prosperierende Konjunktur dar. Für die
Treuhandanstalt selbst hatten die höheren Zinsen auch noch den unangenehmen Nebeneffekt,
dass dadurch der Ertragswert der Objekte und entsprechend die Kaufpreisangebote
weiter sanken. Vergleichbares galt, als der Staat zum Zwecke der Finanzierung
die Steuern erhöhte (bzw. die Steuererhöhung Solidaritätszuschlag nannte). Aber
selbst für den theoretischen Fall, dass die Finanzierungsfrage als solche nicht
existiert hätte, wären dann noch immer keine Märkte gefunden gewesen für die
vielen neuen Waren, die plötzlich durch die hohe Produktivität im Osten
Deutschlands entstanden wären.[42]
Mithin war klar, dass jedenfalls über Nacht nicht alles sanierbar war und es
deshalb notwendig wurde, die Spreu vom Weizen zu trennen. Breuels Vorgänger Detlev Carsten Rohwedder gab das zum geflügelten Wort
gewordene Motto aus: „Schnell
privatisieren, entschlossen sanieren und behutsam stilllegen.“
In der Realität des Alltags ging die Treuhandanstalt allerdings von dem Grundsatz aus, dass Privatisierung die beste Form der Sanierung darstellt. Unter keinen Umständen sollten potentielle Investoren etwa dadurch abgeschreckt werden, dass die Treuhand die Unternehmen vorher „in die falsche Richtung“ saniert hat. Deshalb wurden anfangs nur sog. „investorneutrale Investitionen“ vorgenommen, von denen man annahm, dass sie unabhängig vom Sanierungskonzept der jeweiligen Investoren Gefallen finden würden. Für die Privatisierung nach erfolgter Sanierung durch den Staat gab es Beispiele aus England und auch aus Chile, die allerdings unter Effizienzkriterien nicht sonderlich überzeugen konnten. In der Tat gleicht es der Quadratur des Kreises, die Überführung einer Staatswirtschaft in eine Privatwirtschaft, die man ja will, weil sie effizienter ist, also die eingesetzten Ressourcen zu einer vergleichsweise höheren Wertschöpfung führt, mit einer nachgewiesenermaßen weniger effizienten, aber dennoch millionenschweren staatlichen Maßnahme einleitet. Dennoch ist die Treuhandanstalt in ihrer Endphase unter starkem politischem Druck wieder von diesem Prinzip abgerückt und hat in Extremfällen sogar gefährdete Unternehmen „zurückgekauft“.
„Mindestens 600 Milliarden Mark ist der ganze Salat wert.“[43] Dieser von Rohwedder wörtlich so genannte Betrag wurde später immer wieder den zum Ende der Treuhandanstalt tatsächlich aufgelaufenen Schulden i.H.v. 270 Mrd. DM gegenübergestellt; immerhin eine Differenz von annähernd einer Billion DM. Rohwedder wurde bekanntlich von der RAF erschossen und konnte deshalb nicht mehr erklären, dass die Differenz im Wesentlichen im Unterschied zwischen Substanzwert und Ertragswert begründet liegt. Denn legt man den Substanzwert zugrunde, so lag Rohwedder mit seiner Schätzung gar nicht so falsch.[44] Und womöglich hätte die Treuhandanstalt auch tatsächlich Privatisierungserlöse in dieser Größenordnung getätigt. Das hätte aber auch bedeutet, dass die Käufer in den allermeisten Fällen die Betriebe geschlossen, die Beschäftigten entlassen und hauptsächlich die Immobilien verwertet hätten; und die Arbeitslosenquote hätte sich womöglich der 100%-Marke angenähert.
Das hätte aber weder dem Auftrag der Treuhandanstalt entsprochen, noch der wirtschaftspolitischen Zielsetzung. Denn die Arbeitsplätze sollten ja so weit wie möglich erhalten werden. Deshalb sollten sich die Investoren ja auch zum Erhalt der Arbeitsplätze verpflichten. Die Verpflichtungen wurden auch vertraglich festgeschrieben und pönalisiert, d.h. mit entsprechenden Vertragsstrafen besichert. Spätestens dann war aber für die potentiellen Investoren nicht mehr der mögliche Substanzwert, sondern der Ertragswert der Unternehmen interessant. Und dieser war eben aufgrund der dargestellten Lücke zwischen Produktivitäts- und Lohnniveau entsprechend niedrig und teilweise sogar negativ. Durch die Währungsunion waren die Maschinen gewissermaßen über Nacht veraltet und der Auftragsbestand annähernd auf Null gesunken, aber die laufenden Kosten durch Lohnzahlungen stark angestiegen. Die seitens der Treuhand geforderten vertraglich vereinbarten Verpflichtungen minderten die gebotenen Kaufpreise noch weiter. Ökologische Altlasten und die sog. Altschulden der Unternehmen taten ein Übriges. So erklärt sich endlich auch die Praxis der Treuhandanstalt, Unternehmen zum Preis der berühmten einen Mark bzw. sogar zu einem sog. „negativen Kaufpreis“ zu veräußern; will heißen, die Investoren bekamen die Unternehmen einschließlich finanzieller Mittel, um die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen selbst vornehmen zu können, aber selbstverständlich nur unter der vertraglich vereinbarten Bedingung, Arbeitsplätze zu schaffen bzw. zu erhalten, Gewinne zu reinvestieren, im Falle einer sehr guten Performance des Unternehmens geleistete Mittel zurückzuzahlen etc..
So schmolzen die ursprünglich geschätzten 600 Mrd. DM auf immerhin noch 74 Mrd. DM am Ende der Treuhandanstalt zusammen. Diesen Einnahmen standen jedoch Aufwendungen für die Sanierung ökologischer Altlasten i.H.v. 44 Mrd., für die unternehmerisch-finanzielle Sanierung einschließlich Abwicklung i.H.v. 154 Mrd. und für die Übernahme von Altkrediten i.H.v. 105 Mrd. gegenüber, so dass das Endergebnis ein negativer Saldo von 270 Mrd. DM war. Die sog. Altschulden bzw. Altlasten bzw. Altkredite bedürfen noch einer gesonderten Betrachtung: In Abgrenzung zu den Schulden, die seitens der Treuhand-eigenen Betriebe nach der Währungsunion in DM entstanden, handelte es sich dabei um diejenigen Schulden, die die staats- bzw. volkseigenen Unternehmen vor der Wende bei der Staatsbank der DDR hatten und die zum 1. Juli ebenfalls auf DM umgestellt worden waren. Ihnen standen die Guthaben der Privatkunden der Staatsbank der DDR gegenüber. So versteckte sich letztlich die Gegenbuchung zum „Zaubergeld“ vom 1. Juli 1990 in der Bilanz der Treuhandanstalt und damit in ihrem Schuldenberg, welcher ihr nicht zuletzt von denen zum Vorwurf gemacht wurde, die selber in den Genuss des DM-Wunders gekommen waren.
Dieses Beispiel illustriert aber nur das systematische Prinzip der Treuhandanstalt als Sündenbock, als Watschenmann der Politik; und zwar für Kritik aus Ost und West: Wurde sie von den Ostdeutschen der Zerstörung von Millionen von Arbeitsplätzen und des Plattmachens Tausender von Betrieben bezichtigt, so war sie für die Westdeutschen in erster Linie eine gigantische Kapitalvernichtungsmaschine. Wenn die Treuhand schnell privatisierte, verscherbelte sie Produktivvermögen, wenn sie liquidierte, vernichtete sie Arbeitsplätze und wenn sie Hilfsgelder für marode Betriebe zur vorübergehenden Sicherung der Liquidität zur Verfügung stellte, war sie eine Geldverschwenderin spätestens dann, wenn das Unternehmen schließlich doch abgewickelt werden musste. Dass die Treuhandanstalt in erster Linie als Vollstrecker grundlegender wirtschaftspolitischer (Fehl-)Entscheidungen fungierte, die längst getroffen worden waren, wurde von beiden deutschen Seiten nicht verstanden und sollte wohl auch gar nicht verstanden werden: „Für Bonner Politiker ist die Treuhandanstalt von Anfang an der Blitzableiter, damit es bloß nicht bei ihnen, also in der Wahlurne einschlägt, sondern der Zorn der Ostdeutschen immer eine andere feste Adresse hat.“[45] Wiederholt tauchte Bundesfinanzminister Waigel in der Berliner Zentrale der Treuhandanstalt auf, um vor den versammelten Mitarbeitern, die sehr häufig auch persönlichen Angriffen ausgesetzt waren, Durchhalteparolen auszugeben und zu versichern, wie unverbrüchlich Bonn hinter ihnen stehen würde. Das stand dann aber in keiner Zeitung. Statt dessen kursierte auf den Fluren der Bonner Ministerien das Motto: „Rettet Bonn, opfert die Treuhand!“ Welche Rolle sie auch höchstpersönlich spielte, machte Birgit Breuel am Ende ihrer Amtszeit unmissverständlich deutlich: „Mit unseren Entscheidungen haben wir intensiv in das Leben vieler Menschen eingegriffen. Wo sollten sie denn hin mit ihrem Zorn und ihrem Hass? Sie konnten nur zu uns gehen, und das ist auch so in Ordnung gewesen.“ [46]
Bei der „größten Holding der Welt“ wurde von Anbeginn alles mit der heißen Nadel gestrickt. Im Herbst 1990 hatte die Treuhand überhaupt keinen Überblick darüber, was ihr eigentlich alles gehörte. Aber die Geschäftsführer der noch gar nicht erfassten Betriebe standen bereits in der Tür und baten dringend um Hilfe. Weil das operative Tagesgeschäft derart mit Brachialgewalt auf die Schreibtische drückte, hatte man schlicht gar keine Zeit zur Reflexion und zur Entwicklung von Strategien und Konzepten. Die Privatisierungsteams arbeiteten weitgehend unabhängig von vorgegebenen Richtlinien und sogar unabhängig voneinander. Sämtliche Entscheidungen basierten auf Einzelfallprüfungen ohne Regelbindung. Es gab keine Vergabeverfahren nach festen Kriterien. Diese Praxis führte u.a. auch dazu, dass die jeweilige Entscheidung der Treuhand für Außenstehende nicht an konkreten Maßstäben messbar und deshalb auch häufig nicht nachvollziehbar war und gab später – v.a. auch vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages – Anlass zu massiver Kritik.
Das Fehlen allgemeinverbindlicher Regelungen und Richtlinien im Bereich der Privatisierung wurde im Bereich der Reprivatisierung wieder wettgemacht: Ein Vermögensgesetz, ein Vermögensrechtsänderungsgesetz, ein DM-Bilanz-Gesetz, ein Unternehmensgesetz noch aus der Modrow-Zeit und eine Unternehmensrückgabeverordnung bildeten zunächst die rechtliche Grundlage für die sog. Naturalrestitution, also die körperliche Rückgabe von enteigneten Vermögenswerten wie Grundstücken und Immobilien, aber auch Unternehmen und stillgelegten Betriebsteilen. Dazu gesellten sich später ein Sachenrechtsbereinigungs-, ein Ausgleichsleistungs-, ein Entschädigungs-, ein Bodensonderungs- und ein DDR-Schuldbuchbereinigungsgesetz, eine Grundstücksverkehrs-, eine Schuldverschreibungs- und eine Hypothekenablöseverordnung bis hin zu einer „Kraftloserklärung von Reichsmark-Wertpapieren“. Hinzu kamen zahlreiche Durchführungsverordnungen und Durchführungsbestimmungen, „Leitfäden“ des Bundesjustizministeriums, Gerichtsurteile und umfangreiche Querverbindungen zu bereits bestehenden Gesetzen und Verordnungen. Allein der einschlägige dtv-Gesetzestext, die „Kurzfassung“ also, umfasste ohne Kommentare nicht weniger als 50 maßgebliche und aus Platzgründen zum großen Teil nur auszugsweise abgedruckte Gesetze, Verträge, Verordnungen und Richtlinien auf über 500 engbedruckten Seiten.
Dabei war das Prinzip „Rückgabe vor Entschädigung“ sowohl im Längs- wie im Querschnittsvergleich ohne Beispiel: In keinem anderen osteuropäischen Land – noch nicht einmal in der ehemaligen Sowjetunion – kam im Zuge der Transformation der Ökonomien dieses Prinzip in Frage; aus gutem Grund. Auch in der Vergangenheit lassen sich dafür jedenfalls keine erfolgreichen Beispiele finden. Beim Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik 1957 hat es – obzwar seinerzeit ebenfalls gefordert – ausdrücklich ein derartiges Prinzip nicht gegeben. Aber offenbar aufgrund einer starken diesbezüglichen Lobby und aus Angst vor voluminösen Entschädigungsansprüchen hat die Regierungskoalition das Prinzip sogar zur Bedingung für den Einigungsvertrag gemacht.[47]
Das Rückübertragungsverfahren war alles andere als unkompliziert: Bei den eigens zu diesem Zweck geschaffenen Ämtern bzw. Landesämtern zur Regelung offener Vermögensfragen wurden die Anträge auf Rückübertragung gestellt. Diese Behörden prüften zunächst die Berechtigung der Anspruchsteller anhand von historischen Grundbuchauszügen, Gesellschafterverträgen, Bilanzen zum Zeitpunkt der Enteignung etc.. Formal betrieben die Ämter das Rückübertragungsverfahren, setzten es aber normalerweise „zur gütlichen Einigung“ zwischen der Verfügungsberechtigten, also im typischen Fall der Treuhandanstalt, und den Anspruchstellern aus. Aufgrund der Unmenge an Anträgen, die die Ämter insbesondere in der Anfangszeit überflutete (s.u.), war es nicht ungewöhnlich, dass Anspruchsteller bei der Treuhand auftauchten, die zwar noch keine Berechtigung nachweisen konnten, sich aber gleichwohl – von auf das Vermögensrecht spezialisierten Anwälten unterstützt – auf Rechtsansprüche beriefen und Forderungen in Millionenhöhe im Munde führten. Meistens handelte es sich um Kinder, Enkel oder anderweitige Erben der ehemals Enteigneten, die zwar nicht unbedingt Branchenkenntnisse mitbrachten,[48] aber ihre Rechtsansprüche oder doch zumindest die Aussicht darauf. Teilweise waren sie aber auch gar nicht verwandt, sondern hatten sich die Ansprüche notariell – gegen Geld oder auch nicht – abtreten lassen, was rechtlich möglich war.[49] Seltener traten die ehemals Enteigneten in persona auf, was aber die betriebswirtschaftlichen Erfolgschancen der Reprivatisierung nicht unbedingt erhöhte. Denn abgesehen davon, dass sie sich meistens schon im Rentenalter befanden, waren sie oft seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten nicht mehr in der Branche tätig. Kam es schließlich zur „gütlichen Einigung“, die die eigentliche Rückübertragung, evtl. Ausgleichszahlungen und evtl. Verpflichtungen der Berechtigten umfasste, so wurde selbige vertraglich fixiert und anschließend von den Ämtern zur Regelung offener Vermögensfragen „festgestellt“, ein entsprechender Bescheid erlassen, dieser – soweit niemand Einspruch erhob – nach einem Monat „bestandskräftig“, was schließlich die Grundbuchämter zur Umschreibung des Eigentums veranlasste, soweit diese nicht überlastet waren, was aber meistens der Fall war.
Vor dem Hintergrund einer Bewertung unter wirtschafts- und strukturpolitischen Gesichtspunkten ist der Paragraphenwirrwarr ein einziges Kompendium von Absurditäten. Dazu zwei Beispiele:
- Die
berechtigten Anspruchsteller hatten einen Anspruch auf Rückübertragung der
enteigneten Vermögensgegenstände. Soweit es sich um lebende Unternehmen
handelte, hatten sie einen zusätzlichen Anspruch auf einen finanziellen
Ausgleich im Falle einer mittlerweile eingetretenen Überschuldung; genannt
„Ausgleichsleistung wegen wesentlicher Verschlechterung der Vermögenslage“
(§ 6 Abs. 2 VermG). Darüber hinaus hatten sie Anspruch auf Leistungen zur
Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, also auf Erhöhung des
Kapitalstocks, um auf ein weltmarktfähiges Produktivitätsniveau zu kommen
und um konkurrenzfähig anbieten zu können; genannt „Ausgleichsleistung wegen
wesentlicher Verschlechterung der Ertragslage“ (§ 6 Abs. 4 VermG). Dieser
„Ertragsausgleich“ war häufig wertmäßig viel bedeutender als der
Substanzwert des rückzuübertragenden Vermögens, überstieg diesen teilweise
sogar um ein Vielfaches und avancierte so zum eigentlichen „Objekt der
Begierde“. Allerdings war die Auszahlung abhängig davon, dass die
Sanierungsfähigkeit des Unternehmens attestiert werden konnte. Die berechtigten
Anspruchsteller hatten ein Sanierungskonzept einzureichen, welches von den
wenigen Wirtschaftswissenschaftlern in den Reprivatisierungsabteilungen geprüft
und beurteilt wurde.
Der Ertragsausgleich war der dickste Haushaltsposten im Bereich Reprivatisierung.[50] Er war seiner Höhe nach, vor allem aber im Hinblick darauf, ob er überhaupt geleistet werden musste (und im Gegensatz zu den rückzuübertragendenden Vermögensgegenständen) von direkter Relevanz für die Bilanz der Treuhandanstalt, für den Bundeshaushalt, für den Steuerzahler. Ganz im Widerspruch zu seiner Bedeutung aber führte er im Rahmen der rechtlichen Ausgestaltung der Reprivatisierung ein absolutes Schattendasein. Die alles entscheidende Frage gar, nämlich ob nun Sanierungsfähigkeit gegeben ist oder nicht, war den Verfassern des Konvoluts von Gesetzen, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen und Leitfäden keinen einzigen Paragraphen wert, auch keinen Absatz, nicht einmal einen vollständigen Satz, sondern gerade einmal einen kleinen Nebensatz: „Müssen neue Produkte entwickelt werden, um einen vergleichbaren Umsatz zu erzielen, so besteht in Höhe der notwendigen Entwicklungskosten ein Erstattungsanspruch, es sei denn, das Unternehmen ist nicht sanierungsfähig.“ (§ 6 Abs. 4, Satz 2 VermG) Das war alles: Keine objektiven Maßstäbe, keine Vergleichsmomente, keine Verhältniswerte zwischen zu schaffenden Arbeitsplätzen bzw. erwarteten Gewinnen und aufzuwendenden Investitionen, nichts dergleichen.[51]
- War
das Unternehmen nun für sanierungsfähig befunden worden, so ging es um die
Berechnung der Höhe des Ertragsausgleiches. Wiederum in krassem Gegensatz
zu seiner Bedeutung gestaltete die „Unternehmensrückgabeverordnung“ die
Berechnung des Ertragsausgleiches recht übersichtlich: „Eine wesentliche Verschlechterung der
Ertragslage wird bei sanierungsfähigen Unternehmen pauschal in der Weise
ausgeglichen, dass dem Unternehmen eine Ausgleichsforderung in Höhe des
Betrags der in der für die Übergabe maßgeblichen Bilanz ausgewiesenen
Sonderposten nach § 17 Abs. 4 und § 24 Abs. 5 des D-Markbilanzgesetzes
zuzüglich des Sechsfachen, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 des Dreifachen,
des in der Gewinn- und Verlustrechnung nach Absatz 1ausgewisenen Fehlbetrages
eingeräumt wird.“ (§ 6 Abs. 2 Satz 1 URüV)
Das bedeutete: Völlig unabhängig von der zur Debatte stehenden Branche, von der konkreten Situation des Unternehmens und seinem Finanzbedarf, von den geplanten Produkten und auch vom kurz zuvor eingereichten Unternehmenskonzept, kurz unabhängig von der betriebswirtschaftlichen Sinnhaftigkeit war die allein maßgebliche Größe für die Berechnung des Ertragsausgleiches der eingetretene Verlust während eines der zurückliegenden Geschäftsjahre. Die Treuhänder reimten fröhlich: „Nimm Papier und Blei, multipliziere mal drei.“ Diese Praxis führte nun regelmäßig dazu, dass manche Unternehmen weniger, manche aber auch mehr Ertragsausgleich erhielten, als betriebswirtschaftlich sinnvoll und einer Sanierung zuträglich gewesen wäre. Glücklicherweise setzte sich jedoch zumindest in der Berliner Zentrale der Treuhandanstalt allmählich die sog. „Einzelfallberechnung“ durch; nicht so jedoch in den Niederlassungen, wo entweder in Ermangelung von Personal oder aber auch von betriebswirtschaftlicher Kompetenz die „Pauschalberechnung“ weitergeführt wurde. Kam es zu keiner „gütlichen Einigung“ zwischen Treuhandanstalt und berechtigten Anspruchstellern, so war spätestens vor Gericht der alleinige Maßstab wieder die „Pauschalberechnung“.
Viele Menschen hatten Wohnungen und Einfamilienhäuser in der DDR in gutem Glauben und systemimmanent auch rechtmäßig erworben, waren dort bereits seit Jahren und Jahrzehnten ansässig und standen nun vor einer Tragödie oder hatten wenigstens mit der Angst zu tun, hinausgeworfen zu werden. Genauso schlimm war aber der vermögensrechtliche Grundsatz, dass die Anmeldung eines vermögensrechtlichen Anspruches eine sog. Verfügungssperre (§ 3 Abs. 3 bis Abs. 5 VermG) auslöste. Die meistens verfügungsberechtigte Treuhandanstalt konnte ab sofort nicht mehr verkaufen, der Investor nicht mehr erwerben und folglich auch nicht mehr investieren. Im Herbst 1992 lagen bereits über 2 Millionen Restitutionsansprüche vor,[52] von denen sich drei Viertel auf Grundstücke und Gebäude richteten. Halbe Städte waren von Rückübertragungsansprüchen betroffen. Da gleichzeitig die gesetzlichen Grundlagen (s.o.) dafür gelegt waren, dass sich weder die vermögensrechtlichen Ansprüche rasch klären ließen,[53] noch die Reprivatisierung als solche zügig zu Ende gebracht werden konnte, passierte ausgerechnet in einer Situation, die privater Initiative dringender bedurfte denn je, erst einmal nichts.
Die Problematik der ungeklärten vermögensrechtlichen Verhältnisse avancierte mit zum größten Hindernis für einen strukturellen Aufschwung in den neuen Ländern und wurde bald auch in der öffentlichen Diskussion als solches erkannt. Bereits Rohwedder beurteilte die Regelung, dass auch bei Immobilien Rückgabe an die Alteigentümer vor der Entschädigung steht, als stärkste Bremse eines Aufschwungs.[54] Für den sächsischen Ministerpräsidenten, Prof. Kurt Biedenkopf, war das Rückgabeprinzip „ein formidables Investitionshemmnis“ und das Vermögensgesetz ein „Dokument fortdauernder nationaler Entzweiung“. Schätzungen des Deutschen Industrie- und Handelstages zufolge wurden Anfang der 90-er-Jahre Investitionen i.H.v. 200 Mrd. DM allein durch offene Vermögensfragen gehemmt.[55]
Die Kritik führte aber nicht etwa zur Beseitigung des Hemmnisses, sondern zu Phänomenen wie dem Hemmnisbeseitigungsgesetz und dem Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz. Eine Monatszeitschrift[56] etablierte sich, die sich exklusiv den anspruchsvollen und komplexen, aber interessanten vermögensrechtlichen Fragestellungen widmete und allein das Berliner Kongreßzentrum ICC war groß genug, um die zahlreichen Teilnehmer der einschlägigen Fachkongresse zu beherbergen. Altbundeskanzler Helmut Schmidt setzte den ganzen Berufsstand auf die Anklagebank: „Heute würde ich am liebsten die Zunft der deutschen Juristen ins Fegefeuer wünschen. Oder besser nach Stralsund, zum Besuch beim Bürgermeister, zum Katasteramt in Potsdam, zum Vorstandsvorsitzenden von Jenoptik oder zur Präsidentin der Treuhandanstalt; dort würden sie begreifen, was sie mit ihrer Vermögensregelung angerichtet haben – und weiterhin anrichten....“[57]
Schließlich wurde das Investitionsvorranggesetz aus der Taufe gehoben, das vom Anspruch her die vermögensrechtliche Verfügungssperre in den Fällen außer Kraft setzen sollte, in denen sich ernsthafte Investoren um ein Objekt bemühten, auf dem ein Restitutionsanspruch lag. Das Investitionsvorranggesetz konnte aber die retardierenden Wirkungen des Vermögensgesetzes nicht mehr wettmachen: Der interessierte Investor musste bei der eigens geschaffenen Investitionsvorrangstelle[58] ein Investitionskonzept einreichen, das dort begutachtet und mit einem eventuellen Gegenkonzept des Anspruchstellers verglichen wurde. Nur für den Fall, dass das Konzept des Investors für dem des Anspruchstellers überlegen befunden wurde (gleichwertig reichte nicht), konnte ein sog. Investitionsvorrangbescheid erlassen werden, der erst einen sog. „investiven Vertrag“ zwischen Treuhandanstalt und Investor ermöglichte, welcher wiederum vertraglich vereinbarte und mit Vertragsstrafen besicherte Verpflichtungen zur Investition, zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen etc. enthalten sollte. Viele Investoren, die beispielsweise nur an einem Grundstück interessiert waren (welches im Gegensatz zu laufenden Unternehmen normalerweise ohne vertragliche Bindungen verkauft wurde), wollten sich aber auf ein solches Spiel nicht einlassen. Die Nachfrage nach Objekten wurde durch die vermögensrechtliche Belastung – trotz Investitionsvorranggesetz – geschwächt und dadurch die von der Treuhand erzielbaren Verkaufspreise weiter gesenkt. Diejenigen Kaufinteressenten aber, die ein Konzept einreichten, hatten zu gewärtigen, dass der Anspruchsteller sich aus Angst, hinterher nicht ausreichend entschädigt zu werden, an seinen Anspruch klammerte und entsprechend mit einem Gegenkonzept konterte. Oft schaukelten sich die beiden Kontrahenten mit völlig realitätsfernen Entwürfen gegenseitig auf und landeten schließlich – wie so viele und wie so vieles im Bereich der Reprivatisierung – bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung.
Ende 1994 waren 14.576 Unternehmen und Unternehmensteile privatisiert, davon 6.464 als laufende Unternehmen. Die Privatisierungsverträge umfassten u.a. Investitionszusagen i.H.v. 206,5 Mrd. DM und Arbeitplatzzusagen im Umfange von 1.487.280 Arbeitplätzen. Reprivatisiert waren 4.291 Unternehmen und Unternehmensteile, davon 1.571 als laufende Unternehmen, kommunalisiert[59] waren 263 und stillgelegt 3.527 Unternehmen und Unternehmensteile.
4. Konklusion
Die Währungsunion vom 1. Juli 1990 hat die gesamte Wettbewerbsfähigkeit der DDR-Volkswirtschaft über Nacht zerstört. Dennoch hätte auch in dieser Situation die Möglichkeit bestanden, in einer Kombination aus moderater Tarifpolitik und degressiver Subventionierung des Produktionsfaktors Arbeit die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen.[60] Für Investoren wären die Unternehmen auch unter Ertragswertgesichtspunkten interessant geblieben und die erzielbaren Privatisierungserlöse wären um ein Vielfaches höher gewesen als die später tatsächlich realisierten. Es hätte privatisiert werden können, aber nicht müssen und die Kapitalbildung für die langfristig notwendige Erneuerung und Erweiterung des Kapitalstocks hätte allmählich vor Ort stattfinden können.
Stattdessen wurde durch weitere exorbitante Lohnerhöhungen menschliche Arbeit immer unattraktiver gemacht, der Produktionsfaktor Kapital immer mehr subventioniert und das Allheilmittel in der Privatisierung gesucht. Dies führte u.a. dazu, dass heute 85% des von der Treuhand privatisierten Firmenvermögens westdeutsches, 10% ausländisches und nur 5% ostdeutsches Eigentum sind. Auch deshalb wird auf absehbare Zeit, so wie in den vergangenen 10 Jahren, die Kapital- und Vermögensbildung im Osten Deutschlands mit der westdeutschen nicht gleichziehen, geschweige denn sie einholen können. Statt dessen wird sich die Vermögensschere weiter vergrößern.
Die Strategie der Kapitalsubventionierung hätte aber zumindest von einer strategischen und intensiven Strukturpolitik begleitet werden müssen, denn die Produktions- und Beschäftigungsstruktur der DDR zum Zeitpunkt der Wende entsprach in etwa der der Bundesrepublik von 1965:[61] Der Anteil des primären, des landwirtschaftlichen Sektors am Bruttosozialprodukt war deutlich höher und der des sog. tertiären, des Dienstleistungssektors deutlich geringer als in der Bundesrepublik der frühen 90er-Jahre. Der sekundäre Sektor der Industrieproduktion war dominiert von Low-Tech-Branchen, die mit vergleichsweise geringer Kapitalausstattung arbeitsintensiv produzierten. Typische Beispiele hierfür waren die Schuh- und die Textilindustrie. Produkte dieser Branchen, insbesondere aus dem unteren Preissegment, wurden im Westen längst aus Billiglohn- und Schwellenländern importiert. Was also im Osten Deutschlands Not tat (und nach wie vor tut), ist eine Umgestaltung, eine Erneuerung der gesamten industriellen Struktur in Richtung innovativer Produkte in Wachstumsbranchen, die ein hohes Lohnniveau ertragen.
Stattdessen wurde die Treuhandanstalt zu einer Hau-Ruck-Privatisierungspolitik veranlasst, bei der die ursprünglich geschätzten Substanzwerte alleine deshalb nicht realisiert werden konnten, weil dabei eine ganze Volkswirtschaft gleichzeitig auf den Markt geworfen wurde. An eine Strukturpolitik war so nicht nur nicht zu denken, Ansätze dazu wurden sogar regelrecht verhindert: Im Rahmen des sog. Flachs-Leinen-Projektes des Landes Sachsen waren auch mehrere Treuhand-Betriebe für die vertikale Integration von Entwicklung und Produktion ökologischer Textilien vorgesehen. Die notwendige Privatisierung scheiterte jedoch u.a. daran, dass die einzelnen Unternehmenskonzepte – isoliert betrachtet – als nicht tragfähig erschienen, da für die neuen Produkte noch keine Marktposition begründet werden konnte. Eine Netzwerkbetrachtung des gesamten Projektes hätte aber zu einem anderen Ergebnis geführt. So unterblieb sinnvolle Koordination öffentlicher und privater Investitionen, eben Strukturpolitik.
Grundsätzlich hat die Treuhandanstalt die zerteilten Kombinate isoliert einzelwirtschaftlich und konventionell betriebswirtschaftlich betrachtet und behandelt. Allein der Bestand an noch nicht verkauften Unternehmen war Richtschnur der Vorgehensweise. Eine von Treuhandgeldern mitgetragene Investition hatte immer die Übernahme eines operierenden Treuhandunternehmens mit allen Konsequenzen und allen Ineffizienzen zur Voraussetzung. Als selbstverständlich galt, dass ein Unternehmen privatisiert wird, „wie es steht und liegt“, also beispielsweise Textilbetriebe in Innenstadtlagen. So wurden weder die Immobilien ihrer auch volkswirtschaftlich ertragsmaximalen Verwendung zugeführt, noch die bis heute brachliegenden Gewerbegebiete genutzt, noch die Arbeitsplätze langfristig wirklich gesichert. Jedenfalls volkswirtschaftlich wäre es oft bedeutend sinnvoller gewesen, ein Altunternehmen zu schließen, aber gleichzeitig ein neues zu gründen und so wenigstens schrittweise eine Orientierung zu finden weg von den veralteten Branchen, für die im Zuge der internationalen Arbeitsteilung längst die Schwellenländer verantwortlich zeichnen, und hin zu einer industriellen Zukunft. So aber war die Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt zusammen mit dem Reprivatisierungsprinzip „Rückgabe vor Entschädigung“ und seinen gesetzlichen Grundlagen die Ursache dafür, dass Deutschland in seine industrielle Vergangenheit investiert hat.
10 Jahre nach der politischen Einheit ist die wirtschaftliche Situation im Osten Deutschlands gekennzeichnet durch ein seit Jahren gleichbleibend niedriges relatives Produktivitätsniveau bei einem gleichbleibend zu hohen relativen Lohnniveau und gleichbleibend zu hohen relativen Lohnstückkosten. Die Konsequenzen sind – seit Jahren und noch auf Jahre hinaus – gleichbleibend hohe Transferleistungen von West nach Ost, die zu einer hohen Staatsverschuldung geführt haben, eine seit 10 Jahren kontinuierlich steigende Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern und Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Diese Konstellation ist weder vom Himmel gefallen noch war sie unausweichlich. Sie ist vielmehr das Ergebnis konkreter politischer Entscheidungen. Es gibt dafür konkrete Verantwortung und konkrete Verantwortliche.
Literatur:
Akerlof, G. / Rose, A. / Yellen, J. / Hessenius, H: “East Germany in from the Cold: The Economic Aftermath of Currency
Union” in: Brookings Papers on Economic Activity 1/1991, S. 1-105.
Blome, N.: „Die Treuhand nutzte die Freiheiten, die ihr die Politik ließ“ in: Die Welt v. 31.08.1994, S. 4.
Breuel, B.: Leserinterview in der Wochenpost v. 25.08.1994, S. 26/27
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben: Bericht über das 1. Halbjahr 1995 v. 28.07.1995.
Dohnanyi, Klaus v.: „Das hohe Wachstum geht auf den Transfer zurück“ in: Handelsblatt v. 04.10.1995, S. B3 f.
DIW-Wochenbericht 12/1991.
Fischer, G. / Schwarzer, U.: „Halden der Arbeit“ in: Manager-Magazin Mai 1995, S. 167 ff.
Fischer, M. / Richter, M.: „Nürnberger Zauberei“ in Wirtschaftswoche Nr. 39 v. 21.09.2000, S. 29.
Gürtler, D.: „Teure Sekunde“ in: Wochenpost v. 29.06.1995, S. 22.
Hankel, W.: Die sieben Todsünden der Vereinigung, Berlin 1993.
Hankel, W.: „Und wenn die Treuhand nur lehrt, wie man es besser nicht machen soll“ (Interview) in: Neues Deutschland v. 02.11.1994.
Hickel, R. / Priewe, J.: Der Preis der Einheit, Frankfurt a.M. 1991.
Hoffmann, L.: Warten auf den Aufschwung, Regensburg 1993.
Hübner, R.: „Die DDR-Betriebe kamen immer zu spät“ in: Der Tagesspiegel v. 10.03.1997.
Jensen, A.: „Marktgläubige Treuhand zerstörte den Markt“ in: taz v. 26.07.1994, S. 7.
Jürgs, M.: Die Treuhändler, München 1997.
Jürgs, M.: „Ein Land im Sonderangebot“ in: Der Spiegel 06/1997 und 07/1997
Kessler, M. / Marschall, B. / Schütte, C. / Sirleschtov, A. / Student, D.: „Sächsischer Break-even“ in: Wirtschaftswoche v. 25.07.1996, S. 14-17.
Kessler, M. / Sirleschtov, A.: „Kopfüber in’s Minus“ in: Wirtschaftswoche v. 06.03.1997, S. 16-18.
Klodt, H.: “Industrial Policy and the
East German Productivity Puzzle”, Paper submitted for the
CES-ifo conference ‘Ten Years after:
German Unification Revisited’ held in Munich in November 1999; erhältlich
beim ifo-Institut, München.
Köhler, O.: “Frühstücksei mit Salat” in: tip 2/1995.
Lichtblau, K.: „Privatisierungs- und Sanierungsarbeit der Treuhandanstalt“ in: Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, Institut der deutschen Wirtschaft (Hrg.), Köln 1993.
Liedtke, R. (Hrg.): Die Treuhand und die zweite Enteignung der Ostdeutschen, München 1993.
Marschall, B.: „Von Hilflosigkeit und Gedankenlosigkeit“ in: Berliner Zeitung v. 04.03.1997, S. 3.
Sachverständigenrat: Jahresgutachten 1990/1991.
Schiller, K.: Der schwierige Weg in die offene Gesellschaft, Berlin 1994
Schmidt, H.: Handeln für Deutschland, Berlin 1993.
Schürer, G.: „Analyse der ökonomischen Lage der DDR mit Schlußfolgerungen, Vorlage für das Politbüro des Zentralkomitees der SED, geheime Verschlusssache b5 1158/89“; veröffentlicht in Deutschland-Archiv 10/1992, S. 1112-1120.
Sinn, G. / Sinn, H.-W.: Kaltstart, Tübingen 1991.
Sinn, H.-W.: „Dann bricht das Chaos aus“ in: Der Spiegel 25/1996.
Sirleschtov, A. / Weidenfeld, U.: „Seltenes Privileg“ in: Wirtschaftswoche No. 34 v. 19.08.1994.
Späth, L.: „Die Deutschen müssen innovativer und risikofreudiger werden“ in: Handelsblatt v. 08.11.1994, S. 6.
Treuhandanstalt: Daten und Fakten zur Aufgabenerfüllung der Treuhandanstalt, Ausgaben 07.06.1994, 06.07.1994, 05.08.1994, 04.09.1994.
Treuhandanstalt: Pressekonferenz der Treuhandanstalt am 25.07.1994, Protokoll und Handout für die Presse.
Treuhandanstalt: Treuhand-Informationen, Ausgabe 21; 30.12.1994.
Voorst, Bruce van: „Treuhand’s End“ in:
Time Magazin 16.01.1995.
Gesetzestexte:
Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz – VermG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August 1997 (BGBl. I S. 1974), BGBl. III FNA Anh. III-19.
Verordnung zum Vermögensgesetz über die Rückgabe von
Unternehmen (Unternehmensrückgabeverordnung – URüV) vom 13. Juli 1991 (BGBl. I
S. 1542), BGBl. III/FNA Anh.
III-19-1.