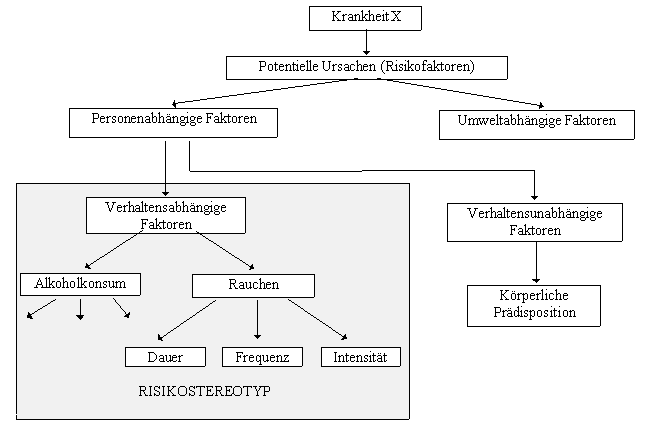
Abbildung 1. Mehrdimensionale hierarchische Struktur einer impliziten Risikofaktorentheorie über die Genese einer Krankheit.
Schlagworte: - Risikoverhalten - Risikowahrnehmung - Vulnerabilität - unrealistischer Optimismus - Stereotyp
People tend to estimate their own risk of becoming a victim as being below average. There are a number of explanations for this positive view of one's future, which is referred to as unrealistic optimism or optimistic bias. Most attempts to explain this phenomenon share the assumption that people have risk-relevant knowledge at their disposal. We assume that this knowledge is organized in the manner of an implicit risk-factor theory, and we suggest a model describing content and structure of such a theory. Part of the individual risk-factor theory includes stereotype images of people at high risk, so-called risk stereotypes that consist of ideas regarding qualitative risk factors (e.g., smoking) as well quantitative aspects of each risk factor (duration, frequency, and intensity). These risk stereotypes are used as a reference point for the evaluation of one's own relative risk. It is assumed that the appraisal of one's own relative risk increases, the more similarities there are to the image of a high-risk person. Within an exploratory study, 72 smokers, 39 ex-smokers, and 40 non-smokers estimated their relative risk regarding lung cancer and smoker's cough. On the average, participants judged their relative risk as below the mean probability. Smokers took into consideration their risky behavior; however, they judged their probability only as at the average level. Furthermore, smokers came up with higher risk estimates if their own behavior approached that of a high-risk person. Smokers viewed themselves to be at average risk if their own smoking behavior equaled the behavior of the risk stereotype.
Key Words: - risk behavior - risk perception - vulnerability - unrealistic optimism - stereotype
Der "unrealistische Optimismus" oder "optimistische Fehlschluß" korrumpiert die wahrgenommene persönliche Vulnerabilität, so daß sie für die Vorsatzbildung oder das Verhalten selbst häufig zu gering ist.
In der Literatur findet sich eine Reihe von Ansätzen zur Erklärung des optimistischen Fehlschlusses (im Überblick: Hoorens, 1993; van der Pligt et al., 1993; Weinstein, 1989). Diese Arbeiten fokussieren entweder auf motivationale Mechanismen, die eine egodefensive beziehungsweise selbstwerterhaltende Funktion haben, oder auf kognitive Mechanismen, und zwar auf fehlerhafte Urteilsstrategien.
Motivationale Erklärungsansätze nehmen entweder an, daß der optimistische Fehlschluß auf (illusionäre) Kontrollüberzeugungen in bezug auf den Ereigniseintritt zurückgeführt werden kann (Bauman & Siegel, 1987; Hoorens & Buunk, 1993; McKenna, 1993; Perloff, 1987; Weinstein, 1980, 1982, 1987), oder auf den Prozeß des egodefensiven, nach unten gerichteten sozialen Vergleichs (ego-defensive downward comparison; Perloff & Fetzer, 1986; Wood, Taylor & Lichtman, 1985).
Kognitive Ansätze zur Erklärung des optimistischen Fehlschlusses können zwei verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten zugeordnet werden. Ein Ansatzpunkt ist der Prozeß des Abrufs selbstbezogener Informationen (z.B. eigener protektiver Verhaltensweisen). Weinstein und Lachendro (1982) sehen im Zusammenwirken der leichteren Verfügbarkeit selbstbezogener Informationen (egocentric bias) und der Verfügbarkeitsheuristik (Tversky & Kahneman, 1973) eine mögliche Ursache des Bias (siehe auch Hoch, 1985). Der zweite Zugang zur Erklärung des Bias umfaßt den Prozeß der Generierung der Vergleichsperson. Eine von Perloff und Fetzer (1986) sowie Weinstein (1980) formulierte These ist, daß aufgrund der Nennung eines Ereignisses (z.B. Lungenkrebs) eine typische gefährdete Person ("prototypical victim") im Arbeitsgedächtnis präsent wird. Nach Ansicht der Autoren vergleichen sich die Befragten mit einer solchen gefährdeten Person, anstatt (instruktionsgemäß) mit einer durchschnittlichen Person. Dieser Prozeß wird von Weinstein wie auch Perloff und Fetzer durch fehlerhafte kognitive Prozesse erklärt, oder durch den motivationalen Prozeß des "ego-defensive downward comparison on risk factors" (vgl. auch Harris & Middleton, in Druck).
Bedenkt man zum einen, daß der Bias in erster Linie bei Ereignissen, deren Eintritt als kontrollierbar oder als verhaltensabhängig eingeschätzt wird, nachgewiesen werden konnte (van der Pligt et al., 1993; Segerstrom, McCarthy, Caskey, Gross & Jarvik, 1993; Weinstein, 1989), und betrachtet man zum anderen die oben genannten Erklärungsansätze, so wird ein zentraler, gemeinsamer Aspekt deutlich: das subjektive Wissen über risikorelevante Faktoren. Die theoretisch angenommenen Mechanismen können nur wirksam werden, wenn der jeweilige Urteiler über eine implizite Risikofaktorentheorie in bezug auf das zu beurteilende Ereignis verfügt.
Da Wissen über risikorelevante Faktoren an das Individuum als Bezugspunkt gebunden ist (z.B. "der Raucher"), wäre es plausibel anzunehmen, daß eine implizite Risikofaktorentheorie auch eine abstrakte Repräsentation einer Person enthält, die besonders gefährdet ist. Von Weinstein (1980) sowie von Perloff und Fetzer (1986) wird diese abstrakte Repräsentation als "prototypical victim" bezeichnet. Da es sich hier jedoch um eine Person handelt, die noch nicht "Opfer" eines negativen Ereignisses ist, verwenden wir im folgenden die Bezeichnung "Risikostereotyp". In der Literatur finden sich einige Befunde, die Aufschluß über die Struktur sowie die Relevanz eines solchen Risikostereotyps für die relative Vulnerabilitätseinschätzung geben. Weinstein (1980) beispielsweise berichtet von einem hohen positiven Zusammenhang zwischen dem optimistischen Fehlschluß und der "Vorstellbarkeit" (Salienz) einer typischen gefährdeten Person (r = .76) sowie von einer hohen Korrelation zwischen wahrgenommener Kontrolle in bezug auf den Ereigniseintritt und Salienz einer typischen gefährdeten Person (r = .78; sowie r = .72; Weinstein, 1982).Weinstein (1980) sieht in diesen Ergebnissen einen Beleg dafür, daß im Falle von subjektiv kontrollierbaren Ereignissen Menschen stereotype Vorstellungen über eine gefährdete Person haben und diese als Vergleichsperson für die Einschätzung ihrer relativen Gefährdung nutzen. Im Falle von subjektiv unkontrollierbaren Ereignissen hingegen bestehen keine stereotypen Vorstellungen und entsprechend kein optimistischer Fehlschluß.
Weitere Hinweise auf die Relevanz einer solchen stereotypen Vorstellung für die Risikoeinschätzung finden sich in der Arbeit von Perloff und Fetzer (1986). Die Probanden begründeten spontan die Wahl der Vergleichsperson mit Hinweisen auf deren spezifische Vulnerabilitäten. Die Auswahl richtete sich dabei offenbar nicht nach der Instruktion, sondern nach der Ähnlichkeit mit einem "Risikostereotyp". Harris und Middleton (in Druck) berichten, daß ihre Untersuchungsteilnehmer eine klare konsensuale, stereotype Vorstellung über die vorgegebene Vergleichsperson "Student gleichen Alters und Geschlechts" hatten. So waren die Befragten der Meinung, daß sich die Vergleichsperson in allen erfragten Verhaltensbereichen signifikant riskanter verhält als sie selbst (z.B. trinkt regelmäßig) und demzufolge auch ein höheres Risiko trägt. Weiterhin zeigten Moore und Rosenthal (1991), daß die von ihnen Befragten ihr AIDS-Risiko um so geringer einschätzten, je klarer ihre stereotype Vorstellung über ein AIDS-Opfer war.
Aufgrund der hier referierten Befunde kann zusammenfassend gesagt werden, daß der optimistische Fehlschluß insbesondere bei subjektiv kontrollierbaren, verhaltensabhängigen Ereignissen auftritt. In bezug auf solche Ereignisse verfügen Menschen über implizite Risikofaktorentheorien, die vermutlich stereotype Vorstellungen über besonders gefährdete Personen (Risikostereotyp) enthalten. Zentrale Attribute eines solchen Risikostereotyps sind ereignisbezogene Risikofaktoren (z.B. Lungenkrebs (Ereignis) und Rauchen (Risikofaktor)). Im Falle solcher Ereignisse erfolgt die Einschätzung der relativen Vulnerabilität aufgrund eines Vergleichs des eigenen Risikoverhaltens mit dem Verhalten eines solchen Risikostereotyps. Da dieser Vergleich sicherlich bei den meisten Menschen zu den eigenen Gunsten ausfallen wird, erklärt sich auch, warum gruppenbezogen (d.h., im Mittel) ein optimistischer Fehlschluß zu beobachten ist. Eine Bewertung, inwieweit nun der einzelne eine unrealistisch optimistische Risikoeinschätzung vornimmt, ist jedoch nicht möglich.
Es stellt sich hier die Frage, welche Struktur und Inhalte eine solche implizite Risikofaktorentheorie aufweist, und wie der Einschätzungsprozeß der relativen Vulnerabilität durch diese beeinflußt wird. Ziel dieser Untersuchung ist es deshalb, einen Entwurf einer Risikofaktorentheorie zu formulieren, in dem auch Annahmen über die Struktur und den Inhalt eines Risikostereotyps spezifiziert werden.
Es wird angenommen, daß eine implizite Risikofaktorentheorie über ein negatives Ereignis (z.B. eine Krankheit) personen- als auch umweltabhängige Faktoren umfassen kann (siehe Abbildung 1).
Beispiele für Umweltfaktoren wären etwa Luftverschmutzung oder eine Asbestbelastung des Arbeitsplatzes. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um technologische Risiken, die nicht in den persönlichen Einflußbereich fallen.
Die personenabhängigen Faktoren lassen sich grob in verhaltensabhängige und verhaltensunabhängige Faktoren gliedern. Zu verhaltensunabhängigen Faktoren zählen körperliche Prädispositionen. Eine Asthmaerkrankung beispielsweise betrifft besonders Personen, die eine genetische Prädisposition aufweisen. Faktoren hingegen, die als verhaltensabhängig angesehen werden, wären beispielsweise typische Risikoverhaltensweisen wie Rauchen, Alkoholkonsum oder Fehlernährung. In bezug auf die personenabhängigen Faktoren enthält die Risikofaktorentheorie unter anderem also Vorstellungen, wie sich eine Person verhalten muß, um besonders gefährdet zu sein (Risikostereotyp). Theoretisch ist es denkbar, daß der Risikostereotyp sowohl verhaltensabhängige wie auch -unabhängige Faktoren umfaßt. Die empirische Befundlage gibt bisher jedoch nur Hinweise dafür, daß im Falle von kontrollierbaren oder verhaltensabhängigen Ereignissen klare stereotype Vorstellungen über eine stark gefährdete Person bestehen (Weinstein, 1980, 1982).
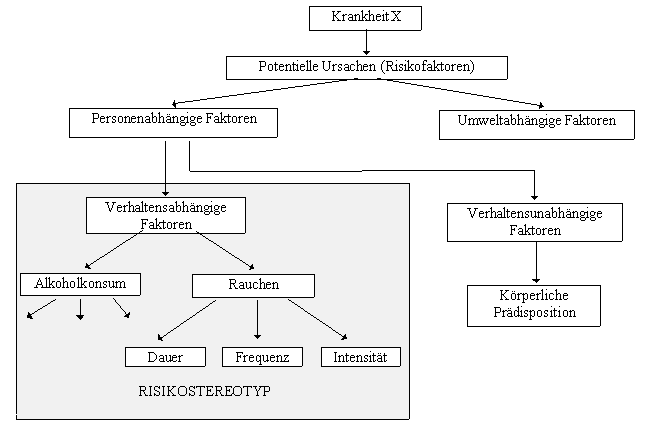
Abbildung 1. Mehrdimensionale hierarchische Struktur einer
impliziten Risikofaktorentheorie über die Genese einer Krankheit.
Die Vorstellung über eine gefährdete Person (Risikostereotyp) beschränkt sich jedoch sicherlich nicht nur auf qualitativ unterschiedliche Risikofaktoren. Beispielsweise ist Rauchen nicht per se ein Gesundheitsrisiko, da das einmalige Rauchen einer Zigarette keine Gefahr darstellt. Dementsprechend wird angenommen, daß der Risikostereotyp sich auch durch bestimmte quantitative Ausprägung des jeweiligen Risikofaktors auszeichnet. Die Kumulation von Risikoverhaltensweisen, wie das Rauchen über einen langen Zeitraum, ist entscheidend für das Ausmaß der persönlichen Gefährdung. Deshalb ist es plausibel, daß der jeweilige Risikostereotyp einen Dauerparameter aufweist, der Informationen darüber enthält, wie lange ein Risikoverhalten gezeigt wurde, bevor es zu einer substantiellen Gefährdung kam. Da die meisten Risikoverhaltensweisen nicht permanent gezeigt werden, ist die Betrachtung der absoluten Dauer des Risikoverhaltens sicherlich nicht ausreichend zur Charakterisierung des Risikoverhaltens. Aus diesem Grund wird die Frequenz des Verhaltens als ein weiterer Parameter des Risikostereotyps angenommen, der Informationen über die Häufigkeit des Risikoverhaltens enthält (z.B. Anzahl der gerauchten Zigaretten pro Tag). Ein dritter Parameter, der den beiden hinzugefügt werden soll, ist die Intensität des Risikoverhaltens. Hierbei geht es um die Frage, wie extrem das Verhalten ausgeübt wird (z.B. Kondensat- und Nikotingehalt des konsumierten Tabaks).
Es wird angenommen, daß die Einschätzung des relativen Risikos im Falle von subjektiv kontrollierbaren, verhaltensabhängigen Risiken anhand eines Vergleichs zwischen dem Verhalten der eigenen Person und dem Verhalten des entsprechenden Risikostereotyps erfolgt. Demzufolge sollten sich Unterschiede in den relativen Vulnerabilitätseinschätzungen in Abhängigkeit vom qualitativen Risikostatus zeigen: Personen, die einen qualitativen Risikofaktor (z.B. Rauchen) mit dem Risikostereotyp gemeinsam haben, sollten ihre Gefährdung höher einschätzen als Personen, die sich nicht durch einen solchen Risikofaktor auszeichnen. Darüber hinaus sollten Personen mit einem qualitativen Risikofaktor (Raucher) ihre relative Vulnerabilität in Abhängigkeit von der Ähnlichkeit zwischen den quantitativen Ausprägungen ihres eigenen Risikoverhaltens ("ich rauche seit 8 Jahren täglich 20 leichte Zigaretten") und den quantitativen Ausprägungen des Risikostereotyps ("raucht seit 30 Jahren täglich 20 starke Zigaretten") einschätzen. Wir nehmen an, daß aus dieser Ähnlichkeitsbeurteilung jeweils ein Differenzwert für die Risikoverhaltensparameter Dauer, Frequenz und Intensität resultiert. Diese drei Differenzwerte bestimmen die Vulnerabilitätseinschätzung, wobei Interaktionen im Sinne von Kompensationen möglich sind. Hohe Ausprägungen auf dem Dauerparameter könnten somit von geringen Ausprägungen des Frequenz- oder Intensitätsparameters ausgeglichen werden.
Geprüft werden sollen die vorgestellten Thesen in bezug auf die negativen gesundheitlichen Ereignisse Lungenkrebs und Raucherhusten. Diese beiden Erkrankungen wurden gewählt, da die Krankheitsgenese eine hohe Abhängigkeit vom individuellen Verhalten (Rauchen) zeigt (z.B. Lubin et al., 1984). Hier sollten also in erster Linie der Rauchstatus und im Falle der Raucher die drei verschiedenen relativen Verhaltensparameter (Differenzwerte) des Rauchens die Vulnerabilitätseinschätzung determinieren.
Es wurde eine einmalige schriftliche Befragung durchgeführt, an der 154 Berliner teilnahmen, die durch Anzeigen in Berliner Tageszeitungen und Wochenmagazinen angeworben wurden. Die Hälfte der Teilnehmer waren Frauen. Das Durchschnittsalter lag bei 38 Jahren (SD = 12.9) mit einem Range von 16 bis 85 Jahren. Siebzig Prozent der Befragten waren jünger als 40 Jahre, 90 Prozent jünger als 55 Jahre. Sechzehn Prozent gaben als höchsten Schulabschluß das Abitur an, und 59 Prozent waren zum Zeitpunkt der Befragung berufstätig. An Lungenkrebs war nach eigenen Angaben keiner der Befragten erkrankt. Unter Raucherhusten litten laut Selbstbericht jedoch neun Teilnehmer.
Relative Vulnerabilitätseinschätzungen. In Anlehnung an Weinstein (1980, 1987) wurde zur Einschätzung der relativen Vulnerabilität in bezug auf Lungenkrebs und Raucherhusten folgendes Item vorgelegt: "Wenn ich mich mit anderen Personen meines Alters und Geschlechts vergleiche, dann ist mein Risiko, im Laufe des Lebens an Lungenkrebs/Raucherhusten zu erkranken, wesentlich unter dem Durchschnitt [-3]/ unter dem Durchschnitt [-2]/ etwas unter dem Durchschnitt [-1]/ genauso wie beim Durchschnitt [0]/ etwas über dem Durchschnitt [1]/ über dem Durchschnitt [2]/ wesentlich über dem Durchschnitt [3]".
Eigenes Rauchverhalten. Zur Erhebung des Risikoverhaltens Rauchen wurde zunächst der Raucherstatus erfragt (Raucher, Ex-Raucher oder Nie-Raucher). Zur Erfassung des Verhaltensparameters Dauer wurden die Personen gefragt, wann sie begonnen haben, regelmäßig, wenn auch nur in kleinen Mengen, zu rauchen. Die tatsächliche Rauchdauer wurde durch die Differenz zwischen dem Alter zum Zeitpunkt der Befragung und dem Rauchbeginn errechnet. Zur Korrektur der Rauchdauer wurden zusätzlich Rauchunterbrechungen bei den Ex-Rauchern und den Rauchern erfragt. Die Ex-Raucher sollten außerdem angeben, vor wie vielen Jahren oder Monaten sie mit dem Rauchen aufgehört haben. Der Frequenzparameter wurde durch das folgende Item operationalisiert: "Wie viele Zigaretten rauchen Sie durchschnittlich pro Tag bzw. wie viele Zigaretten haben Sie durchschnittlich pro Tag geraucht?" Das Antwortformat sah Angaben von einer bis 99 Zigaretten pro Tag vor. Die Intensität des Rauchverhaltens wurde anhand der Stärke des konsumierten Tabaks erfaßt. Die Probanden wurden gebeten, auf einer 5-stufigen Skala anzugeben, welche Stärke die von ihnen derzeit konsumierte Tabakmarke hat (ultra light [1]/ light [2]/ medium [3]/ strong [4]/ ultra strong [5]).
Aus der Risikofaktorentheorie leitet sich die Annahme ab, daß ein Vergleich zwischen eigenen und risikostereotypen Verhaltensparametern nur vorgenommen wird oder möglich ist, wenn die einzuschätzenden Ereignisse als verhaltensabhängig und somit als kontrollierbar durch die eigene Person wahrgenommen werden. Aus diesem Grund wurde die wahrgenommene Kontrollierbarkeit der Krankheitsgenese sowie der genetische Einfluß auf diese erfaßt.
Kontrollierbarkeit. Zur Erfassung der allgemeinen Kontrollierbarkeit der Krankheitsgenese sollte eine Einschätzung auf einer siebenstufigen Ratingskala abgegeben werden. Das Item lautete "In welchem Ausmaß sind die Ursachen für die Entstehung der folgenden Krankheiten/gesundheitlichen Probleme persönlich beeinflußbar (z.B. durch geeignete Vorsorgemaßnahmen)? Die Ursachen für die Entstehung sind bei Lungenkrebs/Raucherhusten überhaupt nicht persönlich beeinflußbar [1]/ sehr wenig persönlich beeinflußbar [2]/ wenig persönlich beeinflußbar [3]/ mittelmäßig persönlich beeinflußbar [4]/ stark persönlich beeinflußbar [5]/ sehr stark persönlich beeinflußbar [6]/ völlig persönlich beeinflußbar [7]".
Heritabilität. Diese Komponente der Krankheitsgenese wurde durch das folgende Item erhoben, welches mit einer fünfstufigen Likertskala zu beantworten war: "Wie hoch schätzen Sie bei den folgenden Krankheiten/gesundheitlichen Problemen den Einfluß der Vererbung ein? [Lungenkrebs/Raucherhusten] (nicht genetisch beeinflußt [1]/ leicht genetisch beeinflußt [2]/ zu 50% genetisch beeinflußt [3]/ stark genetisch beeinflußt [4]/ genetisch bestimmt [5])".
Um sicherzustellen, daß das Rauchverhalten Teil der subjektiven Risikofaktorentheorie in bezug auf Lungenkrebs und Raucherhusten ist, wurde zusätzlich die subjektive Relevanz der Risikoverhaltensparameter für die Krankheitsgenese durch das folgende Item erhoben: "Glauben Sie, daß die Wahrscheinlichkeit Lungenkrebs/Raucherhusten zu bekommen, erhöht wird durch die Dauer des Zigarettenkonsums/Anzahl der Zigaretten pro Tag/die Sorte der Zigaretten?" Die Antworten sollten auf einer 5-stufigen Likertskala gegeben werden mit den Antwortpolen "sicher nicht" [1] und "ganz sicher" [5].
Risikostereotyp. Das wahrgenommene Verhalten einer gefährdeten Person wurde für die Krankheiten Lungenkrebs und Raucherhusten getrennt erfaßt. Zu Beginn der Erfassung des jeweiligen Risikostereotypen wurde den Teilnehmern folgende Instruktion vorgelegt: "Stellen Sie sich bitte eine Person vor, die Ihrer Ansicht nach für Lungenkrebs/Raucherhusten sehr gefährdet ist. Welcher Tabakkonsum ist für eine solche Person typisch?" Entsprechend den theoretischen Annahmen wurde gefragt, wie lange eine solche Person mindestens geraucht haben muß (Dauerparameter). Die Rauchdauer konnte frei in Jahren geschätzt werden. Der Frequenzparameter wurde analog zum eigenen Verhalten über die Anzahl der gerauchten Zigaretten pro Tag operationalisiert. Die Intensitätskomponente wurde entsprechend auf einer 5-stufigen Skala (ultra light [1] bis ultra strong [5]) eingeschätzt.
Die Itemgruppe zur Erhebung des Rauchverhaltens war im vorgelegten Fragebogen den Items zur Erfassung der Risikostereotype vorgeordnet. Zwischen den beiden Itemgruppen wurden auf mehreren Seiten weitere Angaben von der Person erfragt, die die Funktion von Distraktoren hatten. Die Reihenfolge der Itemgruppen wurde nicht variiert.
Tabelle 1 zeigt für die relativen Vulnerabilitätseinschätzungen erwartungsgemäß, daß in bezug auf beide Krankheiten ein optimistischer Fehlschluß vorliegt. Der Mittelwert ist in beiden Fällen signifikant von Null verschieden. Die Befragten halten sich im Mittel für unterdurchschnittlich gefährdet, an Lungenkrebs oder Raucherhusten zu erkranken.
Tabelle 1
Mittlere Vulnerabilitätseinschätzung für die
eigene Person im Vergleich zu einer anderen durchschnittlichen
Person gleichen Alters und Geschlechts
| M | SD | n (a) | t-Test (einseitig) | |
|---|---|---|---|---|
| Lungenkrebs | -0.84 | 2.19 | 151 | -4.70 p < .001 |
| Raucherhusten | -1.13 | 2.33 | 142 (b) | -5.79 p < .001 |
In der Stichprobe finden sich 73 Raucher (47.4%), 39 Ex-Raucher (25.3%) und 42 Nie-Raucher (27.3%). Die Ex-Raucher sind im Mittel seit einem Jahr abstinent. Die Raucher konsumieren im Mittel seit 19 Jahren täglich 16 mittelstarke Zigaretten. Die Ex-Raucher rauchten im Mittel 22 Jahre lang täglich 16 Zigaretten.
Verhaltensabhängigkeit der Krankheitsgenese und Relevanz der Risikoverhaltensparameter
Die Kontrollierbarkeit der Krankheitsgenese wird im Falle von Lungenkrebs (M = 5.12) und im Falle von Raucherhusten (M = 6.07) als hoch bewertet. Um Unterschiede in der wahrgenommenen Kontrollierbarkeit der Krankheitsgenese von Lungenkrebs und Raucherhusten in Abhängigkeit vom Raucherstatus zu prüfen, wurde eine multivariate Varianzanalyse durchgeführt (7 Personen konnten aufgrund fehlender Angaben nicht berücksichtigt werden). Die drei Raucherstatusgruppen zeigen in beiden Fällen eine hohe Übereinstimmung in ihren mittleren Einschätzungen (Wilks Lambda = .98; F(4,286) = .66; p = .62).
Der Einfluß der Heritabilität auf die Krankheitsgenese wird im Mittel als gering bezeichnet (Lungenkrebs: M = 1.75; Raucherhusten: M = 1.23). Nach einer multivariaten Varianzanalyse mit dem Raucherstatus als Gruppierungsfaktor unterschieden sich die drei Gruppen in ihren Heritabilitätseinschätzungen nicht (Wilks Lambda = .96; F(4,286) = 1.62; p = .17). Jedoch zeigt sich auf univariater Ebene, daß die Ex-Raucher (M = 1.47) der Heritabilität im Falle von Lungenkrebs eine etwas geringere Bedeutung zusprechen als die Nie-Raucher (M = 1.95) (F (2,144) = 3.18; p < .05; sowie Scheffé mit p < .05). Von diesen Analysen wurden acht Personen mit unvollständigen Angaben ausgeschlossen.
Da die Probanden die Heritabilität gering sowie die Kontrollierbarkeit der Krankheitsgenese beider Krankheiten hoch einschätzen, sollte die Einschätzung der relativen Vulnerabilität anhand des Vergleichs zwischen eigenem Verhalten und dem Verhalten des Risikostereotyps erfolgen.
Die beiden Parameter Dauer und Frequenz des Zigarettenkonsums erhöhen nach Ansicht fast aller Befragten (Minimum: 92%; Maximum: 96%) zumindest "mit großer Wahrscheinlichkeit" das Lungenkrebs- und Raucherhusten-Risiko. Die Tabaksorte beurteilen hingegen nur etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer als einen risikosteigernden Faktor in bezug auf Lungenkrebs (54%) oder Raucherhusten (58%). Bei multivariater vergleichender Betrachtung der drei Raucherstatusgruppen hinsichtlich der eingeschätzten Risikorelevanz der Verhaltensparameter für Lungenkrebs und Raucherhusten ergeben sich keine Unterschiede (Wilks Lambda = .93; F(12,276) = .77; p = .67). Acht Personen konnten bei der Analyse nicht berücksichtigt werden.
Lungenkrebs. Das wahrgenommene typische Verhalten einer für Lungenkrebs gefährdeten Person in Abhängigkeit vom Raucherstatus wird in der Tabelle 2 veranschaulicht. Die Verhaltenseinschätzungen der Raucher und Ex-Raucher zeigen eine hohe Ähnlichkeit. Raucher gehen davon aus, daß eine für Lungenkrebs gefährdete Person etwa 14 Jahre lang täglich 24 starke Zigaretten rauchen muß. Die Ex-Raucher schätzen die Rauchjahre mit 15 Jahren geringfügig höher ein. Ihrer Ansicht nach muß eine solche Person 23 starke Zigaretten pro Tag rauchen. Die Nie-Raucher halten bereits 11 Jahre für ausreichend, um ein konkretes Risiko zu tragen. Sie sind weiterhin der Meinung, daß eine solche Person 21 starke Zigaretten rauchen muß, um ein substantielles Lungenkrebs-Risiko zu tragen.
Tabelle 2
Wahrgenommenes Verhalten einer für Lungenkrebs oder Raucherhusten
gefährdeten Person in Abhängigkeit vom Raucherstatus
| Lungenkrebs (M, SD) | Raucherhusten (M, SD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauchdauer in Jahren (Dauer) | Anzahl der Zigaretten (Frequenz) | Stärke Zigaretten (Intensität) | Rauchdauer in Jahren (Dauer) | Anzahl der Zigaretten (Frequenz) | Stärke Zigaretten (Intensität) | |
| Raucher (n = 69-73) | 14.3 (9.6) | 23.7 (13.2) | 3.7 (1.0) | 12.2 (9.4) | 22.3 (12.9) | 3.5 (0.9) |
| Ex-Raucher (n = 37-39) | 14.9 (8.0) | 22.8 (11.1) | 3.6 (0.8) | 12.1 (8.5) | 22.8 (10.6) | 3.5 (0.8) |
| Nie-Raucher (n = 38-42) | 11.1 (8.0) | 21.2 (10.4) | 3.6 (1.0) | 8.5 (10.5) | 21.2 (6.2) | 3.6 (1.0) |
Raucherhusten. Die Verhaltenseinschätzungen einer für Raucherhusten gefährdeten Person fallen analog aus. Lediglich die Dauer des Risikoverhaltens wird niedriger angesetzt (vgl. Tabelle 2). Eine Person, die 12 Jahre lang täglich 22 starke Zigaretten raucht, trägt nach Ansicht der Raucher ein substantielles Raucherhusten-Risiko. Die Ex-Raucher schließen sich dieser Einschätzung an. Die Nie-Raucher schätzen den Dauerparameter augenscheinlich ebenfalls wieder etwas konservativer ein: Sie sind der Meinung, daß bereits der Konsum von 21 starken Zigaretten pro Tag über einen Zeitraum von 9 Jahren ausreichend ist, um ein substantielles Raucherhusten-Risiko zu tragen.
Die multivariate varianzanalytische Auswertung mit dem Gruppierungsfaktor "Raucherstatus" sowie den beiden Meßwiederholungsfaktoren "Krankheitsereignis" (Lungenkrebs vs. Raucherhusten) und "Verhaltensparameter" (Dauer, Frequenz, Intensität) erbringt weder einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Raucherstatus noch signifikante Interaktionseffekte in bezug auf die Verhaltenseinschätzung des Risikostereotyps (von der Analyse wurden 10 Fälle aufgrund fehlender Werte ausgeschlossen). Die etwas "konservativeren" Einschätzungen der Nie-Raucher unterscheiden sich damit nicht signifikant von denen der beiden anderen Raucherstatusgruppen.
Da die Befragten übereinstimmend der Meinung waren, daß Rauchen die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs oder Raucherhusten zu erkranken, erhöht, sollten Raucher ihre Erkrankungswahrscheinlichkeit höher einschätzen als Nie-Raucher oder Ex-Raucher.
Die Abbildung 2 veranschaulicht das Ergebnis einer diesbezüglich durchgeführten zweifaktoriellen Varianzanalyse mit dem Raucherstatus als Gruppierungsfaktor und den beiden relativen Vulnerabilitätseinschätzungen (Raucherhusten vs. Lungenkrebs) als Meßwiederholungsfaktor "Krankheitsereignis”. Da neun Personen an Raucherhusten erkrankt waren und sechs Befragte zumindest einen fehlenden Wert auf den Variablen hatten, konnten 15 Personen bei den folgenden Analysen nicht berücksichtigt werden. Die Analyse erbringt einen signifikanten Haupteffekt für den Raucherstatus (F (2, 136) = 38.08; p < .001) und den Faktor Krankheitsereignis (F (1,136) = 27.66; p < .001). Darüber hinaus zeigt sich eine signifikante Interaktion zwischen beiden Faktoren (F (2,136) = 16.26; p < .001). Betrachtet man die Raucherstatusunterschiede innerhalb der Stufen des Meßwiederholungsfaktors Krankheitsereignis, so zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt des Raucherstatus sowohl innerhalb von Lungenkrebs (F (2,136) = 21.47; p < .001) als auch innerhalb von Raucherhusten (F (2,136) = 48.86; p < .001). Die Kontrastanalysen zeigen erwartungsgemäß, daß Raucher ihr Lungenkrebs-Risiko sowie ihr Raucherhusten-Risiko signifikant höher einschätzen als Ex-Raucher oder Nie-Raucher. Die Raucher berücksichtigen demnach ihren Risikostatus bei der Einschätzung ihrer relativen Vulnerabilität. Die Gruppe der Ex-Raucher hingegen unterscheidet sich nicht von der Gruppe der Nie-Raucher in ihren Einschätzungen. Subanalysen innerhalb der Raucherstatusgruppen zeigen weiterhin, daß Raucher ihre Vulnerabilität gegenüber Raucherhusten und Lungenkrebs nicht unterschiedlich hoch einschätzen (F (1,136) = 2.25; ns.). Ex-Raucher (F (1,136) = 23.05; p < .001) sowie Nie-Raucher (F (1,136) = 23.51; p < .001) dagegen halten sich für signifikant mehr gefährdet, an Lungenkrebs zu erkranken, als an Raucherhusten.
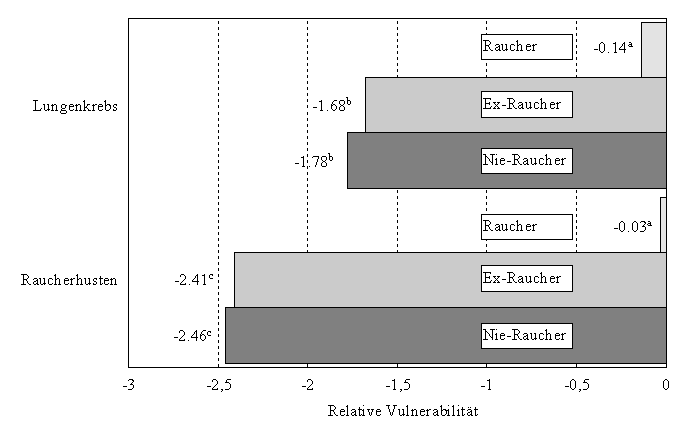
Abbildung 2. Mittlere wahrgenommene, relative Vulnerabilität
für Lungenkrebs und Raucherhusten der Raucherstatusgruppen.
Anmerkung. Mittelwerte, die mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet sind,
sind statistisch nicht verschieden voneinander. Mittelwerte mit
verschiedenen Buchstaben sind verschieden voneinander (Scheffé-Test
mit p stets kleiner als .05).
Mit dem Raucherstatus, d.h. mit der Berücksichtigung eines qualitativen Risikofaktors, lassen sich im Falle von Lungenkrebs 25 Prozent und im Falle von Raucherhusten 42 Prozent der Varianz der Vulnerabilitätseinschätzungen erklären. Am Rande bemerkenswert ist, daß die Ex-Raucher, die im Mittel länger und genau so viel geraucht haben wie die aktiven Raucher, sich trotzdem deutlich invulnerabler einschätzen. Die Aufgabe des Risikoverhaltens wird vermutlich mit einem abrupten Ende des eigenen Risikos gleichgesetzt (im Mittel haben die Ex-Raucher dem Rauchen erst vor einem Jahr entsagt). Bedenkt man, daß das Lungenkrebs-Risiko von Ex-Rauchern unabhängig von der "Abstinenzdauer" immer höher als das von Nie-Rauchern ist (USDHHS, 1990; zitiert nach McCoy, Gibbons, Reis, Gerrard, Luus & Wald Sukka, 1992), so können die Ex-Raucher als diejenigen bezeichnet werden, die dem optimistischen Fehlschluß unterliegen.
In den folgenden Analysen wird der Frage nachgegangen, ob die wahrgenommene relative Vulnerabilität der Raucher eine Funktion des Vergleichs der eigenen Verhaltensausprägungen mit den wahrgenommenen Verhaltensausprägungen einer gefährdeten Person (Risikostereotyp) ist. Hierzu wurden zunächst Differenzwerte zwischen den Verhaltensparametern der eigenen Person und den geschätzten Parametern des Risikostereotyps gebildet. Insgesamt ergeben sich für die beiden Ereignisse Lungenkrebs und Raucherhusten je drei Differenzwerte (Dauer, Frequenz und Intensität). Ein negativer Differenzwert bedeutet, daß die eigenen Verhaltensausprägungen im Vergleich zum Risikostereotyp höher und damit ungünstiger sind.
Diese drei "relativen Verhaltensparameter" dienten in z-standardisierter Form als Prädiktoren der relativen Vulnerabilitätseinschätzung in den nachfolgend durchgeführten hierarchischen Regressionsanalysen. Dabei wurden die drei Parameter simultan im ersten Analyseschritt berücksichtigt. In nachfolgenden Schritten wurden auch alle möglichen Interaktionen berücksichtigt, um die Möglichkeit kompensatorischer Effekte zu prüfen (Aiken & West, 1991, S. 43ff).
Die Raucher konsumieren im Mittel vier Jahre länger (M = -4.34, SD = 11.36) Tabakwaren als eine ihrer Meinung nach für Lungenkrebs gefährdete Person. Der tägliche Zigarettenkonsum sowie die Stärke des konsumierten Tabaks sind etwas geringer: Im Mittel werden sieben Zigaretten weniger (M = 7.37, SD = 16,45) und leichtere Zigaretten (M = 0.69, SD = 1.52) geraucht. Der Vergleich mit einer für Raucherhusten gefährdeten Person fällt ähnlich aus: Die Raucher rauchen im Mittel sieben Jahre länger (M = -7.05, SD = 12.09) und fünf Zigaretten pro Tag weniger (M = 5.41, SD = 16.12) als eine solche Person. Die Stärke des konsumierten Tabaks ist ebenfalls etwas geringer (M = 0.60, SD = 1.47).
Tabelle 3 zeigt das Ergebnis der hierarchischen Regressionsanalysen für die relative Vulnerabilitätseinschätzung in bezug auf Lungenkrebs und Raucherhusten in Abhängigkeit von den Differenzen zwischen den Verhaltensparametern für die Gruppe der Raucher.
Tabelle 3
Wahrgenommene relative Vulnerabilität der Raucher für
Lungenkrebs und Raucherhusten in Abhängigkeit vom Vergleich
des eigenen Rauchverhaltens mit dem Rauchverhalten einer für
Lungenkrebs/Raucherhusten gefährdeten Person.
| Relative Verhaltensparameter für Lungenkrebs (Raucher, N=61) |
|---|
| Schritt | Prädiktor | r | B | R2 | R2 Zuwachs | F Zuwachs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dauer | -.10 | .150 | .206 | 4.94** | |
| Frequenz | -.44*** | -.641** | ||||
| Intensität | -.00 | .017 | ||||
| 2. | Dauer x Frequenz | -.02 | .147 | .224 | .018 | 1.31 |
| 3. | Dauer x Intensität | .03 | .085 | .228 | .004 | 0.28 |
| 4. | Frequenz x Intensität | .17+ | -.036 | .229 | .001 | 0.36 |
| 5. | Dauer x Frequenz x Intensität | -.13 | .077 | .231 | .002 | 1.19 |
| Relative Verhaltensparameter für Raucherhusten (Raucher, N=59) |
|---|
| Schritt | Prädiktor | r | B | R2 | R2 Zuwachs | F Zuwachs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dauer | -.11 | .354+ | .355 | 10.09*** | |
| Frequenz | -.941*** | -.55*** | ||||
| Intensität | -.16+ | -.259 | ||||
| 2. | Dauer x Frequenz | -.04 | .268* | .398 | .043 | 3.91* |
| 3. | Dauer x Intensität | .03 | .006 | .398 | .000 | 0.00 |
| 4. | Frequenz x Intensität | .23* | -.123 | .402 | .004 | 0.35 |
| 5. | Dauer x Frequenz x Intensität | -.21* | .166 | .408 | .006 | 0.50 |
In beiden Regressionsmodellen erweist sich der relative Frequenzparameter als signifikanter Prädiktor. Dieser Regressor erklärt im Falle von Lungenkrebs knapp 20 Prozent (Partialkorrelationskoeffizient = -.44) und im Falle von Raucherhusten 33 Prozent (Partialkorrelationskoeffizient = -.58) der Varianz der relativen Risikoeinschätzung. Das negative Vorzeichen des beta-Gewichts der Frequenzkomponente entspricht dabei der Erwartung: Raucht eine Person - relativ verstanden - wenig, so hält sie ihre Gefährdung für unterdurchschnittlich. Konsumiert ein Raucher hingegen "relativ" viel Tabakwaren, so fühlt er sich vulnerabler als eine durchschnittliche Person. Abbildung 3 veranschaulicht diesen Sachverhalt. Aus der Darstellung der Regressionsgeraden ist ersichtlich, daß sich Raucher, deren täglicher Zigarettenkonsum in etwa dem einer für Lungenkrebs gefährdeten Person entspricht, für durchschnittlich vulnerabel einschätzen. Die Steigung der Regressionsgeraden ist im Falle von Raucherhusten etwas steiler. Im Falle von Lungenkrebs sehen sich Personen mit einem "Mehr" von 10 Zigaretten pro Tag lediglich als geringfügig überdurchschnittlich gefährdet an. Raucher hingegen, die 10 Zigaretten mehr als ihr Raucherhusten-Risikostereotyp rauchen, halten ihr Risiko für deutlich überdurchschnittlich.
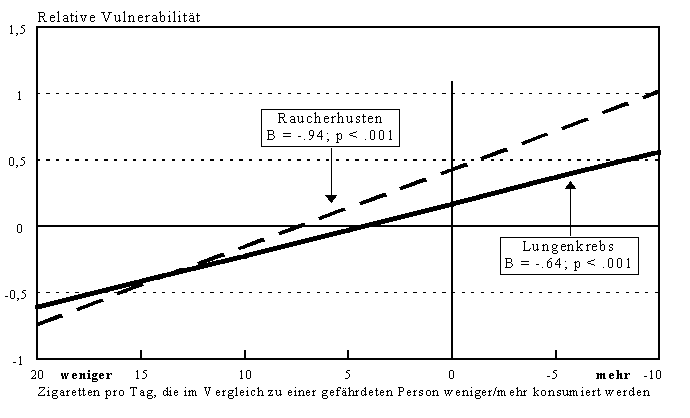
Abbildung 3. Wahrgenommene, relative Vulnerabilität
der Raucher für Lungenkrebs und Raucherhusten in Abhängigkeit
von der relativen Anzahl der täglich konsumierten Zigaretten.
(Zur Darstellung wurden unstandardisierte Regressionskoeffizienten
aufgrund unstandardisierter Prädiktoren verwendet.)
Überraschend ist, daß es keine Rolle zu spielen scheint, ob ein Raucher länger oder kürzer raucht als er selbst für riskant hält. Es zeichnet sich hier sogar eher ein umgekehrter Trend ab. Je länger eine Person relativ gesehen raucht, desto invulnerabler fühlt sie sich (Lungenkrebs: beta = .15, ns.; Raucherhusten: beta = .35, ns.). Die geringen beta-Gewichte des Regressors "relative Intensität" in beiden Regressionslösungen weisen darüber hinaus darauf hin, daß der Stärke des konsumierten Tabaks keine Bedeutung bei der Kalkulation des relativen Risikos in bezug auf Lungenkrebs oder Raucherhusten zukommt (Lungenkrebs: beta = .02, ns.; Raucherhusten: beta = -.26, ns.). Kontrollanalysen ergaben, daß die mangelnde Vorhersageleistung der Regressoren relative Dauer und Intensität in beiden Modellen nicht auf bestehende Multikollinearitätsprobleme zurückgeführt werden kann. Die Befunde können somit als recht zuverlässig angesehen werden.
Die Interaktionsterme erbringen im Falle von Lungenkrebs keine signifikante Vorhersageleistung. Im Falle von Raucherhusten kann hingegen ein kompensatorischer Effekt zwischen der relativen Dauer und Frequenz beobachtet werden (beta = .27, p < .05). Diese Interaktion klärt zusätzlich 4 Prozent auf. Abbildung 4 zeigt, daß die Häufigkeit des Zigarettenkonsums nur von Bedeutung ist, wenn - relativ gesehen - schon lange geraucht wird. Personen, die länger rauchen als es ihrer Ansicht nach gefährlich ist, schätzen sich als überdurchschnittlich gefährdet ein, wenn ihr täglicher Tabakkonsum über ihrem Risikostereotyp liegt. Je weiter der tägliche Konsum unterhalb des Risikostereotyps liegt, desto geringer wird das eigene Risiko im Vergleich zu einer durchschnittlichen Person eingeschätzt. Die relative Anzahl der Zigaretten spielt jedoch keine Rolle, wenn noch nicht lange geraucht wird.
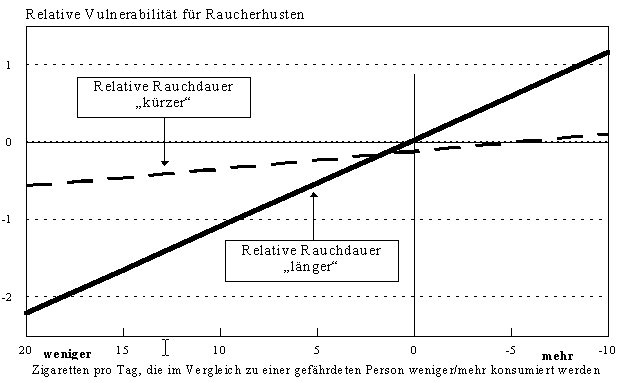
Abbildung 4. Relative Vulnerabilität in Abhängigkeit
von der relativen Anzahl der täglich konsumierten Zigaretten
getrennt für "relative" Kurzzeit- und Langzeitraucher.
Das Phänomen "unrealistischer Optimismus" konnte für die beiden Erkrankungen Lungenkrebs und Raucherhusten repliziert werden. Die Befragten halten sich im Mittel für unterdurchschnittlich gefährdet.
Den zwei Verhaltensparametern des Rauchens Dauer und Frequenz spricht die Mehrheit der Befragten eine risikosteigernde Bedeutung zu. Die Tabaksorte, d.h., die Intensität des Verhaltens, halten hingegen weniger Personen für bedeutend. Den drei Verhaltensparametern des Rauchens wird damit in Übereinstimmung mit den objektiven Gegebenheiten eine unterschiedliche Risikorelevanz zugeschrieben. So beeinflußt die Tabakstärke (Kondensatgehalt) zwar das Lungenkrebsrisiko, jedoch ist die Frequenz ebenso wie die Dauer des Tabakkonsums von höherer Bedeutung (Segerstrom, et al., 1993).
Die Vorstellungen von Rauchern, ehemaligen Rauchern und Nie-Rauchern darüber, welches Rauchverhalten eine substantielle gesundheitliche Gefährdung (Risikostereotyp) darstellt, unterscheiden sich nicht signifikant. Raucher sind im Vergleich zu Nie-Rauchern oder Ex-Rauchern nicht der Meinung, daß das Risikoverhalten länger, häufiger oder intensiver ausgeübt werden kann, bevor eine substantielle Gefährdung besteht. Dieses Ergebnis steht somit nicht in Übereinstimmung mit der in der Literatur beschriebenen Tendenz von Rauchern, daß Gefahrenpotential des Rauchens zu minimieren (Lee, 1989; McCoy et al., 1992). Diese Diskrepanz läßt sich jedoch auf das unterschiedliche methodische Vorgehen zurückführen.
Die These, ob die relative Vulnerabilitätseinschätzung im Falle von subjektiv kontrollierbaren Risiken eine Funktion des Vergleichs des eigenen Verhaltens mit dem wahrgenommenen Verhalten einer gefährdeten Person (Risikostereotyp) ist, wurde zunächst auf der übergeordneten Stufe qualitativ unterschiedlicher Risikofaktoren geprüft (vgl. Abbildung 1). Raucher schätzen erwartungsgemäß ihr Erkrankungsrisiko höher ein als Befragungsteilnehmer, die nicht mehr rauchen oder noch nie geraucht haben. Raucher berücksichtigen demnach ihren Risikostatus bei der Vulnerabilitätseinschätzung. Dieser realistische Aspekt in der Risikowahrnehmung von Rauchern wurde auch von Hansen und Malotte (1986), Lee (1989), Moore und Rosenthal (1992), Reppucci, Revenson, Aber und Reppucci (1991), Strecher, Kreuter und Kobrin (1995) sowie von Weinstein (1984, 1987) beobachtet. In Übereinstimmung mit diesen Untersuchungen zeigt sich auch hier, daß diesem realistischen Aspekt jedoch "optimistische" Grenzen gesetzt sind. Raucher sehen sich zwar als stärker gefährdet an als Nie-Raucher oder Ex-Raucher, dennoch halten sie sich nur für durchschnittlich gefährdet. Diese Einschätzung ist sicherlich unrealistisch optimistisch, bedenkt man, daß sich die Befragten mit einer Person gleichen Alters und Geschlechts vergleichen sollten. Die Population der Vergleichspersonen schließt hiermit auch Nichtraucher ein. Da in Deutschland nur 26 Prozent aller Frauen und 42 Prozent aller Männer rauchen (Troschke, 1992, S.111-112) sowie 9 von 10 an Lungenkrebs Erkrankte Raucher sind (Elbert & Rockstroh, 1993), ist das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, für Raucher im Vergleich zu der vorgegebenen Population eindeutig überdurchschnittlich. Dies gilt insbesondere für die hier Befragten, da diese im Mittel 19 Zigaretten pro Tag rauchen. Eine Befragung des Mikozenzus im Jahre 1987 (Borgers, 1988) zeigt, daß nur rund 27% der Männer und 12% der Frauen über 20 Zigaretten pro Tag rauchen. Bei den Befragten handelt es sich also nicht um Raucher, deren Rauchverhalten besonders gering ausgeprägt ist. Im Falle von Raucherhusten tragen, wie der Name bereits impliziert, sogar ausschließlich Raucher ein Erkrankungsrisiko.
Diese optimistischen Einschätzungen der Raucher sprechen dafür, daß nicht eine Person "gleichen Alters und Geschlechts" als Vergleichsperson herangezogen wird, sondern eine gefährdete Person. Diese Hypothese wird durch den Befund gestützt, daß Raucher ihr relatives Erkrankungsrisiko in Abhängigkeit von der Ähnlichkeit zum Risikostereotyp einschätzen. Erwartungsgemäß zeigt sich, daß Raucher ihre relative Vulnerabilität um so höher einschätzen, je ähnlicher ihr Rauchverhalten ihrer stereotypen Vorstellung über das Verhalten einer gefährdeten Person (Risikostereotyp) ist. Raucher, die weniger rauchen als ihr Risikostereotyp, schätzen ihr Erkrankungsrisiko als unterdurchschnittlich ein. Besteht keine Differenz zwischen dem eigenen Verhalten und dem des Risikostereotyps, so wird ein durchschnittliches Lungenkrebs-Risiko und ein etwas überdurchschnittliches Raucherhusten-Risiko wahrgenommen.
Weiterhin zeigt sich, daß im Fall von Raucherhusten die relativen Verhaltensparameter Dauer und Frequenz nicht direkt und additiv zur Risikoeinschätzung herangezogen werden, sondern vielmehr kompensatorisch im Kalkulationsprozeß berücksichtigt werden. Die Anzahl der täglich konsumierten Zigaretten spielt nur eine Rolle, wenn ein Raucher bereits länger raucht, als es seiner Ansicht nach riskant ist. Wird bereits "relativ" lange geraucht, dann wird bei einem relativen Mehr von 10 Zigaretten pro Tag ein eindeutig überdurchschnittliches Raucherhusten-Risiko wahrgenommen. Entsprechend wird bei einem Weniger von 10 Zigaretten das Risiko als unterdurchschnittlich bewertet. Raucher hingegen, die erst seit "relativ" kurzer Zeit rauchen, halten ihr Raucherhusten-Risiko unabhängig von der relativen Anzahl der täglich konsumierten Zigaretten für etwa durchschnittlich.
Die relative Intensität spielt weder bei der Einschätzung des Lungenkrebs- noch des Raucherhusten-Risikos eine Rolle. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß die Befragten die Tabakstärke als weniger risikorelevant einschätzen als die Frequenz oder die Dauer des Konsums. Daß die relative Dauer des Konsums bei der Einschätzung des relativen Lungenkrebsrisikos nicht berücksichtigt wird, obwohl diese als risikorelevant bezeichnet wird, ist hingegen überraschend. Eine mögliche Erklärung für diesen erwartungswidrigen Befund könnte darin gesehen werden, daß Lungenkrebs als wesentlich bedrohlicher wahrgenommen wird als Raucherhusten und die Befragten deshalb stärker motiviert sind, ihr Erkrankungsrisiko zu verzerren. Da die Befragten im Mittel bereits vier Jahre länger rauchen als eine für Lungenkrebs gefährdete Person, verhalten sie sich in diesem Punkt riskanter als der Risikostereotyp. Einen "Pluspunkt" können die Raucher hingegen hinsichtlich der Anzahl der täglich konsumierten Zigaretten verbuchen. Im Mittel rauchen sie täglich sieben Zigaretten weniger als sie selbst für riskant halten. Möglicherweise wird die relative Dauer im Kalkulationsprozeß vernachlässigt, weil diese eher zu einer ungünstigen Risikoeinschätzung führen würde als die "günstige" Frequenz. Für diese motivationale Erklärung spricht der Befund, daß die geschätzte Ausprägung des Dauerparameters des Risikostereotyps im Falle von Lungenkrebs stärker an das eigene Verhalten angepaßt wird als im Falle von Raucherhusten. Betrachtet man den Zusammenhang zwischen dem eigenen und geschätzten Dauerparameter des Risikostereotyps, so zeigt sich in bezug auf Lungenkrebs eine deutlich höhere Korrelation (r = .40, p < .001) als in bezug auf Raucherhusten (r = .26, p < .05). Je länger der Befragte selbst raucht, desto länger kann seiner Ansicht nach eine Person rauchen, bevor sie ein substantielles Lungenkrebsrisiko trägt. Eine solche selbstwertdienliche Verzerrung zeigt sich bei den anderen beiden Parametern Frequenz und Intensität weder im Falle von Lungenkrebs noch im Falle von Raucherhusten. Die Dauer wird also im Falle des bedrohlicheren Ereignisses Lungenkrebs stärker dem eigenen Verhalten angepaßt und schließlich bei der Einschätzung des eigenen relativen Risikos vernachlässigt.
Verschiedene Gesundheitskampagnen haben immer wieder den Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs sowie anderen Krankheiten betont. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß die Antiraucher-Kampagnen in einem Punkt erfolgreich waren: Die Raucher sehen und akzeptieren einen Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und ihrer Erkrankungswahrscheinlichkeit. Doch verweisen die vorliegenden Befunde auch darauf, daß derart gestaltete Gesundheitsaufklärung nur begrenzt wirksam ist. Die Raucher sind sich zwar bewußt, daß Rauchen gesundheitsgefährdend ist und, daß sie ein höheres Risiko tragen als Nichtraucher; trotzdem nehmen sie für sich selbst nur eine durchschnittliche Gefährdung wahr. Diese unrealistische Einschätzung der eigenen Gefährdung beruht offensichtlich zum Teil darauf, daß Raucher eine klare Vorstellung davon haben, welches Rauchverhalten eine Gefährdung darstellt und welches eher weniger. Sobald "Freiheitsgrade" im Zusammenhang von Rauchen und Krankheitsrisiko bestehen, werden diese in risikorelativierender Art genutzt. So sehen "relative" Langzeit-Raucher ihr Raucherhusten-Risiko als unterdurchschnittlich an, wenn sie weniger Zigaretten pro Tag rauchen als es ihrer Ansicht nach gefährlich ist. Auch sehen Raucher ein real bedenkliches Rauchverhalten als relativ unbedenklich an, wenn sie es selbst zeigen: Zeigen sie das gleiche Rauchverhalten wie der Risikostereotyp, so schätzen sie ihr Erkrankungsrisiko lediglich als durchschnittlich ein. Dies könnte möglicherweise darin begründet sein, daß Aufklärungskampagnen bei der Informationsvermittlung häufig besonders riskantes Verhalten darstellen. Damit wird zum einen, höchstwahrscheinlich unfreiwillig, die Entwicklung von Stereotypen gefördert und zum andern ein irreführender Referenzpunkt für die Einschätzung des eigenen Risikos vermittelt, der eine optimistische Risikoeinschätzung fördert. Differenzierende mediale Informationen im Bereich von moderatem Risikoverhalten würden möglicherweise den Rauchern Hinweise liefern, die helfen würden, das eigene Risiko realistischer einzuschätzen. Gesundheitsförderungsprogramme sollten damit zwar weiterhin klare Bilder von Risikomodellen vermitteln, aber erstens das moderate Risikoverhalten und zweitens dessen kumulativen Aspekt in den Mittelpunkt stellen.
Abele, A. (1993). Stimmung, Gesundheitswahrnehmung und Gesundheitsverhalten: Optimistisch, aber leichtsinnig, pessimistisch, aber vorsichtig? Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 2, 105-122.
Aiken, L. S. & West, S. G. (1991). Multiple Regression: Testing and Interpreting Interaction. Newbury Park: Sage.
Bauman, L. J. & Siegel, K. (1987). Misperceptions among gay men of the risk for AIDS associated with their sexual behavior. Journal of Applied Social Psychology, 17, 329-350.
Borgers, D. (1988). Rauchen und Berufe. Prävention, 1, 12-15.
Cohn, L. D., Macfarlane, S., Yanez, C. & Imai, W. K. (1995). Risk-perception: Differences between adolescents and adults. Health Psychology, 14, 217-222.
Elbert, T. & Rockstroh, B. (1993). Psychopharmakologie. Göttingen: Hogrefe.
Fuchs, R. & Kleine, D. (1995). Vulnerabilität als Bedingungsfaktor des Sporttreibens: Schlußfolgerungen für Sport- und Gesundheitsförderung. In W. Schlicht & P. Schwenkmezger (Hg.), Gesundheitsverhalten und Bewegung (S. 79-94). Schorndorf: Hofmann.
Hansen, W. B. & Malotte, K. (1986). Perceived personal immunity: The development of beliefs about susceptibility to the consequences of smoking. Preventive Medicine, 15, 363-372.
Harris, P. & Middleton, W. (in press). The illusion of control and optimism about health: On being less at risk but no more in control than others. The British Journal of Social Psychology.
Heine, S. J. & Lehman, D. R. (1995). Cultural variation in unrealistic optimism: Does the West feel more vulnerable than the East? Journal of Personality and Social Psychology, 68, 595-607.
Hoch, S. J. (1985). Counterfactual reasoning and accuracy in predicting personal events. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 11, 719-731.
Hoorens, V. (1993). Self-enhancement and superiority biases in social comparison. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of Social Psychology (Vol. 4, pp. 113-139). Chichester: Wiley.
Hoorens, V. & Buunk, B. P. (1993). Social comparison of health risks: Locus of control, the person-positivity bias, and unrealistic optimism. Journal of Applied Social Psychology, 23, 291-302.
Janz, N. K. & Becker, M. H. (1984). The health belief model: A decade later. Health Education Quarterly, 11, 1-47.
Lee, C. (1989). Perceptions of immunity to disease in adult smokers. Journal of Behavioral Medicine, 12, 267-277.
Lek, Y.-Y. & Bishop, G. D. (1995). Perceived vulnerability to illness threats: The role of disease typ, risk factor perception and attributions. Psychology and Health, 10, 205-217.
Leppin, A. (1994). Bedingungen des Gesundheitsverhaltens. Weinheim: Juventa.
Lubin, J. H., Blot, W. J., Berrino, F., Flamant, R., Gillis, C. R., Kunzer, M., Schmahl, D. & Visco, H. (1984). Patterns of lung cancer according to type of cigarette smokers. International Journal of Cancer, 33, 569-576.
McCoy, S. B., Gibbons, F., Reis, T. J., Gerrard, M., Luus, C. A. E. & Wald Sufka, A. von (1992). Perceptions of smoking risk as a function of smoking status. Journal of Behavioral Medicine, 15, 469-488.
McKenna, F. P. (1993). It won't happen to me: Unrealistic optimism or illusion of control? British Journal of Psychology, 84, 39-50.
Moore, S. M. & Rosenthal, D. A. (1991). Adolescent invulnerability and perception of AIDS risk. Journal of Adolescent Research, 6, 164-180.
Moore, S. M. & Rosenthal, D. A. (1992). Australian adolescents' perceptions of health-related risks. Journal of Adolescent Research, 7, 177-191.
Perloff, L. S. (1987). Social comparison and illusions of invulnerability to negative life events. In C. Snyder & C. Ford (Eds.), Coping with negative life events (pp. 217-242). New York: Plenum Press.
Perloff, L. S. & Fetzer, B. K. (1986). Self-other judgments and perceived vulnerability to victimization. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 502-510.
Pligt, J. van der, Otten, W., Richard, R. & Velde, F. W. van der (1993). Perceived risk of AIDS: Unrealistic optimism and self-protective action. In J. B. Pryor & G. Reeder (Eds.), The social psychology of HIV-infection (pp. 39-58). New Jersey: Erlbaum.
Reppucci, J. D., Revenson, T. A., Aber, M. & Reppucci, N. D. (1991). Unrealistic optimism among adolescent smokers and nonsmokers. Journal of Primary Prevention, 11, 227-236.
Schwarzer, R. (1992). Psychologie des Gesundheitsverhaltens. Göttingen: Hogrefe.
Schwarzer, R. (1994). Optimism, vulnerability, and self-beliefs as health-related cognitions: A systematic overview. Psychology and Health, 9, 161-180.
Segerstrom, S. C., McCarthy, W. J., Caskey, N. H., Gross, T. M. & Jarvik, M. E. (1993). Optimistic bias among cigarette smokers. Journal of Applied Social Psychology, 23, 1606-1618.
Strecher, V. J., Kreuter, M. W. & Kobrin, S. C. (1995). Do cigarette smokers have unrealistic perceptions of their heart attack, cancer, and stroke risk? Journal of Behavioral Medicine, 18, 45-54.
Troschke, J. von (1992). Nikotin. In DHS (Hg.), Jahrbuch Sucht '93 (S. 110-122). Geesthacht: Neuland.
Tversky, A. & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for the judging frequency and probability. Cognitive Psychology, 5, 207-232.
Weinstein, N. D. (1980). Unrealistic optimism about future life events. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 806-820.
Weinstein, N. D. (1982). Unrealistic optimism about susceptibility to health problems. Journal of Behavioral Medicine, 5, 441-460.
Weinstein, N. D. (1984). Why it won't happen to me: Perceptions of risk factors and illness susceptibility. Health Psychology, 3, 431-457.
Weinstein, N. D. (1987). Unrealistic optimism about susceptibility to health problems: Conclusions from a community-wide sample. Journal of Behavioral Medicine, 10, 481-500.
Weinstein, N. D. (1989). Perceptions of personal susceptibility to harm. In V. M. Mays, G. W. Albee & S. F. Schneider (Eds.), Primary prevention of AIDS (pp. 142-167). Newbury Park: Sage.
Weinstein, N. D. (1993). Testing four competing theories of health-protective behavior. Health Psychology, 12, 324-333.
Weinstein, N. D. & Klein, W. M. (1995). Resistance of personal risk perceptions to debiasing interventions. Health Psychology, 14, 132-140.
Weinstein, N. D. & Lachendro, E. (1982). Egocentrism as a source of unrealistic optimism. Personality and Social Psychology Bulletin, 8, 195-200.
Wood, J. V., Taylor, S. E. & Lichtman, R. R. (1985). Social comparison processes in adjustment to cancer. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 1169-1183.