Acht Thesen zur Entwicklung der Europäischen Union
Europa à la Carte?
"Der Aufbruch Europas", emphatisch beschworen als Chance einer Generation, die wie keine vor ihr aus den Katastrophen eines Jahrhunderts gelernt haben sollte, hat sich deutlich verlangsamt. Die wachsende Unsicherheit über die nationalstaatliche wie die europäische Entwicklung, eine dem folgende Ratlosigkeit öffentlicher Einrichtungen und politischer Akteure sowie schließlich der Versuch, notwendige Diskussionen über eine gemeinsame Zukunft durch politische Absichtserklärungen zu ersetzen, sind Signale des Übergangs. Einmal mehr steht der europäische Einigungsprozeß am Scheideweg.
Die europäische Einigung zwischen Vertrag und Verfassung
Blickt man auf die Quantitäts- und Qualitätssprünge, die den europäischen Integrationsprozeß bislang kennzeichneten, kann Maastricht gleichzeitig als Abschluß (der evolutionären Fortentwicklung der Gemeinschaft) wie als Neubeginn (der Europäischen Union) interpretiert werden. Dieser logisch anmutende Prozeß birgt allerdings zahlreiche Probleme, die sich bislang nicht stellten oder denen man auswich.
Von romantisch überhöhten Europabildern muß man Abschied nehmen
Dies gilt zunächst für die jetzt auch explizit politische Rolle der Union, für die Professionalität ihrer Einrichtungen, vor allem aber auch für Fragen der direkten wie der indirekten Legitimation. Hinzu kommt der Zwang, von den lange Zeit romantisch oder hegemonial überhöhten "Europabildern" Abschied nehmen oder sie doch zumindest konkretisieren zu müssen; auch sind das Spannungsverhältnis von "flächendeckender" Programmatik und zunehmender Partikularisierung der Integration aufzulösen und an die Stelle der politischen Absichtserklärungen sichtbare, nachvollziehbare und akzeptable Politikergebnisse zu setzen.
| Das deutsche Drängen, in der Außen- und Sicherheitspolitik ebenso wie bei der Innen- und Justizpolitik vom Prinzip der Einstimmigkeit abzurücken, kann zwar als durchaus angemessene Reaktion auf die außenpolitische Inkompetenz wie die innen- und justizpolitischen Zweideutigkeiten der Union gesehen werden, erscheint politisch aber nicht realisierbar. |  |
| Joachim Jens Hesse ist Leiter des neugegründeten europäischen Zentrums für Staatswissenschaften und Staatspraxis sowie Professor am Institut für Innenpolitik und Systemvergleich, Fachbereich Politische Wissenschaft. |
Dabei erweist es sich als sinnvoll, zwischen einer innen- und einer außenpolitischen Betrachtung zu unterscheiden. Während in "innenpolitischer" Perspektive Fragen nach dem Kompetenzzuschnitt und der konkreten Arbeitsteilung zwischen europäischer, nationaler und regionaler Ebene zu beantworten sind, Aufgabenzuordnungen überprüft werden müssen und Leistungsfähigkeit wie Akzeptanz der europäischen Politik zur Diskussion stehen, geht es im "außenpolitischen" Bereich nicht nur um die Gewährleistung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, sondern auch darum, der Gleichzeitigkeit der Reformdiskussion auf mehreren Ebenen (NATO, WEU, EWR, EFTA, OSZE) zu folgen. Hier sieht sich eine noch ungefestigte Europäische Union Erwartungen ausgesetzt, die bislang weder mit der eigenen Handlungsfähigkeit noch mit dem Rollenverständnis vereinbar sind. Die nicht nur symbolische Bedeutung von Akzeptanzfragen kommt hinzu.
Die im Vorfeld der Regierungskonferenz erkennbaren Positionen lassen sich zu zwei Handlungsoptionen zusammenfassen:
Als Ausbaumodell sind dabei jene Vorstellungen zu kennzeichnen, die in Anerkennung der zunehmenden Fragmentierung des Integrationsprozesses die bislang eher homogene und meist auf Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten beruhende Weiterentwicklung der Union durch mehrfach differenzierte Konzepte zu ersetzen suchen. Dabei wird entweder nach Akteuren, nach Entwicklungsphasen oder nach Integrationsstufen unterschieden - je nachdem, ob gesamthaft oder in Gruppen, gleichzeitig oder phasenverschoben, umfassend oder selektiv vorgegangen werden soll. Die Diskussionen um ein "Kerneuropa", "konzentrische Ringe", ein "Europe à carte", "unterschiedliche Geschwindigkeiten" oder auch eine "variable Geometrie" sind hier zu verorten. Solche Vorstellungen haben den Vorteil, Diskussionen zu strukturieren und gelegentlich zuzuspitzen. Nachteilig ist, daß sie Problemlösungen eher vortäuschen, gelegentlich gar illusionäre Erwartungen wecken. Schreibt man etwa den mit den Maastrichter "opt-outs" beschrittenen Weg auch nur gedanklich fort, wird schnell deutlich, daß nicht nur die beschworenen Effizienz- und Vereinfachungsbemühungen leerzulaufen drohen, sondern die Union auch jenes Minimum an Zusammenhalt verlieren düfte, ohne das sie als Gemeinschaft kaum auskommen wird. Die schwierige "Mehrebenenpolitik" sieht sich im Falle weiterer Sonderkonditionen derartig vielen horizontalen wie vertikalen Abstimmungs- und Koordinationsprozessen ausgesetzt, daß als deren Resultat der "kleinste gemeinsame Nenner" oder gänzliche Ergebnislosigkeit drohen.
| Trotz des Bedeutungszuwachses, den das Parlament durch die Einführung des sogenannten Mitentscheidungsverfahrens erfuhr, nimmt es auch weiterhin eine eher untergeordnete Rolle im institutionellen Gefüge der Union ein. |  |
| Die Mitglieder des Europäischen Parlaments treffen sich zwölfmal im Jahr zu einwöchigen Sitzungen |
Die Option der Konsolidierung und Bestandssicherung geht hingegen davon aus, daß ein umstandsloses Fortsetzen des Expansionskurses die Existenz des europäischen Einigungswerks gefährden könnte. Das europäische "Demokratiedefizit" faßt dabei die normativen Bedenken zusammen. Sie richten sich auf das Verhältnis von Demokratieprinzip und Entscheidungsbefugnis, stellen Demokratiebedarf und Integrationsstand kritisch gegenüber, fordern eine parlamentarische Kontrolle der Exekutive und beklagen ein sich eher "naturwüchsig" entwickelndes Verhältnis von supranationaler Gemeinschaft zu souveränen Nationalstaaten. Nimmt man es darüber hinaus ernst mit dem "Europa der Bürger", sollte das gegenwärtige Mißtrauen, ja das Erschrecken über die Entwicklungsdynamik Anlaß zu vertrauensbildenden Politiken sein. Nur so ist einer drohenden Renatio-nalisierung zu begegnen, die das bisher Erreichte in Frage stellen könnte. Hinzu kommen dann funktionale Erwägungen, die von einer notwendigen Stabilisierung der EU-Organe zu unabweisbaren Verfahrensvereinfachungen, von einer Verstetigung der politischen Führung bis hin zu einer Professionalisierung der Verwaltung reichen. Erst wenn es gelingt, die vielfachen Effizienz-, Transparenz- und Subsidiaritätserklärungen auch wirklich umzusetzen, ist an einen weiteren Ausbau der europäischen Einrichtungen zu denken. Während die ersten Schritte der Integration noch durch politische Absichtserklärungen, breite Konsensprozesse und Überzeugungspolitiken geprägt waren, fordert die europäische Entwicklungsdynamik heute professionelle Kompetenz und politisch-administrative Kapazität bei allen Beteiligten.
Die Entscheidungsstrukturen innerhalb der Europäischen Union müssen verbessert werden
Bezieht man die mit der letztgenannten Option verbundenen Anforderungen auf die Schlüsselbereiche der gegenwärtigen Diskussion (Überprüfung der europäischen Organe, Fortentwicklung der zentralen Politikbereiche, Osterweiterung), ergeben sich eine Reihe von Handlungsmöglichkeiten. Dabei müssen die Ansätze zur institutionellen Reform von der faktischen Wirkungsweise der europäischen Einrichtungen ausgehen. Hier zeigt sich etwa mit Blick auf das Europäische Parlament, wie zwiespältig und gelegentlich auch unglaubwürdig öffentliche Verlautbarungen sind. Trotz des Bedeutungszuwachses, den das Parlament durch die Einführung des sogenannten Mitentscheidungsverfahrens erfuhr, nimmt es auch weiterhin eine eher untergeordnete Rolle im institutionellen Gefüge der Union ein. Die Arbeiten des Parlaments werden noch immer von den Verfahren der Anhörung und der Zustimmung bestimmt; nimmt man die "demokratischen Defizite" des Entscheidungsprozesses aber ernst, ist eine erweiterte Mitwirkung und verstärkte Kontrollbefugnis des Europäischen Parlaments unausweichlich. Ein vereinheitlichtes Gesetzgebungsverfahren, ein Mitentscheidungsrecht bei Mehrheitsentscheidungen im Rat, und gegebenenfalls das Einräumen eines Initiativrechts zählen zu den Ansatzpunkten. Gleichzeitig ist deutlich zu machen, daß auch bei Verfolgung dieser Reformen eine "Vollparlamentarisierung" des Europäischen Parlaments nicht in Frage kommt, solange offensichtliche Defizite direkter Legitimation vorliegen.
Der Rat ist weit vom Ideal einer föderalstaatlichen Vertretung der Unionsstaaten entfernt
Auch der Europäische Rat ist noch weit von dem demokratietheoretischen Ideal einer föderalstaatlichen Vertretung der die Union konstituierenden Einzelstaaten entfernt. Oft unter Maßgabe der Vertraulichkeit bemühen sich ein ständig wechselnder Ratsvorsitz, ein Generalsekretariat, ein Ausschuß der Ständigen Vertreter und fast 200 Arbeitsgruppen nationaler Beamter um die meist benötigte Einstimmigkeit der Ratsbeschlüsse.
Die Erörterungen der vergangenen Monate haben deutlich gemacht, daß diese Entscheidungsstrukturen schon heute kaum mehr tragbar sind und eine erneut erweiterte Gemeinschaft handlungsunfähig machen könnten. Dabei geht es nicht nur um die Frage einer erweiterten Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen, sondern auch um die Arbeitsfähigkeit des Rats im engeren Sinne. Hier stehen das praktizierte Troika-Modell zur Diskussion, die zeitliche Gestaltung des Ratsvorsitzes, schließlich die Forderung nach einer Verstetigung und damit Professionalisierung der politischen Führung.
Weniger umstritten scheint die künftige Stellung der Europäischen Kommission, auf die sich eher funktionale Empfehlungen richten: eine aufgabenorientierte Rückführung der Zahl der Kommissionsmitglieder, die Bestellung des Präsidenten durch eine qualifizierte Mehrheit der Regierungen der Mitgliedstaaten, die Zustimmung durch Rat und Parlament sowie schließlich die Gewährleistung von (horizontaler wie vertikaler) Koordination und eine Modernisierung von Arbeitsabläufen. Gleichwohl verbergen sich auch hinter solchen Vorstellungen normative Fragen. Sie gelten dem Schutz der kleineren Staaten vor einer Majorisierung durch die größeren oder auch dem Anspruch des Parlaments, durch Mitentscheidung bei der Präsidentenwahl dessen und die eigene Legitimation zu erhöhen.
Die Rolle des europäischen Gerichtshofes ist umstritten
Schließlich ist die Rolle des Europäischen Gerichtshofes als "Verfassungsgericht" und Rechtsschutzinstanz umstrittener, als manche Berichte zum Stand der EU-Organe suggerieren. Da die Gemeinschaftsverträge rudimentär, lückenhaft und unvollkommen sind, bedürfen sie zwar der Auslegung, Ergänzung und Fortbildung, doch darf dies - auch nach Meinung des Bundesverfassungsgerichtes - nicht zu Lasten der politischen Organe und des politischen Ermessens des Gemeinschaftsgesetzgebers gehen.
Die Grenzen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes sind ganz offensichtlich dann erreicht, wenn sie zu einer Ausweitung der Gemeinschaftszuständigkeit führt, und damit letztlich zu einer weiteren Übertragung nationalstaatlicher Hoheitsrechte.
Blickt man auf die zentralen Aufgabenfelder der europäischen Politik, stehen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die Innen- und Justizpolitik sowie die Wirtschafts- und Währungsunion im Vordergrund der Diskussion. Das deutsche Drängen, in der Außen- und Sicherheitspolitik ebenso wie bei der Innen- und Justizpolitik vom Prinzip der Einstimmigkeit abzurücken, kann zwar als durchaus angemessene Reaktion auf die außenpolitische Inkompetenz wie die innen- und justizpolitischen Zweideutigkeiten der Union gesehen werden, erscheint politisch aber nicht realisierbar. Dabei ist es nicht nur Großbritannien, das weitergehenden Mehrheitsentscheidungen im Wege steht, auch Frankreich sperrt sich.
Hier dürfte allein der Verweis auf die Komplementarität von Währungsunion und politischer Union Kompromißpositionen ermöglichen. Sie zielen auf eine deutlich engere Zusammenarbeit im Polizei- und Justizbereich, ergänzt um einen schrittweisen Übergang zu Mehrheitsentscheidungen auch in der Außenpolitik, es sei denn, "vitale nationale Interessen" seien tangiert. Dies korrespondiert der von Frankreich durchgesetzten und seit langem in den Ministerräten praktizierten Haltung, den Mitgliedstaaten in einem solchen Fall auch bei nur Mehrheitsbeschlüsse erfordernden Verfahren ein Veto einzuräumen. Damit bliebe die Außenpolitik Aufgabe intergouvernementaler Vereinbarung und so letztlich Angelegenheit der Nationalregierungen.
Vorurteile gegen ein "deutsches Diktat" sind nur schwer auszuräumen
Ein ähnliches Bild stellt sich im Bereich der Sicherheitspolitik. Obwohl der Ausbau der WEU zum "militärischen Arm" der Union funktional sinnvoll erscheint und zudem den Neuzuschnitt der sicherheitspolitischen Einrichtungen erleichtern würde, bleiben konzeptionelle Vorstellungen höchst strittig. Dies gilt gleichermaßen für die Frage der Osterweiterung der WEU/NATO wie für das französische Angebot, den Atomschirm im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auszudehnen.
Auch Fragen zur europäischen Währungsunion sind keinesfalls beantwortet. Hier wird gleichsam exemplarisch erkennbar, wie fragil das gegenwärtige Gleichgewicht und wie abhängig die Politik von den Finanzmärkten ist. So führen unbedachte Äußerungen von Finanzministern zu sofortigen Turbulenzen auf den Währungsmärkten und zu wechselseitigen Projektionen, die nicht nur den hochpolitischen Charakter der Währungsunion, sondern auch den geringen Zugriff der Politik in Erinnerung bringen. Die dabei zutage tretenden Vorurteile ("deutsches Diktat") werden das europäische Publikum (und die Märkte) schwerlich davon überzeugen, daß hier Prozesse in Gang kommen, denen zu vertrauen ist - von noch uneingelösten Konvergenzkriterien ganz abgesehen.
Während es so durchaus möglich erscheint, Einrichtungen und Verfahren der Europäischen Union der veränderten Ausgangssituation anzupassen, gilt dies für den Fall der Osterweiterung nicht. Angesichts der noch sehr ungleichen und instabilen Entwicklungen in den Reformstaaten Ostmitteleuropas scheidet ein schneller und gleichsam "flächendeckender" EU-Beitritt aus. Es wird vielmehr darauf ankommen, durch ein gestuftes Beitrittsverfahren eine schrittweise Anpassung an Freihandel und freie Faktormobilität zu erlauben und dabei weder die neuen Marktwirtschaften des Ostens noch den Binnenmarkt des Westens zu überfordern. Deshalb ist daran zu denken, dem vollen EU-Beitritt eine Mitgliedschaft im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) vorangehen zu lassen. Damit würden die Rechte und Pflichten des Binnenmarktprogramms auf die Beitrittsstaaten übertragen, ohne ihnen einen Zugang zu EU-Entscheidungen oder den Mitteln der Strukturfonds zu erlauben. Allerdings wird eine solche "Strategie" nur für die am weitesten entwickelten Volkswirtschaften denkbar sein, also für Polen, die Tschechische Republik und Ungarn; schon mit Blick auf die Slowakei bestehen Vorbehalte. Hinzukommt, daß angesichts der Bedeutung des Agrarsektors eine vorangehende Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (und durchaus auch der Strukturfonds) unausweichlich wird. Auch über eine abgestufte Freizügigkeit von Arbeitnehmern wäre nachzudenken, will man eine weitere Verschlechterung auf den Arbeitsmärkten vermeiden. Eine schrittweise "Einbindung" der "reiferen" Beitrittskandidaten könnte so dem Interesse der Reformstaaten folgen, ohne die ökonomische Handlungsfähigkeit der Union zu gefährden. Die Formulierung von Mindeststandards ist dabei unverzichtbar; sie wären Zielgrößen für jene Kandidaten, deren Volkswirtschaften auch einen "qualifizierten" Beitritt noch nicht erlauben.
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, daß bei der Osterweiterung die wirtschaftlichen Interessen mit den Sicherheitsbedürfnissen zu ver binden sind. Während die Diskussion um eine NATO-Erweiterung nach Osten bislang meist nur defensiv den Bedenken der russischen Führung zu entsprechen sucht, wäre hier nach Ansatzpunkten zu suchen, ein aktiveres, beiden Seiten Handlungspotentiale versprechendes Konzept zu erarbeiten. Dabei gilt es, die russische Seite von der Ernsthaftigkeit der "Kongruenz" von EU-Ausweitung und Osterweiterung des westlichen Verteidigungsbündnisses zu überzeugen. Auf dieser Basis ginge es dann um veränderte Konsultationsmechanismen und neue Felder der Zusammenarbeit. Auch wäre darauf zu verweisen, daß die Mitgliedschaften in der EU, der WEU und der NATO von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überwölbt werden sollten; damit wiederum verbinden sich zahlreiche Optionen für ein schrittweises, ein "Mittragen" Rußlands erlaubendes Vorgehen.
Somit ergibt sich für die Fortentwicklung der Europäischen Union ein Handlungsprogramm, das unabweisbaren normativen wie funktionalen Anforderungen folgt. Allerdings werden sich die Vertreter der Europäischen Union bemühen müssen, das Publikum von der Sinnhaftigkeit der weiteren Entwicklung zu überzeugen, die inzwischen erkennbare "Glaubwürdigkeitslücke" abzubauen. Hier hat sich als verhängnisvoll erwiesen, daß "Europapolitik" zu lange ein Feld der Spezialisten und Idealisten blieb, die von einer selbstverständlichen Fortsetzung des einmal beschrittenen Integrationsweges ausgingen.
Europapolitik muß demokratischer und effizienter werden
Inzwischen ist die Distanz gewachsen, die europäische Einigungsbewegung weit von dem entfernt, was Politiker ihrer Wählerschaft zu präsentieren pflegen. Allerdings ist dabei zwischen antieuropäischen Grundhaltungen, die sich lediglich bei Minderheiten finden, und einem wesentlich verbreiteteren allgemeinen Unbehagen zu unterscheiden. Dieses gründet sich auf ein Mißverhältnis von Ankündigung und Ertrag, auf die Wahrnehmung, bei der Einbuße nationaler Souveränitätsrechte nicht wirklich befragt zu werden, auf die mangelnde Sozialkompetenz der Union, und auf Vorbehalte gegenüber einem Politikstil, der sich in den liberalen Demokratien der westeuropäischen Nationalstaaten kaum noch findet.
Die Bürger Europas beginnen, die Europäische Union an ihren Erfolgen zu messen und kommen hier mit Blick auf das Unvermögen, eine dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien angemessene Position zu formulieren oder auch "nur" eine gemeinsame Ausländer- und Asylpolitik durchzusetzen, zu skeptischen Urteilen. Dabei hilft es der europäischen Sache nicht, daß auch die Widersprüche zwischen den nationalen Politiken deutlicher werden. So sind protektionistische Haltungen Frankreichs zweifellos schwer mit den Freihandelsvorstellungen anderer europäischer Staaten zu vereinbaren, verbindet Deutschland mit der Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips wesentlich mehr als etwa Großbritannien, stehen wechselseitige Vorurteile und nationalstaatliche Interessen einer Abstimmung von Finanz- und Geldpolitiken entgegen.
Gleichwohl: zum europäischen Einigungsprozeß gibt es keine Alternative. Historische Verpflichtungen, ökonomische Verflechtungen, grenzüberschreitende Bedrohungen und Globalisierungen auf den Finanzmärkten, im Infrastrukturbereich und durchaus auch beim Human- und Sozialkapital begrenzen den Zugriff der nationalen Einrichtungen. Zwar ist deren Ersatz oder besser ihre Ergänzung durch europäische Institutionen und Verfahren strittig, kommt es zu Widerständen und Gegenbewegungen, in denen sich historisch geprägtes Mißtrauen und eine Ablehnung von Form und Verfahren des Europäisierungsprozesses äußern. Gerade deshalb aber wird es darauf ankommen, Erfahrungen ernst zu nehmen, demo-katische Minima zu gewährleisten und professionelle Standards zu sichern.
Die sich damit verbindenden Aufgaben richten sich nicht nur an die Vertreter der europäischen Politik und der sie konstituierenden Nationalstaaten. Auch der Wissenschaftsbereich hat sich den angesprochenen Problemen zu stellen. Hier ist insofern Veränderung erkennbar, als mit dem Ausbau der europäischen Einrichtungen und ihrer schrittweisen Bedeutungssteigerung die Generation der "Berufseuropäer" durch eine nicht nur normativ, sondern auch funktional ausgerichtete Forschung und Beratung abgelöst wird. Vor allem die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sind dabei aufgefordert, ihr analytisches und methodisches Instrumentarium zu überprüfen.
Auch der Wissenschaftsbereich muß sich den Problemen stellen
Dabei rücken Fragen einer "Mehrebenenpolitik" in das Zentrum der Aufmerksamkeit, geht es um das Verhältnis von europäischer zu nationaler Souveränität und Identität, gilt es die Leistungsfähigkeit europäischer Politiken um die Frage ihrer Bindungswirkung zu ergänzen. Hier ist "Europa" im übrigen nicht mehr nur als Westeuropa zu begreifen, die Ergänzung um die mittel- und osteuropäischen Staatensysteme sollte zu einer Selbstverständlichkeit geworden sein. Inwieweit die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten diesen Verpflichtungen auch durch den Ausweis spezifischer Forschungs- und Beratungseinrichtungen bislang nachgekommen sind, ist strittig. Nimmt man das Subsidiaritätsprinzip ernst, gilt entsprechenden nationalen und regionalen Bemühungen verstärkte Aufmerksamkeit.
In diesem Sinne ist die Gründung des Europäischen Zentrums für Staatswissenschaften und Staatspraxis durch die drei Berliner Universitäten ein positives Signal, sich künftig unabweisbaren Fragestellungen in Lehre, Forschung und Beratung zuzuwenden.
Joachim Jens Hesse


![[Inhalt]](../../images/old_stuff/up.gif)

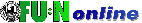 -Startseite
-Startseite