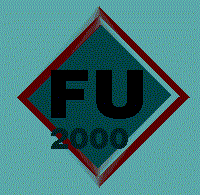 Katastrophe oder
Chance?
Katastrophe oder
Chance?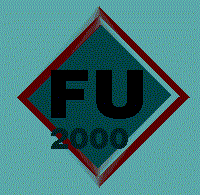 Katastrophe oder
Chance?
Katastrophe oder
Chance?Dies ist ein katastrophaler Substanzverlust für die FU. Denn das
Universitätsklinikum Rudolf Virchow (UKRV) war immer schon das
spektakulärere der FU-Klinika - deutlich größer nach Stellen- und
Finanzausstattung, vielfach mächtiger nach Publizität und Prätention und
nach Abschluß der Bauarbeiten im Wedding das modernste Klinikum Europas.
Das zukünftige HU-Großklinikum, in das die Charité den Nimbus der
Tradition und das UKRV moderne Bausubstanz und Ausstattung einbringt,
könnte zum "Schlachtschiff" der Berliner Hochschulmedizin werden. Der
FU bleiben Einrichtungen, die nicht weiter dezimiert werden können, ohne
an die Existenzgrenze zu geraten. Selbst wenn Pharmakologie,
Toxikologie und die Klinik für Psychiatrie aus dem UKRV der FU erhalten
bleiben, so fehlen dem neu zu bildenden FU-Fachbereich Humanmedizin
manche Disziplinen gänzlich oder sind erheblich kleiner und weniger
differenziert als in dem zukünftigen HU-Großklinikum. Daher müssen
weitere Einsparungen auf die HU konzentriert werden, in der jetzt die
abzubauenden Doppelangebote bestehen werden. Die personelle Ausstattung
des Universitätsklinikums Benjamin Franklin (UKBF) ist ohnehin geringer
als die von UKRV und Charité, so daß die Forderung nach gleichartigen
Arbeitsbedingungen in FU- und HU-Medizin zu einer Verbesserung der
Finanzierung des UKBF führen müßte. Damit ist kaum zu rechnen. Dennoch:
Mit der Entscheidung für die "Elefantenhochzeit" hat die Politik -
unausgesprochen - eine besondere Verpflichtung gegenüber der FU-Medizin
übernommen.
FU-Medizin zweitklassig?
Das quantitative
Ungleichgewicht zwischen den Medizinbereichen der beiden Universitäten
ist ein gravierender Geburtsfehler der Neuordnung. Da fachliche
Ergänzungen und wichtige Sanierungen im Steglitzer Klinikumsgebäude
kaum zu finanzieren sind, der Mangel an Forschungsflächen nicht behoben
wird, die Dezimierung der wissenschaftlichen Substanz in den
Grundlagendisziplinen neue Entwicklungen kaum zuläßt, scheint die
Entwicklung insgesamt zweifelhaft. Das quantitative Ungleichgewicht
könnte zu einem qualitativen werden. Eine möglicherweise zweitklassige
FU-Medizin aber wäre riskant, auch angesichts der bundesweiten Debatte
um die Hochschulmedizin. So haben sich Kultusministerkonferenz und
Wissenschaftsrat mit Überlegungen zu Worte gemeldet, in denen
Schließungen einzelner Universitätsklinika (Fachjargon: "Entwidmung")
nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Hochschulmedizin steht bundesweit
im Fadenkreuz der Gesundheits- wie auch der Finanzpolitik. In Berlin
hätte man sie zum Zwecke struktureller Einsparungen insgesamt aus den
Universitäten ausgliedern und in einer Medizinischen Hochschule
zusammenführen können. Die Politik hat das nicht gewollt. Daher muß die
FU jetzt ihren Medizinbereich so gestalten, daß eine weitergehende
Dezimierung vermieden wird. Sonst geriete die FU insgesamt in die Gefahr
noch größerer Substanzverluste, z.B. auch in den Naturwissenschaften.
Aus der Katastrophe kann eine Chance für die FU-Medizin werden, wenn
diese mit dem Ziel eines neuen Leistungsniveaus und in engem Verbund mit
den nicht-medizinischen Bereichen gestaltet wird. Denn die Zukunft der
FU-Medizin ist nicht nur finster: Während viele Kräfte in UKRV und
Charité durch innere Machtkämpfe gebunden sein werden, wird sich die FU
auf Substanzgewinnung konzentrieren können. Wenn die verbliebenen
Ressourcen konsequent genutzt, Ziele klug geplant, die dafür
angemessenen Strukturen errichtet und so die wissenschaftliche
Leistungsfähigkeit derart gefördert werden kann, daß dies auch der Lehre
und der Krankenversorgung zugute kommt, kann die FU-Medizin erstklassig
werden und auf politischer Ebene Priorität bei
Ausstattungsentscheidungen beanspruchen.
Die "Nabelschnur" zur Universität wird dünner
Der
Vergleich zeigt das UKBF bereits jetzt trotz geringerer Staatszuschüsse
und schwächerer Personalausstattung als das gegenüber dem UKRV nach
DFG-Einwerbung ("input") und Impact-Faktoren ("output") in der Forschung
leistungsstärkere. Und die Grundlagenmedizin hat durch ihre Lehre und
die gewachsene Kooperation in der Forschung Profil bewiesen und wird
durch Toxikologie und Pharmakologie deutlich gestärkt. Der Kern einer
neuen Entwicklung ist also vorhanden. Bei der Neugestaltung ist die
Stellung der Medizin innerhalb der FU insgesamt zu bedenken. Gesetze und
FU-interne Entscheidungen führten in letzter Zeit zunehmend dazu,
Einrichtungen (z.B. Zahnklinik) und Zuständigkeiten (z.B. für
Lehrkrankenhäuser) in die Klinika zu geben und deren Eigenständigkeit
noch zu vergrößern. Jetzt wird diese Separation verstärkt: Sämtliche
Einrichtungen des Fachbereichs Grundlagenmedizin werden aus der
zentralen Universitätsverwaltung ausgegliedert. Der neue Fachbereich
Humanmedizin wird so mindestens haushaltstechnisch von der Uni
weitestgehend getrennt. Die "Nabelschnur" zur Universität wird dünner.
Soll die neue FU-Medizin mit über 100 Professuren fast eine kleine
Hochschule innerhalb der FU werden oder sollte ihre Einbindung eher
verstärkt werden? Für die FU-Medizin ist die Zusammenführung der
theoretischen und klinischen Disziplinen eine neue und schwierige
Aufgabe, weil sie seit den 70er Jahren in viele (zeitweise bis zu
sieben!) Fachbereiche zergliedert worden war und sich daher ihrer
übergreifenden Aufgabenstellungen vielfach nicht mehr bewußt ist. Auch
hier müssen neue Traditionen entwickelt werden.
Das alte Selbstverständnis des UKBF muß ebenso wie das der Grundlagenmedizin zugunsten des neuen Bereichs erweitert, das Denken in den Kategorien des Krankenhauses durch die "corporate identity" eines Fakultäts-Verbundes ersetzt werden. Die Wirtschaftsführung muß sich an den gemeinsamen Zielen von Forschung, Lehre und Krankenversorgung orientieren. Gelingt dies, so wird sich auch der strukturelle Interessenskonflikt zwischen Klinikumsvorstand (für das Krankenhauswesen zuständig) und Fachbereichsrat (für Forschung und Lehre zuständig) auflösen lassen. Die Kompetenzen des Fachbereichs werden durch die Regelungen des UniMedG zur Wirtschaftsführung erweitert. Er sollte dies für leistungsorientierte Ausstattungsentscheidungen nutzen. Dafür müssen die Bemessungskriterien - u.U. durch Außenbegutachtung - geschärft werden. Kriterien von "Leistung und Belastung" sollten noch mehr Gewicht gewinnen - bis an den Sockel der gesetzlich garantierten Mindestausstattung. Denn der Staatszuschuß wird in den nächsten Jahren eher schrumpfen als wachsen. Nur wenn die Grundausstattung verfügbar gemacht werden kann, könnte dem demnächst auslaufenden Sonderforschungsbereich (SFB) 174 ein Neuantrag folgen oder ein Graduiertenkolleg in Ergänzung zum neuen SFB 366 entstehen. Wichtige Berufungen - Immunologie, Virologie u.a. - müssen in diesen Planungszusammenhang gestellt werden. Die Vielfalt der Medizin - von der Molekularbiologie bis zur Medizingeschichte - macht ein differenziertes Instrumentarium der Leistungsbewertung nötig. Der "output" muß mehr als der "input" gewertet werden und - wo immer möglich - die Qualität mehr als die Quantität.
Ein gravierender Engpaß im UKBF besteht bei den
Forschungsflächen: Die Streichung der geplanten Forschungscontainer ist
ein politischer Skandal auch angesichts der wiederholten Forderungen
des Wissenschaftsrats und forschungspolitisch unklug: Kliniknahe
Forschung ist für klinische Forschung unverzichtbar. Aus guten Gründen
wurde bei der Planung des Steglitzer Klinikums die Integration von
Forschungslabors und Krankenstationen, von theoretischen Instituten und
Kliniken in einem Baukörper vorgesehen. Nähe ist immer noch eine der
wichtigsten Voraussetzungen für wissenschaftliche Zusammenarbeit.
Innovation in zukunftsträchtigen Forschungsfeldern ist gerade in Zeiten
schrumpfender Haushalte und schwieriger Umstrukturierungen nötig.
Zusammenarbeit mit den medizin-nahen Fächern der FU-Naturwissenschaften
ist daher eine wichtige Planungsaufgabe. In den neuen Feldern z.B. der
"Molekularen Medizin" sind solche Kooperationsansätze auch mit
außeruniversitären Einrichtungen vielversprechend.
Ein anderes Profil als die HU-Medizin entwickeln
Neue Kooperationen führen auch zu neuen Inhalten und Methoden von
Ausbildung und Lehre. Das Selbstverständnis des neuen Fachbereichs
Humanmedizin mit wissenschaftlichen Schwerpunkten um die vorhandenen
SFBs sowie einer engen Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaften legt
es nahe, sich in besonderer Weise um eine an den wissenschaftlichen
Grundlagen der Medizin orientierte Lehre zu kümmern. Es muß nicht
schaden, wenn die FU-Medizin in dieser Hinsicht ein anderes Profil als
die HU-Medizin entwickelt. Die Promotionsordnung für
Naturwissenschaftler in der Medizin könnte hier wegweisend werden. Die
geistes und gesellschaftswissenschaftlichen Bezüge der Medizin sollen
in dem Universitäts-übergreifenden Zentrum für "Human und
Gesundheitswissenschaften" verdeutlicht werden. In einer in größerem
Rahmen kooperierenden Hochschulmedizin in Berlin wäre das Zentrum ein
Zeichen der Gemeinsamkeit gewesen. Ob eine nach dem UniMedG gestaltete
Berliner Medizinlandschaft sich zu solcher Gemeinsamkeit zusammenfinden
kann, wird sich erweisen müssen. Die FU-Medizin wird mindestens zunächst
auf ihr eigenes Profil bedacht sein müssen. Die Neugestaltung erfordert
große Anstrengungen, aber sie ist nicht unlösbar. Für die inhaltliche
Profilierung wären zwei parallele Wege nützlich: Die innere
Korsettierung durch eine fachbereichseigene Strategiekommission und die
äußere Unterstützung durch einen "Wissenschaftlichen Beirat" von
Experten anderer, auch ausländischer Universitäten. Die Zukunft der
FU-Medizin wird aber vor allem von dem Ausmaß an Konsens und
persönlichem Engagement aller Beteiligten abhängen. Sie wird auf die
Bereitschaft von FU-Leitung und zentralen Gremien angewiesen sein, den
neuen Fachbereich bei seiner Aufgabe von Identitätsentwicklung und
Profilierung zu unterstützen.
Prof. Dr. Peter Gaehtgens

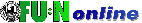 -Startseite
-Startseite