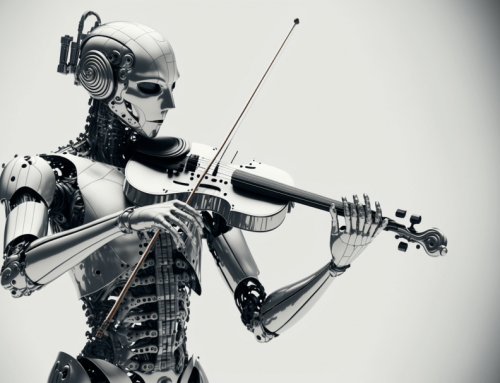Stadtfarm, Infarm und Efficient City Farm zeigen, wie die Arbeit in der Landwirtschaft von der Idealvorstellung aus dem Kinderbuch abweichen kann. Die Berliner Unternehmen experimentieren mit neuen, an das städtische Umfeld angepassten Formen des Anbaus und kämpfen um ihren Platz auf dem Lebensmittelmarkt.
von Raoul Danilo Spada
Beim Wort Landwirtschaft denken wenige noch vor dem weiten Feld an Gewächshäuser, doch gerade hier nimmt die Entwicklung Fahrt auf. Im Gartenbau entstehen neue landwirtschaftliche Betriebe, die dem hohen wirtschaftlichen Druck mit Start-Up-Naivität entgegentreten. Ein Teil dieser Betriebe versucht sich in den Städten zu etablieren. Auf minimaler Fläche werden beim Urban Farming mit intensiver Bewirtschaftung und neuen Anbaumethoden Konzepte erprobt, die von den Unternehmen als zukunftsweisend angepriesen werden. Ob die Betriebe am Markt Bestand haben, wird sich zeigen. Viele Ideen stecken noch in den Kinderschuhen, kein Betrieb gleicht dem anderen.
Zwei Dinge haben die Unternehmen aber gleich auf den ersten Blick gemein: Sie brauchen immenses Startkapital und sie stellen das Bild von familiengeleiteten Bauernhöfen vollständig auf den Kopf.
Efficient City Farming: Erst Fisch und Basilikum, dann Farmen
Efficient City Farming (ECF) betreibt mitten in Schöneberg eine Anbaumethode namens „Aquaponik“ in seiner Testfarm. Das ist eine Mischung aus klassischer Aquakultur und Hydroponik, einer Anbaumethode in welcher die Nährstoffe nicht aus der Erde kommen. Dies funktioniert in einem Kreislaufprinzip: In großen Fischtanks wachsen Buntbarsche heran. Ihre Ausscheidungen werden durch Bakterien in Dünger umgewandelt und für den Basilikumanbau verwendet. Die Fische landen tiefgefroren in Rewe-Kühltruhen und das Basilikum steht als Topfpflanze daneben zum Verkauf.
Die Preise machen deutlich, dass hier noch auf einer Testfarm angebaut wird. Die Basilikum-Pflanzen sind über einen Euro teurer als die Bio-Alternative im gleichen Supermarkt. Obwohl in kleinen Mengen Pestizide eingesetzt werden und das Bio-Siegel fehlt, entscheiden sich die KäuferInnen trotzdem oft genug für das Grünzeug aus der Innenstadt. „In Italien fragt man auch nicht nach Bio-Wurst, sondern nach einer geilen Salami aus der Region“, erklärt sich das Christian Eschternacht, einer der beiden Gründer: „Da wo man gerade ist, hat man halt Lust aus der Region zu essen.“
Der Verkauf von Lebensmitteln ist dabei für das Unternehmen nicht zentral. Die Testfarm dient nur als Anschauungsobjekt, das eigentliche Geschäftsmodell ist ein anderes. „Erst wollen wir Fisch verkaufen, dann Farmen“, sagt Eschternacht. ECF konzipiert und errichtet Farmsysteme. In der Schweiz steht schon eine vom Unternehmen geplante und gebaute Farm auf dem Dach eines Gemüsehändlers. Hier werden Forellen, Kräuter und Salate für Hotels, Restaurants und zur Verwendung im Catering produziert. Die dritte Farm verkauft in Brüssel an den Lebensmitteleinzelhandel und an Restaurants und bietet ihre Waren im Direktvertrieb an.
Arbeit wie im ganz gewöhnlichen Gewächshaus

Weite Basilikumfelder im Gewächshaus der Schöneberger Farm von ECF. Foto: Raoul Spada
Die Arbeit in der Farm sieht einem konventionellen Gewächshaus ziemlich ähnlich: FischwirtInnen kümmern sich um die Barsche, GärtnerInnen bauen das Basilikum an. Das Prinzip scheint darauf ausgerichtet, überall und in jeglicher Größe replizierbar zu sein. Warum die Farm zwingend in der Stadt stehen muss, bleibt bei der Führung durch den Betrieb unklar. Der Gründer erklärt sogar, dass ein Standort am Stadtrand effizienter wäre. Direkt neben dem Zentrallager von Rewe wäre es perfekt. Von dort aus würden die Produkte auf Berliner Supermärkte verteilt, die Lieferwege also minimiert. Das führt vor Augen, wie sehr sich ECF an Rewe orientiert.
Die Abhängigkeit von der Supermarktkette macht sich auch als Preisdruck bemerkbar. Erst ab 100 Tonnen Fisch pro Jahr sei Aquakultur für den Vertrieb über Supermärkte wirklich rentabel, so der Gründer. ECF produziert in Schöneberg aber nur rund fünf Tonnen – daher muss der Verkauf des Basilikums über höhere Preise Verluste ausgleichen.
Die Stadtfarm: Kommunikation ist auch Arbeit
Im Stadtpark Herzberge in Lichtenberg steht auf 2500 m² Anbaufläche eine Stadtfarm. In Gewächshäusern einer alten DDR-Blumenzucht wird zwischen Beeten der Firma InVitroTech und Feldern und Lagerhallen der Agrarbörse angebaut.
Die Betreiber nennen ihre Anbaumethode „AquaTerraPonik“: In Fischtanks werden Afrikanische Welse herangezogen. Da die Wassermenge der nordafrikanischen Flüsse, in denen die Welse wild leben, im Sommer stark zurückgeht, reagieren die Fische auf eine große Besatzdichte nicht mit Stress. Während die Ausscheidungen in der Wildnis mit steigenden Wassermassen ausgeschwemmt werden, werden sie hier zum Düngen genutzt. Bakterien wandeln auch hier giftiges Ammonium in Nitrat um und machen es damit zum Anbau von Salaten, Kräutern, Obst und Gemüse verfügbar. Das gefilterte Wasser fließt über die Wurzeln der Pflanzen in grobkörnigem Substrat wieder zurück in die Fischtanks – das reduziert den Wasserverbrauch gegenüber herkömmlichen Anbaumethoden drastisch. Das zusätzliche Wort im sperrigen Namen verdankt AquaTerraPonik laut Topfarmers, dem Betreiberunternehmen der Stadtfarm, einer besonderen Aufmerksamkeit den Substraten gegenüber. Im Gegensatz zu anderen Aquaponik-Verfahren bekämen hier Mikroorganismen die Gelegenheit, sich an den Wurzeln anzusiedeln. Das mache die Pflanzen widerstandsfähiger.
Ohne Bio-Siegel, aber mit Ambitionen
Pestizide werden von Florian Danke, dem Fachleiter für den Gemüseanbau und studierten Biologen, auch deswegen nicht eingesetzt – sie werden nicht benötigt. Stattdessen kommen natürliche Helfer wie Regenwürmer, Gallmücken, Florfliegenlarven, Schlupfwespen und Marienkäfer zum Einsatz. Für eine Zertifizierung wird das allerdings nicht gemacht. In Deutschland erhalten Pflanzen, welche nicht in Erde angebaut werden, grundsätzlich kein Bio-Siegel. Die Fischzucht qualifiziere sich laut der Mitarbeiterin Anne Vollborn ebenfalls nicht für eine Bio-Zertifizierung. Einer Zertifizierung wäre die Stadtfarm aber auch nicht abgeneigt: „Für viele Menschen ist das Bio-Siegel ein einfacher Zugang.“ Der WWF-Fischratgeber bezeichnet die Zucht afrikanischer Welse trotzdem als umweltfreundlich – nur beim Wels und beim Karpfen steht das in der App benutzte Ampelsystem für alle Zucht- und Fangmethoden auf grün.

Die Fruchtfolge wird nach Saison gestaltet, um nicht zu viel heizen zu müssen. Tomaten gibt es deswegen nur im Sommer. Foto: Topfarmers Stadtfarm Herzberge
Auf dem Weg zur ökologischen Produktion gibt es auch andere Baustellen: Das Fischfutter wird noch extern eingekauft und in den kalten Monaten werden die Gewächshäuser mit Öl beheizt. Für beides wird aber schon nach Lösungen gesucht. Ein Team versucht mit Wasserlinsen, auch als Entengrütze bekannt, ein vegetarisches Fischfutter zu entwickeln. Carbon Loop Technologies, ein eigens abgespaltenes Unternehmen, arbeitet auf dem Gelände an einer CO²-neutralen Heizmethode um bald die Ölheizung abschaffen zu können.
Eine Farm wie für die Schulklasse gebaut
Beim Gang über das Gelände zeigt sich, wie wichtig die Kommunikation für das Konzept von Topfarmers ist. Schulklassen fragen Führungen an, Studierendengruppen besuchen die Farm, regelmäßig gibt es Informationsveranstaltungen. Jeden Samstag gibt es einen Markt mit anderen regionalen Herstellern auf dem Gelände, jeden Freitag Führungen. Dabei lebt die Farm auch von ihren BesucherInnen und damit auch von ihrem Umfeld. Der Park, die Gärten und Felder um die Gewächshäuser locken Gäste und KäuferInnen an. „Eine Farm soll nicht viel größer werden, die Farmen müssen sich organisch in ihre Standorte einfügen.“ erklärt Anne Vollborn bei einer Führung zu den Zukunftsplänen des Unternehmens. Bis zu zehn neue Farmen sollen in Berlin entstehen. Die Präsentation der Farm ist für das Unternehmen daher überlebenswichtig, AbnehmerInnen werden insbesondere in direkter Nähe zur Farm gesucht.

WerkstudentInnen und geringfügig Beschäftigte liefern per Fahrrad frisch gemachte Salate ins direkte Umfeld. Foto: Raoul Spada
Anders als ECF vertreibt die Stadtfarm ihre Produkte noch nicht über Supermärkte. WerkstudentInnen und geringfügig Beschäftigte arbeiten im Besucherzentrum am Verkaufsstand. Fünf Tage in der Woche liefern sie per Fahrrad von Köchen fertig zubereitete Salate an Unternehmen, Behörden und Privatpersonen im Bezirk. Was nicht in den Salat kommt, wird für den Vertrieb haltbar gemacht. Die Welse werden geräuchert, zu Fischwürstchen und -bällchen verarbeitet oder eingefroren. Gemüse, das nicht im Salat verwendet wird, wird von den Köchen weiterverarbeitet.
Infarm: Vertikale Miniaturfarmen in der Gemüseabteilung
Seit einiger Zeit betreibt infarm Miniaturfarmen für Kräuter direkt in Supermärkten. Das Berliner Unternehmen treibt mit seinen vertikalen Anbauflächen den Effizienzgedanken insbesondere beim Platzsparen noch etwas weiter voran. Nach eigenen Angaben benötigen die kleinen Kräuterhochhäuser nur 0,5% der Fläche von konventioneller Landwirtschaft. Auch hier wird der Wasserbedarf durch einen geschlossenen Kreislauf und ohne Erde minimiert. Die Lieferwege seien außerdem 90% kürzer – ob im Vergleich mit Lieferwegen von Kräutern aus den Niederlanden oder im Gegensatz zur zurückgelegten Strecke von Äpfeln aus Südafrika bleibt offen.
„Hyperlokal“, nennt das David, einer der infarm-Stadtgärtner in einem Berliner Supermarkt. Die Stadtgärtner sind zuständig für Aussaat, Pflanzen, Ernte und Verpacken der Kräuter – es scheint aber, als sei ihre wichtigste Funktion das Gespräch mit den Kundinnen und Kunden. David fährt wie seine Kollegen mit einem Transporter von Supermarkt zu Supermarkt und arbeitet direkt in der Gemüseabteilung, mitten zwischen den Einkaufenden. Fragen zu den Kräutern und dem Anbau sind die Regel, viele sind neugierig und möchten mehr wissen. Während er Kräuter verpackt und in die Regale einräumt, hilft er einer Kundin bei der Kräuterauswahl. Nebenbei erzählt er einem Interessierten von den Wachstumsplänen seiner Arbeitgeber und der Pestizidfreiheit der Pflanzen.
Der „Spirit“ muss repräsentiert werden

Die Miniatur-Gewächshäuser beleuchten Obst- und Gemüseabteilungen in Berlins Supermärkten. Foto: Raoul Spada
Wie viel Wert das Unternehmen auf die Selbstdarstellung legt, zeigt sich auch in den Jobanforderungen. Die vollzeitbeschäftigten Gärtnerinnen und Gärtner müssen keine Lehre abgeschlossen oder studiert haben. Ein grüner Daumen, eine rote Karte (ein amtlicher Schulungsnachweis zum Umgang mit Lebensmitteln), ein Führerschein und viel Kontaktfreude reichen aus, um die Farmen zu pflegen zu können. Vor allem geht es aber darum, „den Spirit an den Standorten zu repräsentieren“.
Beim Betrachten der Stellenanzeigen entsteht der Eindruck, die eigentliche Arbeit finde woanders statt. Neben Stadtgärtnerinnen und –gärtnern sucht das 2013 gegründete Unternehmen ArchitektInnen, IngenieurInnen, InstallateurInnen, PlanerInnen und KoordinateurInnen sowie auch Finance-, Sales-, Customer-Success-Project-, People-Operations-Manager sowie IT- und Daten-SpezialistInnen und Webdeveloper. Die Berufsbezeichnungen machen deutlich: Urban Farming muss nichts mit Heugabeln zu tun haben. Stattdessen wird die Ertragssteigerung auf dem Macbook und in der Farmproduktion erarbeitet. Das Unternehmen zielt auf aggressive Expansion.
Urban Farming findet am Schreibtisch statt
Das ist der Teil der städtischen Landwirtschaft, der für die Kundinnen und Kunden unsichtbar bleibt. Ein großer Teil des Ertrages wird durch Arbeit am Schreibtisch in Büros und Co-Working-Spaces erwirtschaftet. Wie auch auf dem Land arbeiten außerdem IngenieurInnen an der Effizienzsteigerung – nur nicht an riesigen rollenden landwirtschaftlichen Produktionsmaschinen, sondern mit ArchitektInnen zusammen an Gewächshäusern und Bewässerungsanlagen. Das funktioniert nur mit viel Startkapital. Meistens entstehen neue Konzepte schon in starker Abhängigkeit von KapitalgeberInnen. Die Unternehmen müssen ihre ökologischen Vorstellungen dem Kapitaldruck unterordnen. Wo es anders abläuft, muss oft irgendwo gespart werden. Für den Lieferdienst braucht es dann günstige Arbeitskraft oder es wird an Futtermitteln gespart.
Der Vertrieb über den Supermarkt lockt viele Unternehmen in die Abhängigkeit, da der Aufbau von Vertriebswegen abseits der großen Ketten nur schleppend vorangeht. Die VerbraucherInnen sind bequem – höhere Preise und weitere Wege wirken auf sie schnell abschreckend. Innovationen in der städtischen Landwirtschaft haben deswegen vor allem eine Frage zu beantworten: Wie kommt das Produkt unkompliziert zu den Verbaucherinnen und Verbrauchern?
Wie die urbane Landwirtschaft sich entwickeln wird, bleibt offen. Neue Vertriebswege könnten bei dieser Entwicklung die Richtung vorgeben. Ob die neuen Anbaumethoden letztendlich zu ökologischerer Produktion führen oder in riesigen Agrarfabriken münden werden, wird mit dem Einkauf und durch die Gesetzgebung entschieden. Damit aber Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihrem Einkauf überhaupt einen bewussten Einfluss auf die Entwicklung haben können, braucht es vor allem eins: Transparenz. Reges Nachfragen und gut besuchte Führungen zeugen von einem wachsenden Interesse für den Anbau. Damit Verbraucherinnen und Verbraucher die Produkte im Supermarkt richtig bewerten können, brauchen sie aber Einsicht in Produktion und Handel.
Auch für die Probleme der LandwirtInnen braucht es in der Stadt ein neues Bewusstsein. Hier steht der Preisdruck durch den Einzelhandel häufig an erster Stelle. Ein Zugewinn an räumlicher Nähe hat das Potential, der Entfremdung der Städterinnen und Städter von der Landwirtschaft Einhalt zu gebieten. Zumindest könnten die neuen Konzepte dabei helfen, einen Anstoß in die richtige Richtung zu geben – mit Offenheit und Gesprächsbereitschaft.
 Raoul Danilo Spada studiert nach einem Exkurs in die Urbanistik bald wieder im Master am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität. Sein Interesse für städtische Entwicklungen nimmt er mit in seine Zukunft im Journalismus.
Raoul Danilo Spada studiert nach einem Exkurs in die Urbanistik bald wieder im Master am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität. Sein Interesse für städtische Entwicklungen nimmt er mit in seine Zukunft im Journalismus.