
Kaum einer Tierart wird soviel Zuneigung zuteil wie den Delphinen. Schon
im Altertum rankten sich viele Mythen um sie: Im antiken Griechenland
galt der Delphin als heiliges Tier des Apollon, des Dionysos und der
Aphrodite. Die Göttin der Liebe und der Schönheit soll nach
ihrer Geburt von einem Delphin an Land gebracht worden sein. Das Bild
vom anmutigen, sanftmütigen Wesen, das die Nähe des Menschen
sucht,
hat sich bis in unsere Zeit erhalten. In der Tat sind die bis zu vier
Meter langen, hochintelligenten Meeressäuger aus der Familie der
Zahnwale einzigartig in der Tierwelt. Und kein Fall ist jemals bekannt
geworden, bei dem ein Mensch Opfer dieses Raubtiers wurde. Doch warum
zwängt der Mensch seine Freunde in enge Bassins? Warum quält,
warum tötet er, was er liebt?

Die Gefahren, die vom Menschen ausgehen, haben für "Flippers Vettern" viele Gesichter: Da sind zum einen die Treibnetze, in denen sie hängenbleiben und ertrinken. Jährlich erleiden so viele hundert einen qualvollen Tod, obwohl die Fischer eigentlich ganz andere Beute suchen. An anderen Orten werden sie aber auch direkt gejagt, sei es, um sie als unliebsame Nahrungskonkurrenten auszuschalten, oder weil in einigen Ländern Delphinfleisch immer noch gegessen wird. Amerikanische und sowjetische Wissenschaftler mißbrauchten Lernfähigkeit und Spieltrieb der Tiere, um sie in den Dienst des Militärs zu stellen. Sie wurden unter anderem darauf trainiert, als lebende Torpedos feindliche Schiffe oder U-Boote zu versenken oder mit der entsprechenden Technik am Körper Unterwasseranlagen auszuspionieren.
Weltweit kämpfen Tierschützer gegen diese Barbarei. Doch auch
viele,
die den Kampf mit ihren Spendengeldern unterstützen, übersehen das
Leid der in den sogenannten Delphinarien gehaltenen Tiere. Deren Becken
sind für eine artgerechte Haltung viel zu eng. Geblendet von der
eigenen
Begeisterung über die akrobatischen Leistungen sehen die Besucher
nicht,
daß die ausdauernden Schwimmer, deren Artgenossen im Meer oft weite
Strecken zurücklegen, nur ihrem Bewegungsdrang folgen, um nicht
körperlich und seelisch zu verkümmern. Daß die
Gefangenschaft das Leben
der Tiere deutlich verkürzt, ist schon seit langem bekannt. Trotzdem
gibt es erhebliche Widerstände, die Tiere auszuwildern. Kommerzielle
Interessen spielen dabei oft eine wichtige Rolle, doch auch von seiten
der Tierschützer werden Bedenken laut, die Meeressäuger nach
jahrelanger Gefangenschaft unvorbereitet in die Freiheit zu entlassen.
So stellt sich die Frage, welche Fähigkeiten die Tiere mit Hilfe des
Menschen erst wieder erlernen mńssen, um in der Freiheit überleben zu
können.
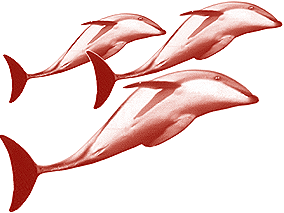
Daß eine artgerechte Haltung von Delphinen grundsätzlich möglich ist, zeigt ein Projekt israelischer Meeresbiologen in Eilat am Roten Meer. Für ihr Konzept wurden sie unlängst sogar von der Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere, die der üblichen Delphin-Haltung den Kampf angesagt hat, ausdrücklich gelobt.
Zwei bedeutsame politische Entwicklungen begünstigten die
Entstehung des Projekts: Durch den Zerfall der Sowjetunion verwaisten
Delphin-Forschungsinstitute am Schwarzen Meer, und durch den
Friedensprozeß im Nahen Osten boten sich in Eilat gute
Voraussetzungen für ein großes Freigehege. Die Tiere, zwei
Männchen
und drei Weibchen, wurden den Russen abgekauft und in einem 14.000
Quadratmeter großen, eingezäunten Gebiet im Roten Meer
ausgesetzt.
Durch den Zaun können viele Meeresorganismen herein- und heraus
schwimmen. Die Delphine fangen einen Großteil ihrer täglichen
Nahrung selbst. Das Projekt hat sich inzwischen zu einem
gewinnträchtigen Publikumsmagneten entwickelt: 250.000 Besucher kommen
jährlich zu den Vorführungen und einige dürfen sogar -
unter Aufsicht - mit den Delphinen schwimmen und tauchen.

Diese Vorführungen und die Kontaktaufnahme beruhen auf der freiwilligen Mitarbeit der Delphine. Der Touristenrummel bleibt stets auf einen Teil ihres Gebietes beschränkt und findet nur zu bestimmten Zeiten statt. Unter besonderen Umständen, wie bei der Geburt eines Kalbes, bleiben die Menschen ganz ausgesperrt. Das erstaunliche ist jedoch, daß die Delphine selten eine Show versäumen, obwohl sie nicht mehr - wie in den Delphinarien üblich - für ihre Kunststücke mit Leckerbissen belohnt werden. Ihnen reicht offensichtlich das Lob ihrer Trainer und die Aussicht auf Abwechslung. Inzwischen öffnet sich den Delphinen sogar ab und zu das Tor zur Freiheit. Davon machen sie aber nur zögernd und vorübergehend Gebrauch.
Die israelischen Projektinitiatoren hüteten sich allerdings davor, dieses Verhalten voreilig als einzigartige Sympathiebekundung des Delphins für den intelligentesten Affen auf Erden zu deuten. Der Gefahr waren sie sich nicht zuletzt aufgrund einer irritierenden Beobachtung sehr wohl bewußt: So gibt es im Roten Meer bereits jetzt ausgewilderte Delphine, die immer wieder zu ihrem Strand und ihren Touristen zurückkehren. Ist diese Fixierung auf den Menschen deshalb nicht eher als irreversible Verhaltensstörung zu interpretieren?
Da sich die israelischen Wissenschaftler in dieser Frage nicht allein
auf ihre Kenntnisse verlassen wollten, begaben sie sich auf die Suche
nach Kollegen, die auf diesem Gebiet Spezialisten sind. Sie fanden sie
im fernen Berlin bei Prof. Todt und seiner Arbeitsgruppe am Institut
für Verhaltensbiologie der FU. Seit vielen Jahren erforschen die
Wissenschaftler das Gefühlsleben von Tieren. "Stimmungsbarometer"
erstellen sie auf der Grundlage von Laut- und Stimmenanalysen. Schweine,
Affen und Vögel waren bisher die bevorzugten Studienobjekte. Mit
Ferngläsern, Videokameras und Unterwassermikrophonen beobachten die
Berliner nun seit Mitte letzten Jahres von einem Turm aus das
Freigehege. Die Unterwassermikrophone arbeiten dabei rund um die Uhr.
Delphine erzeugen eine Vielzahl unterschiedlicher Geräusche. Sie
schnattern und pfeifen ständig vor sich hin. Gewisse Pfeiftöne
kennt man sogar schon seit längerem als Erkennungssignale der Tiere.
Jeder Delphin hat seinen eigenen, höchst individuellen
Identifizierungspfiff. Die Berliner Wissenschaftler fanden heraus, daß
diese Pfiffe nicht nur der gegenseitigen Ortung, sondern auch zur
Mitteilung von Gefühlen dienen. Je nach Stimmung kann ein Delphin
seinen Erkennungspfiff variieren. So wird man vielleicht bald
feststellen können, ob sich ein Delphin wohlfühlt oder nicht.
Über die "Delphinsprache" selbst ist dank der Arbeit des vergangenen
Jahres schon viel bekannt, die Meeressäuger ließen sich
beispielsweise
auch rufen, als man den entsprechenden Pfiff durch einen Lautsprecher
nachahmte. Die vielen anderen Laute ihrer Sprache geben aber noch
Rätsel auf. Hier soll ein Vergleich der Bild- und Tonaufzeichnungen
weiterhelfen.
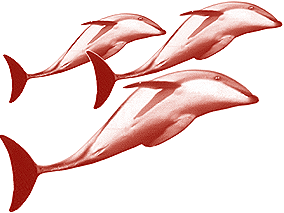
Die Kenntnis all dieser Zusammenhänge ist für die eigentliche
Aufgabe, nämlich die behutsame Vorbereitung der Delphine auf ein
Leben im Meer, besonders wichtig. An den Forschungen sind in Eilat
neben israelischen und deutschen Wissenschaftlern auch russische und
französische beteiligt. Sie haben noch viele Probleme zu lösen:
Wie finden sich die Neuankömmlinge im freien Meer zurecht? Passen sie
überhaupt zu den freilebenden Delphingruppen? Eines wußte man
bereits: Die Delphine haben offensichtlich Schwierigkeiten bei der
Orientierung in unbekannten Gewässern. Mitarbeiter von Prof. Todt
konnten zudem überraschend feststellen, daß sie sich besonders
davor scheuen, durch Tore oder torähnliche Öffnungen
hindurchzuschwimmen. So wird das Tor ins Meer, das vor einiger Zeit in
der Umzäunung des Freigeheges installiert wurde, nur von einem der
beiden Männchen regelmäßig benutzt. Das andere Männchen
wagte sich nur selten hinaus und die Weibchen blieben bisher immer in
ihrem Gebiet. Prof. Todt glaubt, dieses Verhalten kŻnnte ein Schlüssel
zum Verständnis des Orientierungssystems sein. Außerdem hofft er,
die natürliche Hemmung in Zukunft vielleicht gezielt zum Schutz der
Delphine einsetzen zu können, indem gefährliche Objekte - wie
z. B. Treibnetze - konstruktiv verändert werden. Die
Wissenschaftler schätzen auch als besonderen Vorteil, daß sie
erstmals eine größere Gruppe unter fast natürlichen
Bedingungen kontinuierlich beobachten können. Insbesondere die
Anwesenheit von zwei Männchen in der Gruppe ließe sich in
der Gefangenschaft eines Delphinariums nicht realisieren. So kann auch
die sehr flexible Rangordnung in Delphingruppen besser untersucht
werden, als das bisher möglich war: Wie tragen die beiden Männchen
ihre Konflikte untereinander aus, welche Bedeutung haben die recht
häufigen homosexuellen Kontakte und welche Rolle spielen die
Weibchen in der Sozialstruktur?

Der Delphin gibt den Verhaltensbiologen noch viele Rätsel auf. Und selbst ihnen fällt es nicht leicht, im Delphin ein ganz "normales" Tier zu sehen. Doch von falsch verstandener Tierliebe geht für diese faszinierenden Wesen mindestens ebenso viel Gefahr aus, wie von Treibnetzen. "Wer nicht umbringen will, was er liebt", rät Prof. Todt, "sollte sich deshalb zunächst vom Mythos des Menschenfreundes verabschieden". Der Delphin, so seine ernüchternde Erklärung, sucht normalerweise nicht gezielt die Nähe des Menschen. Weil alle seine natürlichen Feinde im Wasser leben, erkennt er im Menschen keine Gefahr und flüchtet deshalb nur nicht vor ihm. Vermutlich sind alle Begegnungen von freilebenden Delphinen mit Zweibeinern im offenen Meer deshalb reine Zufälle und vermutlich haben die eleganten Meeresbewohner an den eitlen Landratten der Gattung homo sapiens nicht das geringste Interesse.
Thomas Fester
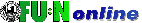 -Startseite
-Startseite